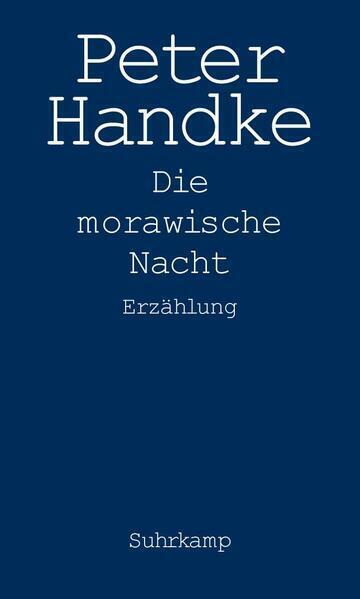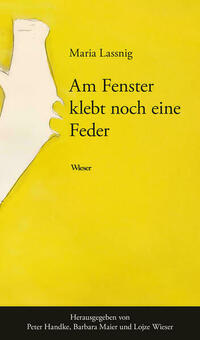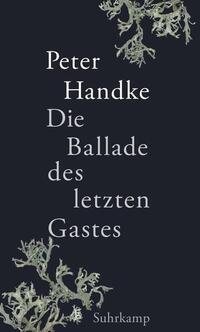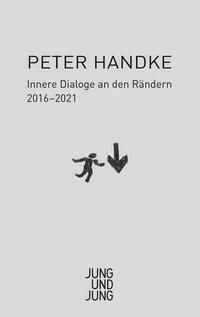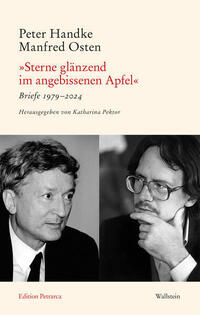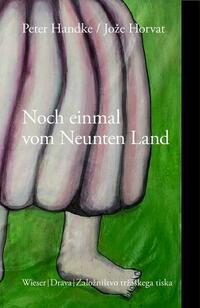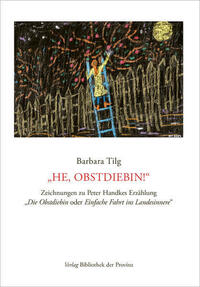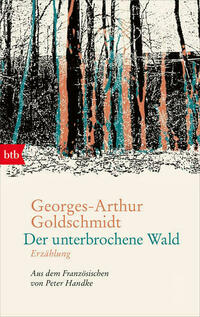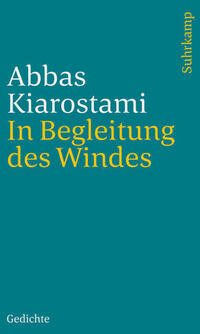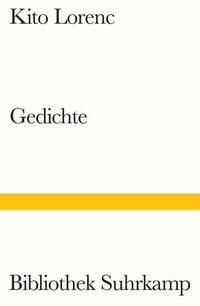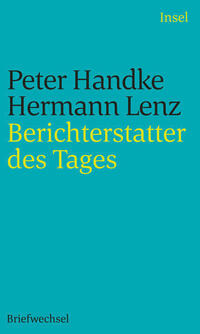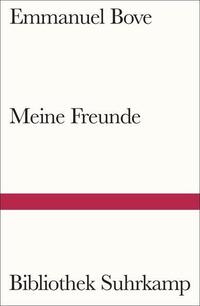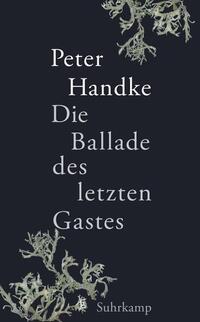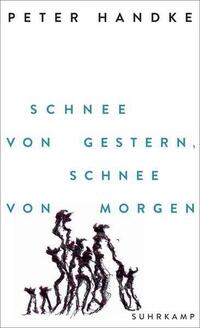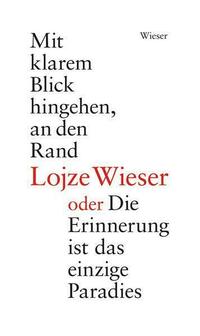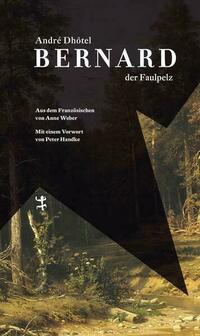Heimkehr in die Fremde
Karl Wagner in FALTER 4/2008 vom 23.01.2008 (S. 59)
Ich dachte gerade: Ich verdanke meiner Epoche viel. Ohne sie würde ich wohl nicht mehr leben: Sie lässt mich das tun, was ich kann und was nur ich kann; und ich will denen, die für den Fortschritt gearbeitet haben, welcher es jemandem wie mir erst ermöglichte, aus der Milieubeschränkung herauszukommen, mit meinen Taten dankbar sein." Das ist nachzulesen in Handkes "Geschichte des Bleistifts" – zur Beschämung der Nachfolger der hier Bedankten.
Nicht ohne Emphase hat Handke, dessen öffentliches Bild – durchaus mit seiner Mitwirkung – immer mehr einen Ent- oder gar Verrückten abzugeben scheint, eine Verortung seines Schreibprojekts vorgenommen. Die will so gar nicht zum Bild des Gegenaufklärers passen, das heute fast reflexhaft gegen ihn aufgeboten wird. Die "Postings" zu den Artikeln anlässlich des 65. Geburtstages oder zur Nachricht von dem Erwerb seines Vorlasses für das Österreichische Literaturarchiv lieferten Ende letzten Jahres ein bedrückendes Bild österreichischer Kunstfeindlichkeit und Ressentiments gegen einen der wichtigsten Autoren dieses Landes.
Noch 1999, einem der Höhepunkte des blindwütigen Handke-Bashing wie auch ebenso undifferenzierter, der Selbstkorrektur bedürftigen Aussagen Handkes zum Krieg in Jugoslawien, hatte er sich als Zugehörigen der österreichischen Arbeiterbewegung deklariert: "Ich zähle mich allerdings noch immer zur sozialistischen Tradition in Österreich. (
) Was Jugoslawien betrifft, so bin ich gern ewiggestrig oder meinetwegen nostalgisch. In Jugoslawien ist der Reformkommunismus, die Arbeiterselbstverwaltung, tragisch gescheitert." "Jugoslawien" ist auch eine Nagelprobe für ein anderes verspiegeltes Verhältnis: Handke nimmt es zum Anlass, zentrale Anliegen der Achtundsechziger – (soziale) Gerechtigkeit und Frieden – mit der Haltung der an die Macht gelangten Vertreter dieser Generation zu konfrontieren.
Bis zur "Kehre" der Tetralogie "Langsame Heimkehr" war Handkes Schreibregel entscheidend von Kafka und den durch diesen möglich gewordenen Nouveau Roman bestimmt. Eine Analytik der "Mikrophysik der Macht" kennzeichnet die frühe Prosa. Als sich Handke den im Gefolge von 1968 offerierten Verständigungstexten der Literatur der Arbeitswelt demonstrativ entzogen hatte, wurde er oft genug als unsicherer oder gar suspekter Mitstreiter einer auf Einverständnisdeklarationen fixierten politischen Opposition betrachtet. Wie kaum ein anderer hat Handke ein Sprachbewusstsein für die Floskeln solcher Erfahrung wie auch Erkenntnis verhindernden Übereinkünfte entwickelt. Sein ästhetischer "Formalismus" durchkreuzte also mehrfach "linke" Diskursregeln "um 1968", nicht zu reden von dem mehrheitsfähig gewordenen gesellschaftskritischen Realismus der Gruppe 47. In der Polemik gegen Reich-Ranicki widersetzt sich Handke eben so elegant wie klug den normativen Grundannahmen eines sich "natürlich" gebenden Realismusverständnisses. Das alles kann jetzt nachgelesen werden in dem bewusst nicht chronologisch gegliederten Essayband "Meine Ortstafeln. Meine Zeittafeln1967–2007". Wer noch halbwegs offenen Sinns ist, wird in diesem Buch einen der literarisch intelligentesten und sprachlich beweglichsten Autoren (wieder-)entdecken können.
Der aus dem regionalen wie sozialen Abseits als "vertical intruder" (John Berger) im literarischen Feld reüssierende Jungautor (mit der von der Rock- und Popmusik geborgten Gestik des Aufbegehrens und der Präsenz sowie der schnellen Koppelung von Trash und Tradition) konnte, so schien es, mühelos symbolisches in ökonomisches Kapital konvertieren. Vom Schreiben leben zu können hieß, zumindest damals noch, die Freiheit, aus einem reichhaltigen Fundus von Habitusformen des Protests, der Provokation und der Diva wählen zu dürfen.
Handke hat davon reichlich Gebrauch gemacht, aber früh schon eine existenzielle Verknüpfung von Literatur und damit eine andere, von der Mehrheit abweichende Lebensform gesucht. Seine demonstrativen Verschiebungen im literarischen Feld haben ihm die Aura eines "Autors mit einer Gemeinde" verliehen, samt den zugehörigen Exklusionsritualen. Eine "Heldenverehrung", die vor den Dissonanzen in Handkes Schreiben (und Leben) zurückschreckt, ist höchst unangemessen und bringt sich um wichtige Einsichten in die Tektonik und Brüche dieses Lebenswerks. Dazu gehört der jähe Umschlag von höchster Sensibilität des Weltwahrnehmens in brutale Gewalt. In Handkes letztem Werk wird dies mit äußerster, geradezu peinlicher Schonungslosigkeit ausgestellt. Der Protagonist, von Schuldgefühlen gebeutelt wie der Anton Reiser des Karl Philipp Moritz, weiß, dass es dafür auch keinen Freispruch gibt: "Er sah sich selber, im Moment des Schlags, und dieser Moment würde zeitlebens frisch in ihm aufzucken, mindestens einmal am Tag, und auch kein Erzählen davon würde ihn lindern oder von ihm freisprechen." Handkes Erzählprogramm der Entschleunigung und des Zögerns dient nicht von ungefähr der Einübung von Geduld (auch beim Leser) und als Vorkehrung gegen den stets möglichen Amoklauf.
In "Morawische Nacht" also setzt Handke – lässiger, spielerischer und zugleich verbindlicher – seine never-ending tour fort, die er spätestens mit seinem "Jahr in der Niemandsbucht" angetreten hat. Eine Erzählgesellschaft wird auf die "Morawische Nacht" gerufen, dem Hausboot des (mündlichen) Erzählers und vormaligen Schriftstellers, jetzt auch als "Ehemaliger" stigmatisiert. Das nur lose vertaute Erzähllokal im serbischen Donauzufluss Morawa mit den sieben Zuhörern – Freunden und (Reise-)Gefährten, die ihrerseits zu Mit- oder Zwischenerzählern werden – erinnert an das Schiff in der Themsemündung, aus Joseph Conrads "Herz der Finsternis", auf dem der Erzähler von seiner Reise in das Innere Afrikas und vom Grauen des Kolonialismus erzählt.
Der Ehemalige hat von einer "Rundreise" zu erzählen, die Flucht, Irrfahrt, Amoklauf, vom Zufall gewollte Umwege und Heimkehr in die Fremde verheißt; entsprechend die unterschiedlichen Sprach- und Erzählregister samt Tirade, Abschweifung, Aufzählung und Beschreibung. Der Eindruck, dass diese Erzählung auch eine über das Erzählen ist, verstärkt sich dadurch, dass sich der nächtliche Erzähler ein besonderes Wahrnehmungsprogramm verordnet: das Hören. Die Abundanz der Geräusche und ihrer Nuancen prägen diesen Text des sonst fürs Bild und "epische Schauen" zuständigen Autors. Entsprechend gehört zu den Stationen dieser Odyssee auch die Teilnahme an einem "Symposium über Lärm und Geräusche" in der spanischen Steppe.
Auf der langen Reise "ins tiefe Österreich" (so hieß das Romanprojekt, das Handke Anfang der Siebzigerjahre angekündigt hatte) gestattet sich der in Schwechat landende Erzähler einen ungeplanten Fußweg zur Gaststätte beim Friedhof der Namenlosen, wo die Maultrommler aller Welt ihren Erzählatem prüfen und nach Gutenstein, zu Ferdinand Raimunds "Landsitz".
Gerahmt wird diese Heimkehr von zwei Erzählsequenzen, die in der Literatur ihresgleichen suchen. Die eine steht am Anfang: die Busreise des Erzählers mit den Ausreisenden aus der namenlos bleibenden Enklave. Der alte Steyr-Diesel, der mit Steinen beworfen wird, ist auch das Fahrzeug aus der Schulzeit des Exautors, in dem damals dieselbe Musik erschallte: "Apache". Mit solch ungezwungenen Zeichen der Evidenz bricht hier einer auf zur "Insel seines ersten Buchs", wo das Drama der Unvereinbarkeit von Paarsein und Schreiben einst begonnen hat. Die andere findet sich, wie schon im "Grünen Heinrich", am Ende und handelt vom Wunsch des Erzählers, von seiner "Grundschuld", dem Tod/Selbstmord seiner Mutter, befreit zu sein.
Wer heute dem autobiografisch schnüffelnden Lesen noch ein wenig widerstehen kann, wird sich in einem Erzählwerk wiederfinden können, in dem seine Sache, die der Literatur und die seiner Epoche, verhandelt wird.