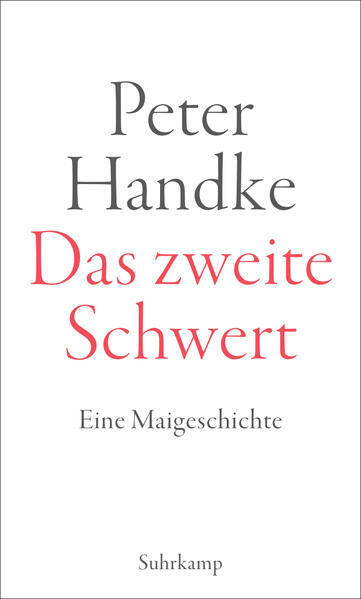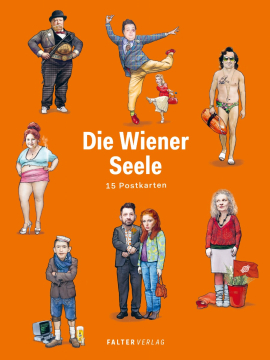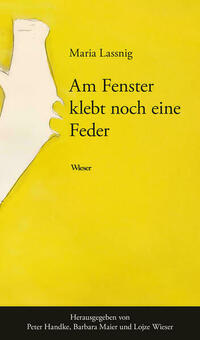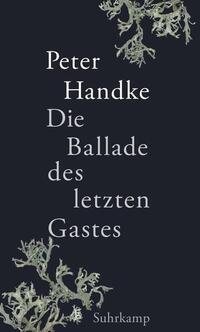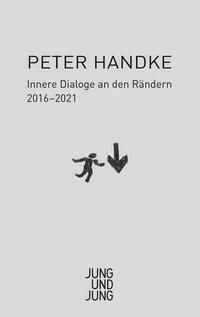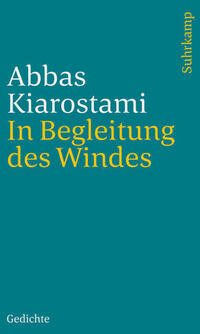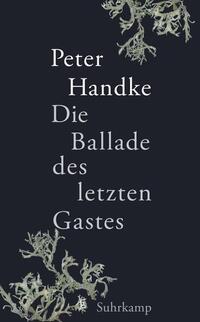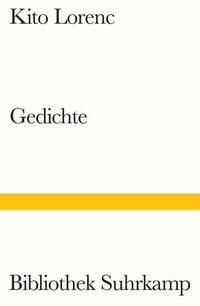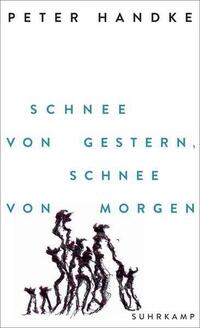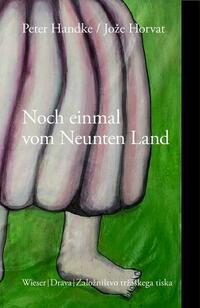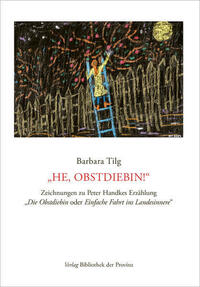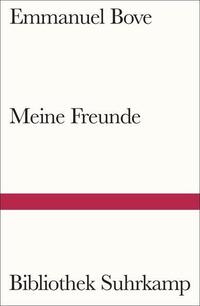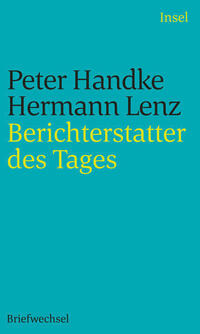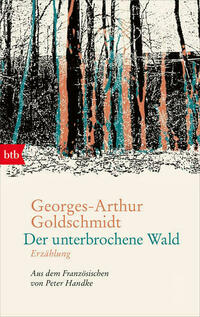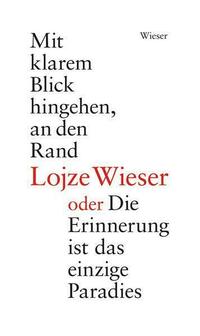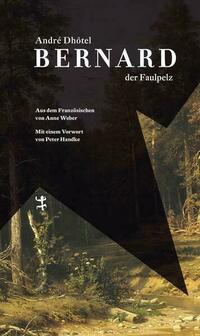Deine Mudda!
Klaus Nüchtern in FALTER 8/2020 vom 19.02.2020 (S. 35)
Der Literaturnobelpreisträger Peter Handke zückt im jüngsten Buch das Schwert. Zum Fürchten? Zum Ärgern!
April–Mai 2019 Île-de-France/Picardie. Seit über zwei Jahrzehnten vermerkt Peter Handke am Ende seiner Bücher, wann und wo sie entstanden sind. So auch in seinem jüngsten, „Das zweite Schwert“, dem ein martialisches Wort Jesu aus dem Lukas-Evangelium als titelstiftendes Motto dient und in dem sich der Ich-Erzähler gleich auf der ersten Seite daranmacht, „aus dem Haus zu gehen und die längst fällige Rache zu exekutieren“.
Der Verdacht, Handke würde mit dem rhetorischen Waffengefuchtel auf die hasserfüllten Reaktionen anlässlich seiner Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis reagieren, entbehrt also jeder Grundlage. Dass das Objekt der Rachegelüste eine Journalistin ist, kommt wenig überraschend, gelten Angehörige dieser Berufsgattung dem Autor doch seit Jahrzehnten als Inbegriff einer jedes Pauschalurteil rechtfertigenden Verkommenheit.
Auch Peter Handkes jüngstem Ich-Erzähler, der spricht wie Peter Handke, geht wie Peter Handke und aussieht wie Peter Handke, stellt sich die Sprache der Zeitungen „verkürzt gesagt“ als „Gipfel der Gewalttätigkeit“ dar, weswegen er auch auszieht, um den Rufmord an „meiner seligen, meiner heiligen Mutter“ zu rächen, die von besagter Journalistin mithilfe einer dreisten Fotomontage als Nazi-Sympathisantin verunglimpft worden ist.
Die Frage, warum jemand so etwas überhaupt tun sollte, geht bei einem Autor wie Handke freilich ins Leere. Der verfährt nach alter Inspektorenmanier – „Die Fragen stelle ich!“ – und gibt sich dann auch gleich selber die Antwort: Warum? Darum! O-Ton Handke: „Woher ich das wusste? Ich wusste es.“ Trotzig beharrt der Souverän des Erzählens auf seinen Wahrnehmungen: „Die Tatsachen konnten der Illusion nichts anhaben. Die Einbildung war dauerhaft (…). Ob wirklich oder nicht: sie wirkte.“
„Das zweite Schwert“ wird im Untertitel als „Maigeschichte“ ausgewiesen, und der Monat ist tatsächlich der genannte. Eine Geschichte, die sich nacherzählen ließe, wird dennoch nicht draus. Der Ich-Erzähler verlässt wieder einmal sein stilles Haus, macht das Gartentürl hinter sich zu, geht die Straße entlang, schnürt durch die Gegend, fährt mit Bus, Taxi und U-Bahn und liest gleichsam – Einwurf Handke (gleich dreimal): „nein, kein ,gleichsam‘“ – am Wegesrand auf, was ihm so unterkommt: Beobachtungen, Anekdoten, Gespräche, Figuren, Träume, eine rostige Nähnadel, einen verwitterten Bleistift: „Hatte es zur Zeit Pascals schon Bleistifte, überhaupt Stifte gegeben? Ich beschloß: ja.“
Nur die Pilze (Mairitterlinge, um genau zu sein) überlässt der Erzähler großzügig einem ihm flüchtig bekannten Strafrichter, der sich auf die Bank unterm blühenden Holunderstrauch zu ihm gesetzt hat und in einen selbstgeißlerischen Laberflash ausbricht: „Eine eigene Religion ist der Rechtsmissbrauch geworden, eine götzenhafte, vielleicht die letzte: das Ausspielen und Übertreiben der eigenen Rechte gegen den nebenan als Existenzbeweis. Ich schlage um mich mit meinen Rechten, also bin ich. Und nur so bin ich. Und nur so sind sie und spüren sie sich“ … usw., usf.
Mit den Augen des Pilznarren betrachtet verrät Handkes jüngstes Opus freilich, dass es diesmal kein gutes Schwammerljahr war. Vieles hat man bei diesem so ähnlich schon anderswo gelesen, und im Korb findet sich auch allerlei Ungenießbares, Bauchweh-Korallen etwa von so monströser Gestalt, dass sie ihresgleichen suchen. Ward je eine Straßenbahnhaltestelle so hochherzig und hochgemut besungen wie jene in Viroflay, wo sich der Erzähler – dies freilich sehr schön gesagt! – „von den in neuer Frische funktionierenden Rolltreppen in die Tiefe transportieren“ lässt? Wohl kaum:
„Porös und dabei robust, widerständiger, oder auf andere Weise widerständig, gegen die Zeit als Beton, ,spielerisch widerständig‘, zeigten sie sich, diese Erd-Sand-Schotter-Kiesel-Fels-Wände tief im Untergrund des Seitentals hinab zur Seine, eine bei Neubauten eher seltene Dauerhaftigkeit versprechend, insbesondere durch ihr augenfälligstes Baumaterial, das gleiche wie das der vielen nun weit länger als ein Jahrhundert bewohnten und von Generationen, in- wie ausländischen, weiterbewohnten Häuser der Gegend und überhaupt der Île-de-France: den Sandstein, den rotgraugelben, graugelbroten usw., welcher auf den ersten Blick gar bröckelig aussieht, nah am Verwittern (gleich wird er aus der Fassade fallen, und die mit ihm), in Wahrheit dagegen fast Feuersteinhärte hat, die scheinbaren Bröckelstellen unverwitterbare Kanten, messerscharfe.“
Hatte der junge Hippie Handke seinen Kollegen von der Gruppe 47 einst „Beschreibungsimpotenz“ vorgeworfen, so legt „Das zweite Schwert“ die Vermutung nahe, dass der Dichter im Alter an Deskriptionspriapismus laboriert. Allzu selten verlässt er sich auf seine Fähigkeiten, mit wenigen Worten Wahrnehmungen zu erfassen oder Stimmungen zu evozieren, verfällt stattdessen einer Verschwatztheit, die auch typografisch unschön zu Buche schlägt und Auffahrunfälle von Satzzeichen in Serie produziert. Ein Lektor, der bei Sinnen ist, hätte Handke zumindest ein Viertel der Beistriche, die Hälfte der Anführungs- und Fragezeichen und zwei Drittel der Klammern rausgeschmissen.
Ist „Das zweite Schwert“ also ein rettungsloser Vollverhau? Das wollen wir so hart nicht sagen. Das Buch hat – spärlich gesät, aber immerhin – seine „Momente“. Das anderslaute Rauschen (Seite 24 und 59) serviert der Autor mit gewohnter Grandezza und die fenstereinschlagende Gewaltfantasie gegen ein Yoga-Studio – „zur Strafe für die missbrauchten Dichterverse zu Bäumen, Selbstüberhebung und Seelenruhe“ – ist schon sehr komisch.
Außerdem nimmt einen dann schon für den mieselsüchtigen Maigeschichtenerzähler ein, dass dieser neben Homer, Tolstoi, Blaise Pascal und John Lennon auch noch den großen deutschen Besinnlichkeitsbarden Reinhard Mey würdigt – freilich ohne ihn beim Namen zu nennen. Der hatte 1974 die Ökokalypse in seinem Chanson „Es gibt keine Maikäfer mehr“ an die Wand gemalt, wohingegen Handkes Peter – Klimakatastrophe hin oder her – vorsichtig Entwarnung gibt: „Aber da: ein Maikäfer unter dem Kirschbaum auf dem Gehsteig, fast daumengroß, mit dem hellen Sägezahnmuster seitlich am Panzer, tot, in der Maiennacht erfroren, und da: noch einer, und der da krabbelt, lebt! Sie sind demnach nicht, wie behauptet, ausgestorben, die Maikäfer. Information! Gute Nachricht!“