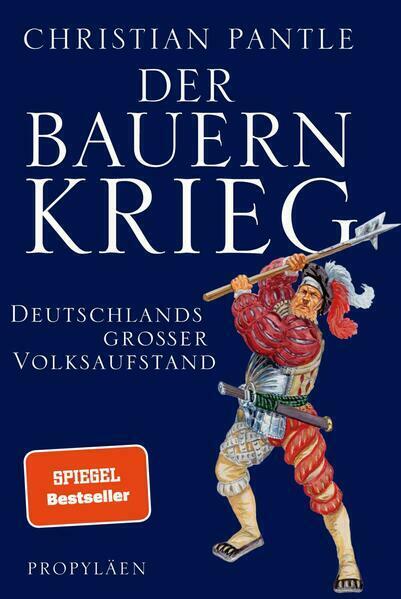Wo war denn da der Edelmann?
Alfred Pfoser in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 41)
Vor 500 Jahren endete der große deutsche Bauernkrieg. Heuer und im nächsten Jahr wird der Freiheitsbewegung und ihrer blutigen Niederlagen gedacht. Zum Jubiläum erscheinen Bücher, und Ausstellungen, darunter in Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Südtirol, sind bereits offen oder öffnen demnächst. Sie versuchen darzustellen, was wo passierte, und loten aus, was die Ursachen für diese bewegten Monate waren, als die alte feudale Ordnung wankte. Es ging vor einem halben Jahrtausend nicht nur um die Rücknahme ausbeuterischer Praktiken, sondern auch um Grundsätzliches: Erstmals wurden universelle Freiheitsrechte gefordert und eine allgemeine Gleichheit der Menschen postuliert. In großen Manifesten wurden kommunistische Utopien nach biblischem Vorbild entworfen: „Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann?“
Dabei waren Bauernkriege keine deutsche Spezialität. Bauernaufstände gab es vom 14. bis ins 19. Jahrhundert im gesamten Habsburgerreich (wie Wolfgang Maderthaner in seinem kürzlich erschienenen Buch „Zeitenbrüche“ dargestellt hat), auch in Frankreich, England, Russland und Sizilien. Der deutsche Bauernkrieg um 1524/25 war aber der größte Volksaufstand in Europa vor der Französischen Revolution: Hunderttausende Menschen waren involviert.
Seinen Ausgang nahm er in Südwestdeutschland. Dort lösten im Juni 1524 Schikanen kleinere Aufstände aus, die sich schnell zu einem Flächenbrand entwickelten. Zunächst setzten die Bauern bei ihren Aktionen auf Einsicht durch die adeligen Herrscher, stimmten Kompromissen zu, vertrauten den Versprechungen der Verhandler. Aber innerhalb weniger Monate radikalisierten sich beide Seiten und verschärften die Gangart. Die Herrscher, ob evangelisch oder katholisch, mobilisierten Söldnerheere; dem Aufstand folgten spektakuläre Hinrichtungen, brutaler Terror und unbarmherzige Verfolgung. Im Mai 1525 endeten drei Entscheidungsschlachten im Elsaß, in Württemberg und Thüringen in Gemetzeln mit zehntausenden Toten. Der Funke des Aufbegehrens sprang spät auch nach Österreich über, in Tirol gab es ab Anfang Mai 1525 Widerstand unter dem visionären Bauernführer Michael Gaismair. Ende Mai 1525 fügten Bauern und Bergknappen einem Adelsheer bei Schladming eine schwere Niederlage zu; im ganzen Land Salzburg herrschte Revolution.
Die Übersicht zu bewahren, ist nicht leicht: Wo gab es Unruhen und wo überall wurde gekämpft? Aus welchen sozialen Gruppen kamen die Rebellen? Wie weit verbündeten sich die Bauern mit dem Bürgertum in den damals aufblühenden Städten und den Bergknappen? Welche Ziele verfolgten die Aufstände? Gerd Schwerhoff hat viele Jahre über die Frühe Neuzeit geforscht; sein Buch („Der Bauernkrieg“, C. H. Beck) fügt ereignisgeschichtliche Regionalstudien zum großen Panorama zusammen. Bezeichnenderweise fällt es ihm aber schwer, über die Widersprüchlichkeit der aufbegehrenden „Haufen“ eine einheitliche Deutung zu spannen.
Leichter hat es da die flott geschriebene Einführung des Wissenschaftsjournalisten Christian Pantle („Der Bauernkrieg“, Propyläen): Sie bietet keine neue Forschung, sondern hat „bloß“ den Anspruch, die vorhandene Literatur zusammenzufassen, das Geschehen auf die großen Ereignisse herunterzubrechen und die wichtigsten handelnden Personen in Porträts der Heerführer, Ideologen und adeligen Gegenspieler vorzustellen.
Etwas anders geht es die australische Luther-Biografin Lyndal Roper mit ihrem Buch („Für die Freiheit“, S. Fischer) an, indem sie viele neue Fragen einführt: etwa nach der Rolle der Frauen, die auf den Höfen die Männer ersetzen mussten. Nicht verschlechterte wirtschaftliche Umstände hätten die Bauern dazu gebracht, sich zu erheben – vielmehr habe Martin Luthers aufrüttelnde Botschaft von der „Freiheit eines Christenmenschen“ in einer Epoche großer Veränderungen revolutionär gewirkt. Der neue Blick auf die Schöpfung und der Glaube an einen göttlichen Auftrag, das Christentum in Brüderlichkeit zu leben, veränderte radikal die Mentalitäten: Es war also die Theologie der Bauern, die der angeblichen Gottgegebenheit der feudalen Herrschaft ein Ende setzte.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: