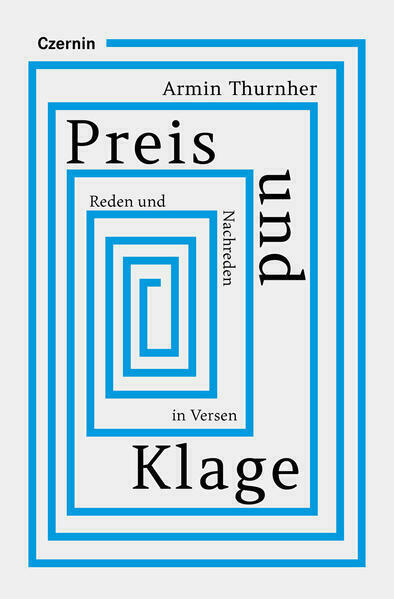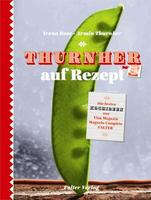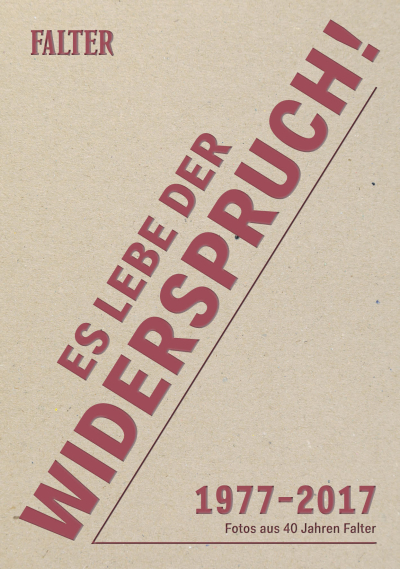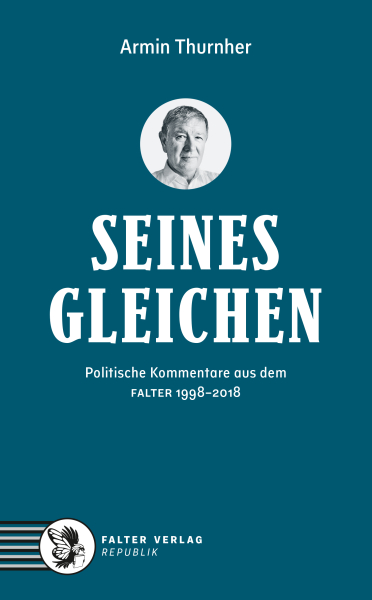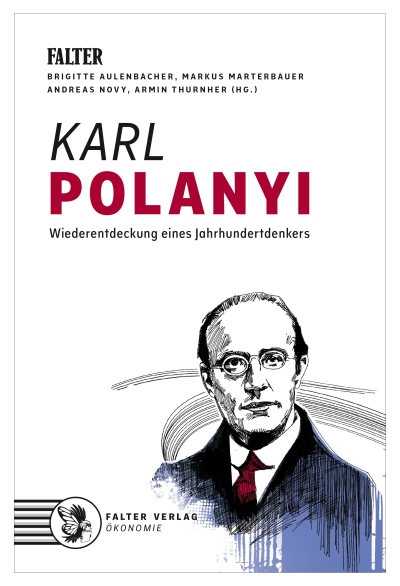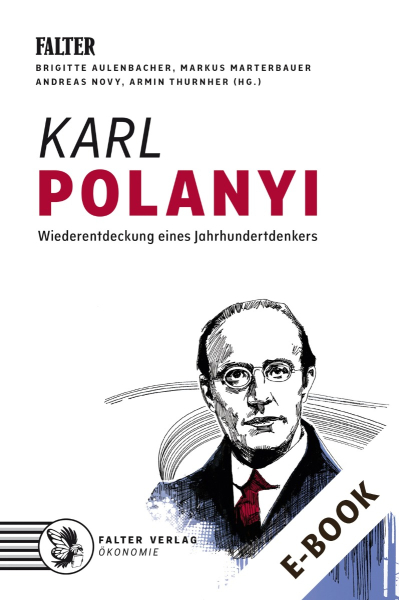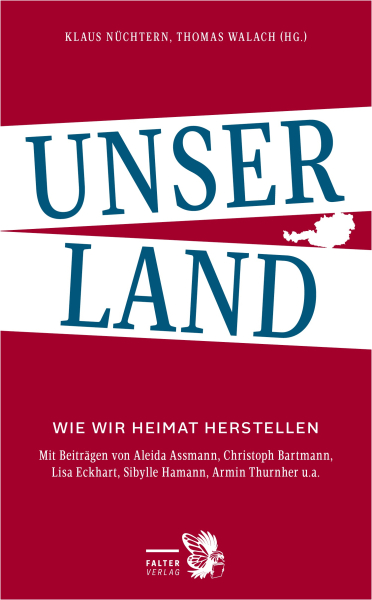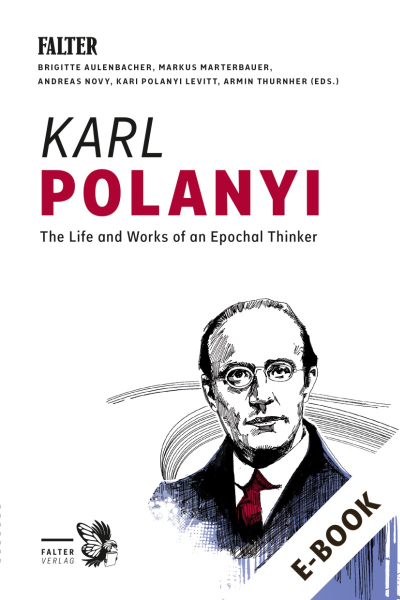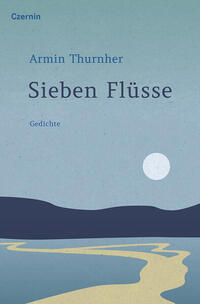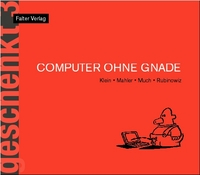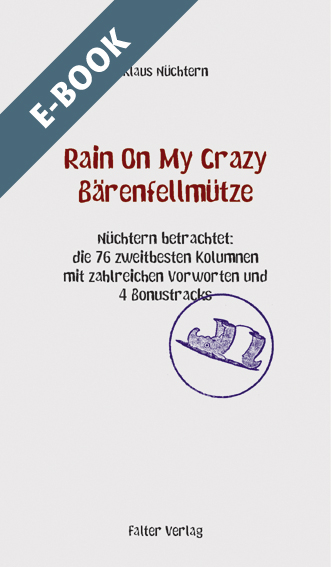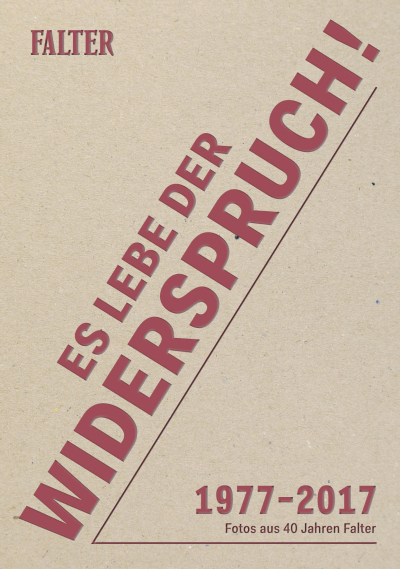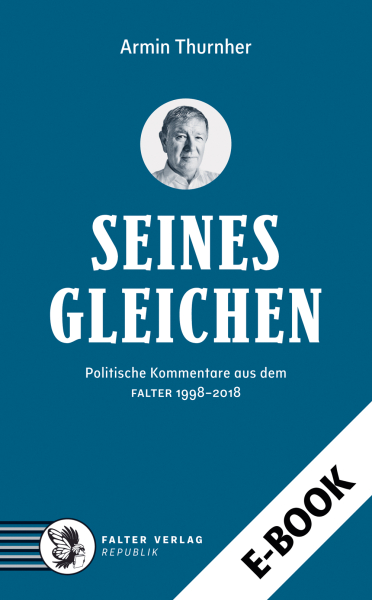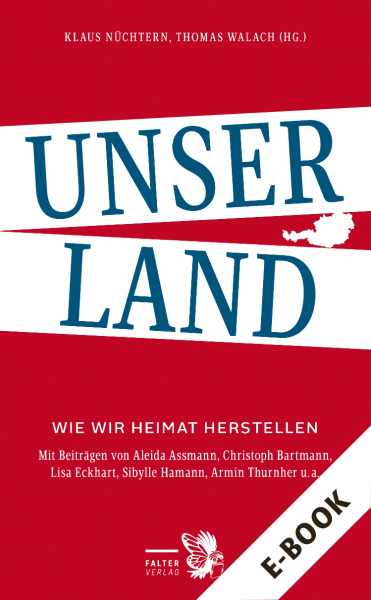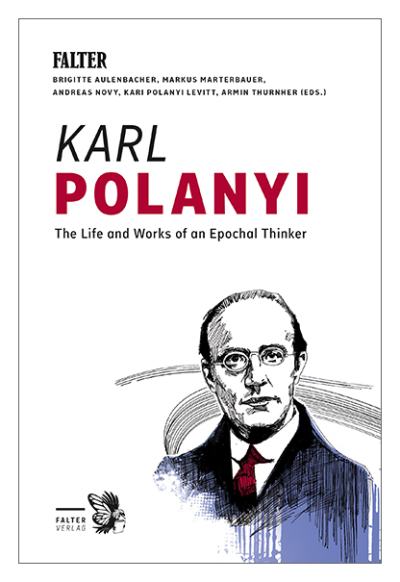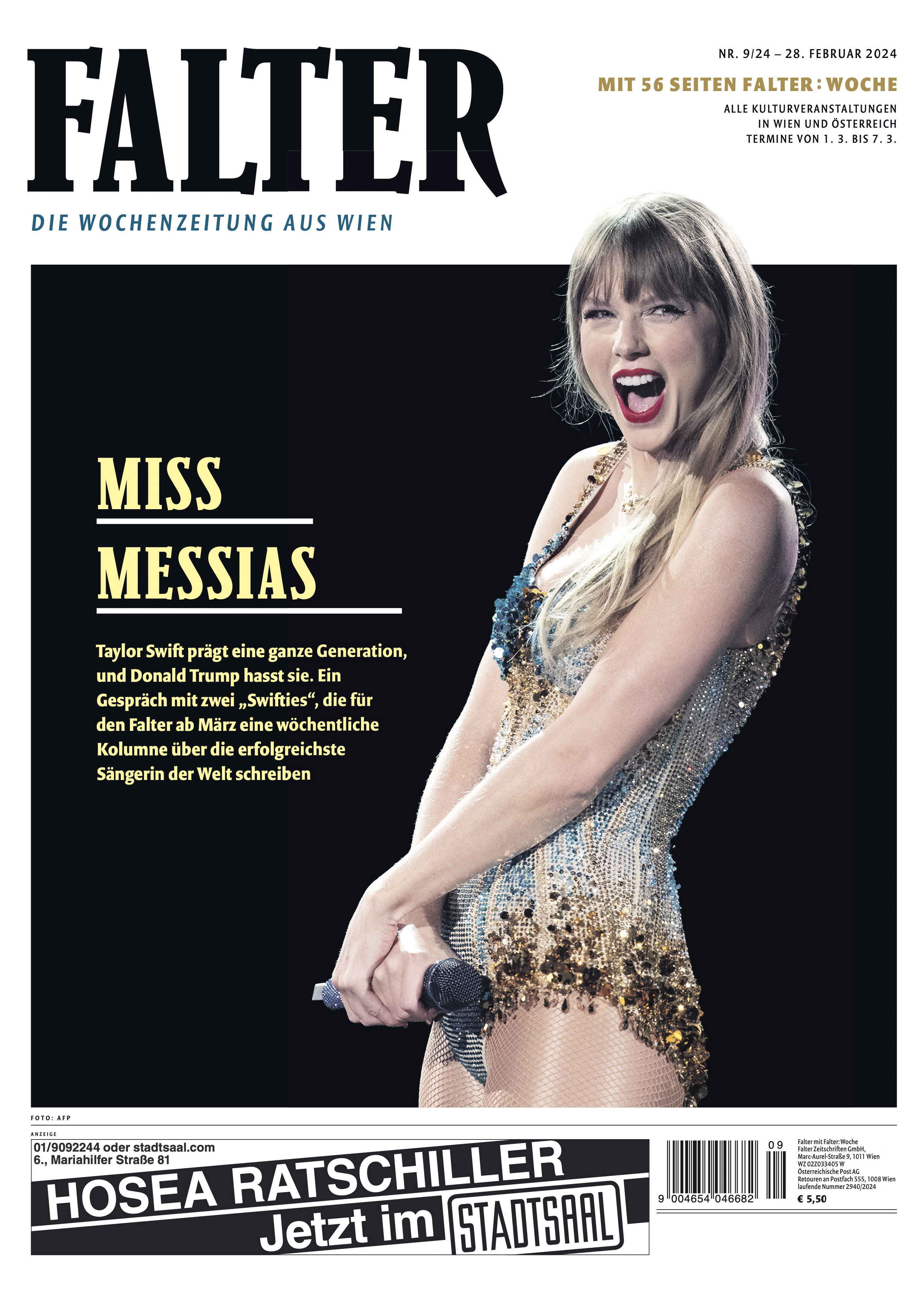
"Der Narzissmus ist ein Höllteufel, dem man nicht entkommt"
Lina Paulitsch in FALTER 9/2024 vom 28.02.2024 (S. 23)
Wer während Corona-Zeiten im Falter zu arbeiten begann, hörte von Armin Thurnher wie von einem Phantom: Ja, er ließe sich manchmal blicken. Nein, er sehe nicht mehr so aus wie auf dem kleinen Autorenbildchen der Zeitung, vor allem die Haarlänge solle sich stark verändert haben. Und: Er fehle, als Stimme der Vernunft und als intellektuelle Instanz.
Im Jahr 2020 hatte sich Thurnher aus dem täglichen Redaktionsbetrieb zurückgezogen und schreibt heute in seinem Domizil im Waldviertel. Anlässlich seines Geburtstags nahm er den Weg in die Wiener Redaktion auf sich, um mit zwei der jüngsten Redaktionsmitglieder ein Gespräch zu führen. Im Interview ging es um Generationenunterschiede, die Geburtsstunden der Wochenzeitung, linken Kapitalismus und wieso Thurnher kein Queerfeminist ist.
Falter: Lieber Armin, am Beginn eines Geburtstagsinterviews muss die Frage zum Ursprungsmythos stehen. Berichte uns bitte von deiner allerersten Falter-Erfahrung.
Armin Thurnher: Da gibt es viele. Wir waren Studenten der Theaterwissenschaft. Walter Martin Kienreich hatte die Idee, eine Stadtzeitung zu gründen. Er hatte das schon in Berlin, Amsterdam und London gesehen und versucht, mich an Bord zu holen. Ich wollte aber eine Dissertation über Walter Benjamin und den Ursprung des deutschen Trauerspiels schreiben. Nach ein paar Wochen war ich dann doch dabei. Wir haben uns in der Wohnung von Kienreich, in der Lenaugasse, getroffen: Studentinnen, Studenten und Künstler kamen zusammen, zum Beispiel Franz Varna, der mit anderen die Grafik der ersten Ausgaben gemacht hat.
Wieso hast du dich doch überzeugen lassen?
Thurnher: Einerseits, weil es mich angesteckt hat. Andererseits waren auf der Theaterwissenschaft alte Nazis am Werk. Die haben mir zu verstehen gegeben, dass linke Zecken bei ihnen nirgendwohin kommen. Daraufhin ist es mir relativ leicht gefallen, die Dissertation sausen zu lassen.
Apropos linke Zecken: Es war ja auch die Zeit der Arena-Besetzung, die sich gegen den Abriss des Gebäudes und für ein neues Kulturzentrum einsetzte. Wie prägend war das für euch?
Thurnher: Die Besetzung war sozusagen die Wiener Variante der 68er-Revolte.
Mit zehn Jahren Verspätung.
Thurnher: Quasi mit acht Jahren. Die 68er-Bewegung hat es in Wien auch gegeben, aber sie war auf kleine Zirkel beschränkt. In der Arena hat man gesehen: Das Potenzial ist groß und die Unzufriedenheit mit der Politik der Gemeinde Wien riesig. Gleichzeitig gibt es ein kulturelles Interesse an Dingen, die ausgegrenzt waren. Zum Beispiel wurde Off-Theater in den Zeitungen nur marginal behandelt und bekam kein Geld.
Ihr wart beim Falter zunächst als Redaktionskollektiv organisiert. Wieso war das wichtig?
Thurnher: Ob man es glaubt oder nicht, aber wir hatten damals schon etwas gegen das patriarchale System und autoritäre Männer. Ich kannte das Prinzip des Kollektivs aus dem Theater, wir waren der Meinung, dass Kollektive Produktivkräfte entfalten können. Damals, in der Nachkriegsgesellschaft, war der autoritäre Charakter das gängige Modell. Also musste man dem etwas entgegensetzen. Wir haben nicht nur den Journalismus kritisiert, wir haben auch versucht, es anders zu machen.
Wann war es vorbei mit dem Kollektiv?
Thurnher: Anfang der 80er-Jahre. Der Falter ist stark gewachsen und hat verschiedene neue Geschäftsfelder entwickelt. Das war nicht mehr zu verwalten und die kollektiven Entscheidungsmechanismen haben nicht mehr funktioniert. Wir haben dann aber trotzdem versucht, eine Reform mit möglichst flachen Hierarchien durchzuziehen.
Und du bliebst übrig als Chef?
Thurnher: Ich blieb mehrmals übrig.
Würdest du retrospektiv sagen, eine einzelne Person leitet besser als ein Kollektiv, oder umgekehrt?
Thurnher: Es ist nicht entschieden. Jetzt kommt eine neue Zeit, mit Homeoffice und digitaler Kommunikation, Signal-Gruppen, wo Dinge diskutiert werden können, sodass Entscheidungen transparenter werden. Vielleicht kommt das Kollektiv jetzt zurück. Es ist sinnlos, die Fähigkeiten von Menschen, die es besser können als die Chefs, zu unterdrücken. Aber man muss es clever organisieren. Wenn alle ungebremst zum Zug kommen, gibt es Streit.
Wie viele Exemplare habt ihr damals verkauft?
Thurnher: Von der ersten Nummer fast 2000 Stück. Das war wirklich sensationell, weil wir keine Werbung hatten, nichts. Aber Walter Martin Kienreich war clever und hat Wohngemeinschaften mit Routen durch Stadtteile, in denen es Szenelokale gab, "betraut". Die gingen hinein und haben den Leuten den Falter unter die Nase gehalten. "Kost' zehn Schilling!" Ohne diese Verkaufsfreudigkeit hätt's uns überhaupt nicht gegeben.
Du hast dich mit der Arena-Besetzung und auch mit den Hochschulprotesten im Jahr 2009/2010 solidarisiert. Wie hältst du es mit Aktivismus im Journalismus? Wo ziehst du die Grenze?
Thurnher: Aktivismus ist das Problem jedes Einzelnen. Ich bin durchaus dafür, dass sich auch Journalistinnen und Journalisten aktivistisch betätigen, wenn sie wollen. Ich gehe demonstrieren und lasse mir das von niemandem verbieten, wenn ich es für angemessen erachte. Im Beruf selbst darf es natürlich nicht die Kriterien der sauberen journalistischen Arbeit außer Kraft setzen. Aber man muss immer seinen Standpunkt klarmachen. Es gibt Tendenzen, Meinungskommentare, Polemiken oder Satire außer Kraft zu setzen -das ist Schwachsinn. Das gehört alles zum Journalismus dazu und kann eigentlich nicht scharf genug sein. Die Grenzen sind dort, wo Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Das darf in keiner Geschichte der Fall sein, auch in keiner Aufdeckergeschichte.
Du hast den Falter von damals als politisch radikale Zeitung bezeichnet. Würdest du sagen, das ist heute auch noch so?
Thurnher: Nein, heute sind wir eigentlich ziemlich Mainstream, weil wir journalistische Kriterien beachten. Aber meinetwegen könnten wir auch ein bisschen schärfer sein.
Inwiefern schärfer?
Thurnher: Politisch sind wir schon sehr ausgewogen. Für meinen persönlichen Geschmack ist es ausgewogener, als es sein müsste. Aber ich sehe auch ein, dass damit ein breiteres Publikum erreicht wird.
Ist Ausgewogenheit nicht ein journalistisches Kriterium, ein Zeichen von Professionalität?
Thurnher: Nein! Man muss sich genau überlegen, was Ausgewogenheit bedeutet. Dass ich für jeden Skandal oder Missstand, den ich aufdecke, in gleicher Länge eine Geschichte habe, die die Schönheiten des Systems preist? So kann es nicht sein. Nochmal etwas anderes ist es, wenn bei der Leserschaft das Gefühl entsteht, alles gehe den Bach runter. Das sehe ich auch als Problem. Aber dann bin ich dafür, dass man mit Enthusiasmus Dinge beschreibt, die man gut und richtig findet.
Aber haben sich nicht auch die Zeiten stark geändert? Es gibt eine Krise, was das Vertrauen in die Medien betrifft. In vielen Teilen der Bevölkerung wird fehlende Ausgewogenheit bemängelt.
Thurnher: Das ist ein Kampfbegriff geworden. Wenn man nur ein kritisches Wörtchen äußert, fährt gleich der Zeigefinger hoch und es heißt: fehlende Ausgewogenheit. Von dem darf man sich nicht irre machen lassen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk definiert etwa Ausgewogenheit im Sinne politischer Feigheit. Weil er nach dem Prinzip verfährt: Wo der Gigl sitzt, muss auch der Gogl sitzen -wo der Rote, da der Schwarze.
In der Wissenschaft nennt man das False Balance: Zwei Positionen werden als gleichwertig dargestellt, obwohl die Fakten klar für eine Seite sprechen.
Thurnher: Absolute False Balance. Jeder soll seinen Standpunkt klar machen, der wird berichtet und dann passt es. Mit der falschen Art von Ausgewogenheit kommt man nirgends hin. Vor allem nicht, weil so viele unausgewogene Kräfte am Werk sind, die völlig intransparent agieren. Die ganze digitale Welt ist sowas von unausgewogen.
Das ist doch genau das Problem: Wir haben offensichtlich viele Leute im digitalen Raum, die Medien kritisieren und gleichzeitig Journalisten, die -das zeigen Studien zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland -wirklich eher Rot und Grün wählen.
Thurnher: Das würde ich so revidieren, dass es auch kluge Konservative geben muss, die schreiben und in Medien auftreten. Und das soll man auch befördern und die Auseinandersetzung suchen. Es fehlen einem in Wirklichkeit die Gegner -wer als solcher auftritt, ist ein Haxlbeißer oder ein anonymer Desinformant. Besser als gespielte Ausgewogenheit wäre es, dafür zu sorgen, dass das Bild der Menschen, die in Medien publizieren, einigermaßen ausgewogen ist.
Medien haben auch viele neue Herausforderungen: Gleichberechtigung, Inklusivität. Wird der Falter dem gerecht?
Thurnher: Von außen sehe ich, dass sich die Sache quantitativ völlig verändert hat. Es sind jetzt viel mehr junge Frauen da. Als wir den Falter gegründet haben, waren fast nur Männer dabei. Es gab zwei, drei Frauen, die in der Grafik-oder Programmabteilung arbeiteten, aber sehr wenige in der Redaktion.
Wieso? Thurnher: Meiner Meinung nach ist es eine gesellschaftliche Frage. Die Frauen sind nicht ermutigt worden, das waren Einzelerscheinungen.
Aber habt ihr euch aktiv nach Frauen umgeschaut?
Thurnher: Ja, habe ich. Doris Knecht war als meine Nachfolgerin im Gespräch. Sie ist aber im Zuge der Abgangswellen dem Falter abhandengekommen. Damals haben uns andere Medien unsere Leute -die besser waren, aber schlechter verdienten - abgeworben. Die Frage nach dem Wieso ist eine des Angebots: Weil sich an den Schulen, an den Universitäten und im Journalismusstudium jetzt viel mehr Frauen zeigen.
Vielleicht hatte es auch etwas mit dem Image des Falter zu tun, der als Männer-Partie verschrien war. Es gab Zeitungscover mit der Zeile "Wir haben gebumst". So ein pubertärer, männlicher Humor kam eventuell bei Redakteurinnen nicht so gut an.
Thurnher: Es gab ein unglaublich doofes Profil-Cover, da stand drauf: "Wir haben gekifft", mit Bildern von Leuten, die gekifft haben. Dann haben wir uns gefragt, wie kann man das mit was noch Blöderem toppen. Die Frauen waren davon auch begeistert, das war nicht nur ein Macho-Schmäh. Aber natürlich nehme ich als alter weißer Mann alles auf mich, was Frauenfeindliches in der Falter-Geschichte passiert ist. Ich bekenne mich zu allen Daten und Taten.
So ein Cover gäbe es heute vermutlich nicht mehr. Sind wir prüder geworden?
Thurnher: Ja, ein bisschen mehr Kessheit kann ich mir schon vorstellen.
Auch wenn es Leute beleidigen würde?
Thurnher: Ich finde, man kann gar nicht so viele Großmütter haben, wie man sie für Witze verkaufen müsste.
Und wie hältst du es mit dem Feminismus?
Thurnher: Alle Frauen, mit denen ich in meinem Leben gelebt habe, haben mich sehr kritisch gesehen. Ich gehe auch nicht wie manche Politiker her und sage halb ironisch: "Ich bin Österreichs erster Feminist." Es ist etwas differenzierter. Ich bin kein Anhänger der Theorien von Judith Butler, aber grundsätzlich sind die Anliegen des Feminismus für Gleichberechtigung eine Selbstverständlichkeit.
Also bist du kein Queerfeminist?
Thurnher: Ich halte Identitätspolitik in der Tat für ein Problem. Ich bin für die Rechte von allen Menschen, mit allen möglichen Chromosomen. Aber ich glaube, Identitätspolitik wird in ihrer Wichtigkeit deutlich übertrieben.
Auch im Journalismus?
Thurnher: Gerade im Journalismus. Es sind wichtige Themen, die eine Bedeutung haben für bestimmte Gruppen und nicht unterdrückt werden sollen. Aber Journalismus ist auch die Kunst der Verhältnismäßigkeit. Wichtiger als die Ausgewogenheit ist, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, wie bedeutend welche Themen sind - und wo wir diese Bedeutungshierarchie brechen. Wenn es für viele Jugendliche ein psychologisches Problem ist, dass ihre Gefühle der Geschlechtsidentität nicht ernst genommen werden, dann ist es ein gesellschaftliches Problem, über das berichtet werden muss. Etwas anderes ist, sich als Dauerthema dranzuhängen.
Queerfeministinnen würden sagen, dass Themen wie Trans-Identitäten auch dem Rest der Gesellschaft etwas erzählen. Indem man reflektiert, was Geschlechterkonventionen mit unserer Welt machen. Thurnher: Das kann man aber von jedem Thema sagen: Klima
Ist auch ein wichtiges Thema!
Thurnher: oder Klassenbeziehungen. Man muss gewichten.
Stichwort Kapitalismus. Der Falter war in seiner Ursprungsidee links, radikal und damit antikapitalistisch. Du hast als Eigentümer aus der Zeitung dann ein Geschäftsmodell gemacht. Wie schlägt man Profit aus etwas, das per definitionem nicht profitabel sein will?
Thurnher: Ja, das ist ein Widerspruch. Ich bezeichne mich gerne als linken Kapitalisten. Von 25 des Falter-Redaktionskollektivs blieben in den frühen 80ern sechs übrig, die bereit waren, bei der Bank zu unterschreiben, dass sie für eine Million Schilling haften. Irgendwann dachte ich mir, wenn ich so viel Risiko auf mich nehme und verschiedene Karrieren ausschlage, dann will ich wenigstens ein Kapitalist sein. Aber in Summe haben sich die Gewinne in Grenzen gehalten. Wenn wir die Gesetze des Medienkapitalismus eingehalten hätten, dann hätten wir das Ding relativ früh verkauft. Wir waren aber schon happy mit einer schwarzen Null. Linker Kapitalismus deshalb, weil wir nicht nur an die Verwertungsinteressen des Kapitals dachten, sondern auch an den gesellschaftlichen Wert.
Du hast 20 Jahre lang deine Falter-Kolumne mit den Worten: "Im Übrigen bin ich der Meinung, der Mediamil-Komplex muss zerschlagen werden" geschlossen. Mit "Mediamil" ist die Mediaprint gemeint, die Krone und auch Profil verlegt. Wieso hast du damit angefangen und wieso wieder aufgehört?
Thurnher: Hans Dichand, der Herausgeber der Kronen Zeitung, hatte das Pseudonym Cato, nach dem römischen Feldherrn. Cato stellte ans Ende jeder Rede den berühmten letzten Satz: "Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zu zerstören ist." Cato alias Dichand hat aber nie so etwas geschrieben. Also hab ich gesagt, den letzten Satz spendier' ich ihm. Es wurde damals als sehr mutig angesehen, gegen die Kronen Zeitung aufzutreten. Ich wusste, das bedeutet ein individuelles Karriereverbot. Die Macht des Dichand hat so weit gereicht, dass kein österreichischer Verleger oder auch Politiker sich getraut hätte, mich in eine Position zu hieven, wenn Dichand dazu Nein sagt. Es hat mir aber auch gefallen, etwas zu sagen, das verrückt ist und nie ausgesprochen wird. Die Dichands betreiben immer noch -um das Wort Mafia zu vermeiden -ein "familiöses" Spiel. Nach 20 Jahren habe ich mit dem Satz aufgehört, weil er mir langweilig geworden ist.
Würdest du sagen, dein Satz hat was gebracht?
Thurnher: Er hat uns einen Prozess gebracht, der den Falter fast umgebracht hätte. Andererseits auch viel Zuspruch und Solidarität - und damit Reichweite und Abos.
Du bist ein dezidierter Kritiker der Social-Media-Konzerne und von deren Datenausbeutung. Selbst bist du aber etwa auf Twitter bzw. X sehr aktiv. Und zwar im Sinne einer paradoxen Intervention: Du sprichst von dir nur in der dritten Person, also als Büro Thurnher. Bedient das nicht denselben Narzissmus wie das Ich, also die erste Person?
Thurnher: Der Narzissmus ist ein Höllteufel, der einen erwischt und dem man nicht entkommt, sobald man den kleinen Finger in Social Media hineinsteckt. Nachdem ich auch als Buchautor tätig bin und in Deutschland als Kommentator angefragt wurde, habe ich eines Tages bemerkt, das Interesse lässt nach. Ich habe mich gefragt, ob das Ageismus ist oder meine geistigen Fähigkeiten nachlassen. Aber nein, die deutschen Kollegen schauen auf Social Media, und wenn man dort nicht präsent ist, existiert man nicht.
Allerdings ist X seit Elon Musks Übernahme sehr problematisch. Immer mehr bekannte Journalisten legen ihre Accounts still.
Thurnher: Ich habe vorsichtshalber schon ein Füßchen bei Bluesky in der Tür. Musk rückt die Rechten auf X in den Vordergrund und dämpft die Linken eher ab. Es interessiert mich, mir das anzuschauen. Ich versuche jedoch, den narzisstischen Zeigefinger wenigstens unter der Tischkante zu halten oder nur auf den Tisch zu klopfen, aber ihn nicht ganz zu hoch hinauszustrecken.
Der Falter galt in der Regierungszeit von Sebastian Kurz als Feindmedium. Ist das immer noch so mit der aktuellen ÖVP?
Thurnher: Das glaube ich schon. Der Begriff des Feindmediums stammt von Carl Schmitt, also dem Kronjuristen der Nazis. Dessen Grundthese war, dass es in der Politik keine Gegner gibt, sondern nur Freund und Feind. Dem hat sich die ÖVP angeschlossen, wahrscheinlich ohne Carl Schmitt zu kennen. Bei der früheren Inseratenkorruption unter der Regierung Schüssel war es so, dass es politische Gegner gab, die nicht völlig auszuschließen und auszumerzen waren. Kurz aber hat die Inserate für den Falter einfach gestrichen.
Weil wir gerade von Feindbildern sprechen: Was verkörpert Wolfgang Sobotka, der Präsident des Nationalrates, für dich? Du forderst auf Twitter täglich seinen Rücktritt.
Thurnher: Der Sobotka ist eine vollkommen unmögliche Operettenfigur, der in der Politik als Bezirkshauptmann wahrscheinlich über seine Fähigkeiten besetzt wäre. Das jemand so konsequent - trotz all seiner bewiesenen Fehler, Pleiten, Unfähigkeiten und Gemeinheiten - immer weiter nach oben fliegt und sich dabei so derart großartig vorkommt, scheint mir wirklich etwas Bizarres. Ich finde den ja in Wirklichkeit fast schon liebenswert in seiner Bizarrerie.
Solche Figuren gibt es in Österreich allerdings viele. Was macht Sobotka besonders?
Thurnher: Gerade diese eingebildete Kulturkompetenz. Er ist firm in klassischer Musik, ein Dirigent, und das bezieht er dann auf alles. Aber wenn er etwas sagt, dann sagt er es so, dass man es nicht versteht, weil er die Syntax nicht beherrscht und weil die Sprache mit ihm davongaloppiert.
Sobotkinesisch nennst du das.
Thurnher: Ja, daraus muss man dann rückübersetzen. Manchmal benennt er die Dinge, wie sie sind. Etwa, wenn er sich bei Wolfgang Fellner ins Fernsehen setzt und von Gegengeschäften mit Inseraten spricht. Er decouvriert sich dauernd, macht sich lächerlich und in Wirklichkeit äußert er die ganze Zeit nur Bullshit. Das ist so jenseits von Österreich, dass es schon wieder urösterreichisch ist und mir deswegen wahnsinnig auf die Nerven geht.
Apropos Sprache: Woher kommt deine Vorliebe für den Hexameter?
Thurnher: In der Schule hatte ich acht Jahre Latein und sechs Jahre Griechisch. Ich wurde durch Übersetzungen sozialisiert, die oft in Hexametern sind. Schon als Schüler habe ich mir angewöhnt, zu Anlässen so halblustige Sachen zu schreiben. Das strengere Versgerüst bietet die Möglichkeit, Dinge zu sagen, die sonst vielleicht trivial wären, die aber in dem rhythmischen und musikalischen Klang akzeptiert werden. Der erste Anlass war, eine Preisrede in Hexametern zu schreiben. Dann kamen die Todesnachrichten und damit die Trauerreden.
Du spielst selbst sehr gut Klavier. Wie wichtig ist dir Musikalität in journalistischen Texten?
Thurnher: Jeder Text ist eine Komposition. Am besten sind Texte, die Schwung haben. Der erste Satz ist entscheidend. Das ist wie der musikalische Auftakt. Es gibt Auftakte, die sind ganz still und schleppend, sind absichtlich dissonant. Dann gibt es eine Pause und es geht frisch dahin. Das Tempo sollte auch dem Gegenstand angemessen sein.
Vergeht dir nie die Lust am Schreiben? Du schreibst täglich deine Seuchenkolumne und jede Woche deinen Kommentar "Seinesgleichen".
Thurnher: Es ist im Gegenteil eine Sucht. Das Schreiben ist habituell, es oszilliert zwischen Lust und Last. Solange ich schreibe, lebe ich.
Und solange du lebst, schreibst du.
Thurnher: So ist es.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen:
Der Nuntius der Lüge
Armin Thurnher in FALTER 11/2023 vom 15.03.2023 (S. 16)
Lassen Sie sich nicht täuschen! Wenn hier von Sebastian Kurz die Rede ist und von Anstand, dann immer von der öffentlichen Person, vom politischen Darsteller, vom Staatsschauspieler Kurz. Er ist körpersprachlich und eristisch (rechthaberisch, nicht zu verwechseln mit rhetorisch) perfekt geschult. Das ist hinreichend untersucht, sodass niemand in die Illusion verfallen muss, es handle sich um natürliche Gaben der Selbstdarstellung oder der Beredsamkeit. Hier ist alles Kunst, vielmehr künstlich, bis hin zum Schemel, den ihm bei Wahlkampagnen ein Begleiter ans Rednerpult stellt, damit er größer wirkt, und anschließend gleich wieder wegzieht und bis zu den Vorgaben seines Kabinetts, aus welchem Blickwinkel er zu fotografieren ist ("Blickwinkel leichtes Profil / nicht frontal / auf Augenhöhe"), wir kennen die Vertrauen stiftenden Körperhaltungen und die segnenden Gesten, die jeden Kardinal vor Neid erblassen lassen.
Aber in dieser politischen Persona wurde von Anfang an ein politisches Programm sichtbar. Kurz machte nie ein Geheimnis daraus. Das Neue daran war die Entschlossenheit, so ein Konzept durchzuziehen, vollkommen gleichgültig gegenüber persönlichen Rücksichten oder Umständen oder gar Erfordernissen des Anstands. Diese Entschlossenheit gehört zur kriegerischen Haltung einer Kaste, die Sieg will. Sie wird im Sport vorexerziert und eingeübt und hat nur ein Ziel: die Niederlage des Gegners, nein, des Feindes. Nicht von ungefähr charakterisierte die Kurz-Truppe intern ihr kritisch gesinnte Medien als "Feindmedien". Man kennt die Rede auch aus dem Sprachgebrauch von Konzernen, die sich stets "im Krieg" mit anderen befinden, und aus dem Sport, wo "Monstermentalität" massenwirksam eingeübt und gefordert wird.
Wer ist der Feind? Da ist einmal die repräsentative Demokratie, am verachtenswertesten in Gestalt des Sozialstaats. Da ist die Sozialdemokratie. Und das ist, was man im Allgemeinen als den modernen Liberalismus betrachtet, das aufgeklärte Denken der Moderne, die pluralistische Gesellschaft. Warum nenne ich eine höchst aktuelle Figur wie Kurz antimodern? Weil man jene wirtschaftliche Moderne, auf deren Seite er sich geschlagen hat, den neoliberalen Finanzkapitalismus, nicht mehr zur Moderne, sondern zu deren Feinden rechnen muss.
Die Interessen der Mächtigen laufen denen der Demokratie zuwider. Der Realkapitalismus ist vom Finanzkapitalismus abgelöst worden. Das bringt ein neues Set von Einstellungen mit sich. Die lange Welle der neoliberalen Propaganda hat diese Einstellungen mit viel Geld und strategischer Ausdauer in der Welt verbreitet; der Sieg des Neoliberalismus hat die einschlägige Mentalität von Business-Schools und Wirtschaftseliten ausgehend so tief ins allgemeine Bewusstsein verankert, dass sich die meisten nicht einmal dessen bewusst sind, im Neoliberalismus zu leben. Das wäre, als hätten Einwohner der Sowjetunion nicht geahnt, dass sie im Kommunismus leben.
Trotz dieser beinahe allgemeinen Verblendung sind in Europa, vor allem in einem Staat wie Österreich, die Beharrungskräfte des Sozialstaats noch längst nicht überwunden. Neue zivilgesellschaftliche Organisationen stellen sich aber nicht an die Seite des Sozialstaats, vielmehr definieren sie ihre ethischen Vorstellungen identitätspolitisch oder vor dem Horizont des Überlebens der Gattung. Teile dessen, was man einst soziale Bewegungen nannte, sind mit den Grünen unversehens in eine Koalition mit Kräften geraten, die ihren Prinzipen zuwiderlaufen.
Die sozialdemokratische Opposition wiederum tut sich immer schwerer, die Glaubwürdigkeit ihres Engagements für Zivilgesellschaft und die unteren Klassen der Gesellschaft darzutun, weil ihre Exponenten selbst in die Finanzwirtschaft streben, als Investoren oder ins Management börsennotierter Gesellschaften. So finden wir einstige Arbeiterführer als Freunde der Oligarchen wieder, erstaunt darüber, dass die Massen nicht mehr ihnen glauben, sondern rechtsextremen Agitatoren, die ihnen ihre alten Parolen gestohlen haben.
Den Gewerkschaften wiederum macht ihr Misstrauen gegen neoliberale Prinzipien eine Unterstützung echt liberaler Initiativen schwer, und sie unterschätzen das Flexibilitäts-und Freiheitsbedürfnis der meisten Menschen. Ihre Schutzfunktion sieht im Neoliberalismus aus wie reine Defensive und wird erst in der Krise attraktiver; politisch offensiv wurde sie nicht.
Keine Angst, wir sind noch bei Sebastian Kurz. Was den Liberalismus der Angst betrifft, genüge die kleine Erinnerung, mit welcher Lust er in der ersten Corona-Phase die damals gewiss notwendige Rolle des scharfen Mahners übernahm und sie im Seitenblick auf die Zustimmung autoritätsgläubiger Klientel übertrieb.
Wir befinden uns in einer großen Auseinandersetzung, in der die prekären Errungenschaften der Demokratie, des Rechts und Sozialstaats, eine Öffentlichkeit mit freier Meinungsäußerung fundamental angegriffen werden, sichtbar von außen durch Autokratien innerhalb und außerhalb der EU, am beeindruckendsten von China und am grausamsten von Russland. Weniger sichtbar ist der Angriff von innen, von rechts, denn diese Auseinandersetzung findet gleichsam hinter einer Nebelwand statt. Die einen vermögen die Wand nicht zu öffnen, die anderen kämpfen darum, sie möglichst dicht zu gestalten.
Nur im Nebel wählen Menschen gegen ihre Interessen. Als Beispiel für diesen Nebel kann die Auseinandersetzung von free speech dienen. Das Problem wurde in der digitalen Welt deswegen groß, weil die digitalen Medien von Anfang an gesetzlich als Plattformen behandelt wurden, das heißt: als Medien in einer rechtsfreien Zone. Die 1996 unter dem fatalen Liberalisierer Bill Clinton beschlossene Section 230 des Communications Decency Act, eines US-Gesetzes gegen Pornografie im Netz, entlastete die digitalen Verbreiter von der Verantwortung für die von ihnen verbreiteten Inhalte. Dies geschah explizit, um den Tech-Konzernen der USA einen globalen Wettbewerbsvorteil gegenüber analogen Medien zu verschaffen. Eine verblendete Linke sah die Gefahren zuerst nicht und betrachtete den Cyberspace als herrschaftsfreien Raum, in dem sie technikgestützt ihre neue kosmopolitische, egalitäre Gesellschaft ausbrüten würde. Die Desillusionierung war beträchtlich, als sich der herrschaftsfreie Raum doch als von Kapitalinteressen dominiert herausstellte und die Silicon-Valley-Ideologie nicht weltweite Befreiung, sondern bloß radikale Kommerzialisierung der globalen Kommunikation im Sinn hatte und sich als der technische Ausdruck dessen herausstellte, was ökonomisch Neoliberalismus, philosophisch Narzissmus heißt, in der zutreffenden Interpretation von Isolde Charim die Fähigkeit, ohne Zwang zu zwingen.
Der Staat hatte die Frage, was in einem Rechtsstaat gesagt werden darf und was nicht, durch seine Regulierung privatisiert. Damit schwächte er sich und überließ die Auseinandersetzung gesellschaftlichen Gruppen, die auf der Linken zur cancel culture tendierten und zur Rechten zu einem missbräuchlichen Free-Speech-Radikalismus. (Es gibt auch ernstgemeinten Free-Speech-Radikalismus, wie ihn etwa der Linguist Noam Chomsky vertritt.)
So kommt es, um zum Nebel zurückzukehren, dass Leute wie Donald Trump oder Elon Musk sich als Helden der Redefreiheit darstellen können, der schönsten der bürgerlichen Freiheiten, obwohl ihnen der Sinn nach nichts anderem steht, als den Rechtsstaat zurückzudrängen, den Garanten dieser Freiheiten. Er soll ihnen ihre Steuerprivilegien und ihre fetten Aufträge garantieren, sich aber nicht mit Gesetzen wichtigmachen, die ihr Business behindern. Selbstbestimmungsrecht für "die Wirtschaft" - eine Art Wirtschaftsdemokratie, in der die (Medien-)kapitalbesitzenden über die anderen bestimmen. Autoritärer Kapitalismus, illiberale Demokratie -wie immer man es nennen mag.
Meinungsfreiheit auf Europäisch und Rechtsstaatlich bedeutet, die Grenzen dieser Redefreiheit frei und mühelos einklagen zu können. Diese Grenze ist das Gesetz; durch die auch von Progressiven verteidigte Nicht-Auffindbarkeit von Sprechenden im Netz, die Anonymität, lässt sich dieses Gesetz nur unter Mühen durchsetzen, die nicht alle auf sich nehmen können. Es ist also nicht mehr allgemein gültig. Proteste gegen diesen Zustand haben dazu geführt, dass das Regime der Selbstkontrolle, für die Presse nach ähnlichen Protesten in den USA der 1940er-Jahre eingeführt, von den Social-Media-Konzernen wenigstens andeutungsweise angewendet wird. Dies bleibt fragwürdig, weil Selbstkontrolle der Willkür der Konzerne überlassen wird.
Es ist Willkür, einem Lügner die Öffentlichkeit zu entziehen, wenn er nichts Gesetzwidriges tut, ebenso wie es Willkür ist, einen Lügner vor dem Zugriff des Gesetzes zu schützen, wenn er anderen Nachteile zufügt. Die Willkür der Tech-Konzerne führt zur Dominanz der politischen Lüge. Oder führte die Lüge zur Willkür?
Die Lüge wurde zum Mittel rechtsextremer Propaganda. Die von Milliardären finanzierten Medien der Alt-Right, wie das vom notorischen Steve Bannon ("Flood the zone with shit") geleitete Portal Breitbart, verunsicherten die Öffentlichkeit mit Desinformation. Dass ihre politischen Gegenspieler diesbezüglich nicht unschuldig sind, versteht sich; aber die Wucht der Lügen der Rechten, angeführt von Donald Trump, den Medien des Tycoons Rupert Murdoch und der digitalen Alt-Right-Publizistik, war nicht nur überwältigend, sondern systematisch. Das Auffälligste und Neue an Trump war, dass er im Unterschied zur Konkurrenz und seinen Vorgängern unbekümmert log. Von seiner größten Lüge, die Wahl sei ihm gestohlen worden, rückt er nach wie vor nicht ab.
Dieses unverschämte Lügenprinzip in Österreich heimisch zu machen, das war die größte Tat des Sebastian Kurz. Es begann mit der Fabrikation seiner Unwiderstehlichkeit mit gefälschten Umfragen und setzte sich fort bis zur frommen Lüge, er sei abgetreten, weil er sich seiner Familie widmen wolle. Durchgehend zeigte er die geforderte Monstermentalität. Diese Mentalität stellt die Erlangung und den Erhalt der Macht über die Geltung allgemeiner Regeln.
Demokratie beruht auf der Annahme, dass Dinge im öffentlichen Diskurs so erörtert werden, dass alle eine Chance haben, sich unvoreingenommen ihre Meinung zu bilden. Eine Fiktion, gewiss, doch ist die Demokratie insgesamt eine Fiktion, die auf solchen Annahmen beruht. Ein gewisses Maß an Selbstkontrolle, Selbstbegrenzung, ja Anstand ist notwendig, sollen die demokratische Arena und ihre Institutionen funktionieren. Werden die Spielregeln missachtet, führt das zum Diktat der Stärkeren.
Man mag die österreichische Version des "disrupter", des "puer robustus", des starken Mannes nicht als die erkannt haben, die sie war, weil sie in Mariazell im Trachtenjanker posierte, sich mit akkurat beachteter Tiefenschärfe und Farbgebung im Altersheim oder im traulichen Alpinistengewand beim Durchstreifen des Gebirgs fotografieren ließ. Aber sie funktionierte nach dem Prinzip, unsere Werte stehen höher als die der anderen. Wir erringen die Hegemonie nicht mit besseren Argumenten, sondern mit Gewalt, mit dem Brechen von Regeln, mit Lügen, mit Schwindel.
Das sind etwas härtere Worte für das, was euphorisch mit Message-Control beschrieben wird. Diese kämpfte nicht nur an der Front der Botschaften, sie zerstörte auch die Medienlandschaft nachhaltig. Nämlich dadurch, dass sie den korruptesten Boulevard ausgiebig finanzierte; dadurch, dass sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu ruinieren versuchte (nur Ibiza hatte dabei einen verzögernden Effekt); dadurch, dass sie das Privatfernsehen reich alimentierte (zufällig ist Antonella Mei-Pochtler Aufsichtsrätin bei der ProSiebenSat.1-Gruppe); dadurch, dass sie Feindmedien austrocknete.
Die Gleichschaltung der Medien war das Ziel des Kurz-Regimes, erklärte sein Parteigenosse und Vorgänger Reinhold Mitterlehner im Untersuchungsausschuss. Mit dem Mann, der in einem Chat mit dem ORF-Feind Heinz-Christian Strache von lauter "roten Zecken" im ORF redete, dem Investor Alexander Schütz, ist Kurz nun geschäftlich verpartnert. Wie ein Satyrspiel muten die gegenseitigen Bezichtigungen von Sebastian Kurz und Thomas Schmid an, die sich in einem von Kurz aufgezeichneten und zum Zweck seiner Entlastung von den Inseratenkorruptionsvorwürfen geführten Telefonat mit Schmid zu einem Vortext gegenseitigen Schwindelns aufbauten, denn Schmid hatte die Absicht des Anrufers erfasst, sodass das Publikum, dem dieser denkwürdige Lügnerdialog sogleich übermittelt wurde, vor der alten Frage stand, ob es dem Kreter glauben soll, der behauptet, dass alle Kreter lügen. Was man bekanntlich damit beantwortet, dass man sich auf die Metaebene zurückzieht und die beiden Kreter von außen betrachtet. Aus dieser Perspektive versteht man, dass Lügen einerseits dazu dient, das bestehende System zu kippen, und andererseits nur eine Form ist, die Aufmerksamkeit zu steigern.
Beides trifft idealtypisch bei dem neuen Twitter-Besitzer Elon Musk zusammen. Er strebt mit der Wiederzulassung des von der Selbstkontrolle ausgeschlossenen Trump und seinem ostentativ disruptiven Gebaren drei Dinge an: erstens als kommunikative Kraft zu mächtig zu werden, um reguliert werden zu können; zweitens den bisher, bei aller systemisch angelegten Toxizität, doch auch diskursiv orientierten Mikrobloggingdienst Twitter zu einer kompletten Cloud-App zu machen, digitale Kontrolle, Datenanhäufung und Steuerung des Publikums zwecks Erhöhung von Profit und Macht inklusive; und drittens das Ziel aller Nebel-und Lügenpolitik, bei allem gegenteiligen Gerede über unternehmerische Tugenden und Risikofreude vom Staat massive Aufträge und Subventionen zu lukrieren und gleichzeitig Vermögenssteuern zu vermeiden oder zu minimieren. Das Business heißt Überwachungskapitalismus oder Cloud-Kapitalismus. Das klingt etwas wolkig-unverbindlich, aber man kann schön beschreiben, was Kurz mit ihm verbindet.
Es wurde oft bemerkt, dass der Cloud-Kapitalismus einige Wunder vollbringt. Zum einen veranlasst er uns dazu, kostenlos zu arbeiten, zum anderen, dass er in uns Begierden nach Dingen erweckt, die wir drittens dort, in der Cloud, gleich haben und kaufen und auch bezahlen wollen, wofür wir nicht nur mit Geld, sondern auch mit unseren Daten bezahlen. Das vierte Wunder aber besteht darin, all das nicht zu sehen und die Vorgänge auf der individualpsychologischen Ebene zu belassen. So ist das Interessante an der politischen Persona Kurz weniger die Tatsache, dass sein Erfolg auch auf gekonntem digitalem Marketing beruhte; viel interessanter sind die Wurzeln seines radikal disruptiven Handelns.
Er rückte es nie in den Vordergrund, und auch seine Kritiker brachten selten die Fäden zusammen. Manche wurden erst nach dem Ende seiner politischen Laufbahn sichtbar. Aber die Kontakte zum neoliberalen und cloudorientierten Kapital entstanden von Anfang an durch seine Chefberaterin Mei-Pochtler. Sie war nicht nur im weltweiten Executive Committee der Boston Consulting Group, sie leitete auch die Stabstelle für Strategie, Analyse und Planung im Kanzleramt, verantwortlich für Österreichs "Digitalisierungsstrategie" (im Beirat neben anderen: Wirecard-Chef Markus Braun), sie verhandelte in der ersten Koalition "Wirtschaft und Entbürokratisierung", und sie vermittelte gemeinsam mit ihrem Mann, dem Industriellen Christian Pochtler (seit 2020 ebenfalls Aufsichtsrat in einem ÖBAG-Unternehmen), für Kurz Kontakte zu mächtigen Männern der Cloud-Industrie wie dem ehemaligen Google-Chef Eric Schmidt, auf deren Einladung Kurz in den USA Veranstaltungen und Seminare besuchte.
Dass Kurz sofort nach Ende seiner Tätigkeit im Kanzleramt einen Job bei Peter Thiel erhielt, darf man wohl ebenfalls mit solchen Kontakten erklären. Thiel war der erste offen mit dem rechten Flügel der Republikaner sympathisierende Silicon-Valley-Tycoon, er beriet auch Donald Trump und präsentiert sich als Intellektueller der Neuen Rechten. Er ist nicht nur vom französischen Kulturkritiker René Girard und dessen Mimesis-Theorie beeinflusst, er ist vielmehr ein bekennender Straussianer. Auf den Philosophen Leo Strauss (1899-1973) berufen sich Generationen der denkenden US-amerikanischen Rechten, Neocons und Kriegstreiber. Rechtsplatoniker und in der Nachfolge von Carl Schmitt stehend, vertritt Strauss eine radikal antiaufklärerische Haltung. Einer von Thiels berühmtesten und am seltensten gelesenen Essays trägt den Titel "The Straussian Moment". Auch wenn Thiel darin, unmittelbar nach 9/11, gegen die Anwendung von Gewalt plädiert, nennt er das Ziel der postmodernen Welt unmissverständlich: "The peace of the kingdom of God." Der Weg dorthin ist klar: "Es kann kein wirkliches Übereinkommen mit der Aufklärung geben, denn zu viele ihrer Binsenweisheiten haben sich in unserer Zeit als tödliche Lügen erwiesen."
Neben seiner Tätigkeit bei Thiel Capital agiert Kurz auch als Investor. Eine seiner ersten Aktivitäten war die Gründung einer Firma namens "Dream Security" gemeinsam mit dem ehemaligen Leiter der israelischen Firma NSO, berüchtigt für die Spionagesoftware Pegasus. Geschäftszweck des Kurz-Unternehmens ist "Cyber-Security". Das passt recht gut zu den Aktivitäten Thiels, dessen Big-Data-Firma Palantir Technologies nicht nur für Hedge-Fonds und Banken arbeitet, sondern vor allem für das US-Verteidigungsministerium.
Bei einem Teil der US-amerikanischen Rechten ist das Verhältnis zu den Evangelikalen anders als bei Donald Trump nicht nur instrumentelles Zweckbündnis. Fundamentalismus und Neoliberalismus gehen sehr gut zusammen, und Peter Thiel ist dafür ein prominentes Beispiel. Auf fundamentalere Art wird hier die platte ökonomische Maxime des Friedrich August von Hayek überhöht, die Wolfgang Schüssel, Kurz' Vorläufer und Berater im Hintergrund, mit dem Slogan "Mehr privat, weniger Staat" unübertroffen trivialisiert hatte.
Im österreichischen Sandkistenformat erstaunt es nun weniger, dass ein Fundamentalismus-Sympathisant wie Bernhard Bonelli, ausgebildet im Reich Mei-Pochtlers bei Boston Consulting, das Kabinett von Kurz leitete. Es nimmt nun weniger wunder, dass Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka Gebetsstunden im Parlament abhalten lässt. Und das evangelikale Weihespiel von Sebastian Kurz in der Stadthalle bekommt einen Sinn.
Das antiaufklärerische Revirement fundamentalistischer Religion ist in Österreich mit dem Rücktritt verschiedener von Papst Johannes Paul II. ernannter Kardinäle und Bischöfe einer moderneren Kirche gewichen. Aber in Europa kamen zur gleichen Zeit Regimes mit reaktionär-klerikalen Anliegen auf: Polen und Ungarn machten die "illiberale Demokratie" zum Schlagwort. Vor allem die Freundschaft von Kurz zum Orbán-Regime war von Anfang an nicht zu übersehen.
Die Persona Kurz ist eine Nebelfigur erster Klasse, ein höflicher Rüpel, versiert in der Kunst, alles perfekt auszusprechen und dahinter ganz anderes zu verbergen. Niemals die Contenance zu verlieren und auf scheinbar unerschütterlich nette Weise die Gegner gnadenlos mit allen Mitteln niederzumachen. Er war nicht nur ein Fabrikant schönen Scheins. Er hat ein Land beschissen, seine eigene Partei beschissen, die Medien, die er mit Staatsknete zuschiss, die Kirche, die ihm paraevangelikal huldigte, das Parlament, das er diskreditierte, die Justiz, die er instrumentalisierte, die Staatsanwaltschaft, die er attackierte -sie alle sehen den Saubermann nun als einen dastehen, der anpatzte: sich selbst und ein ganzes Land mit ihm