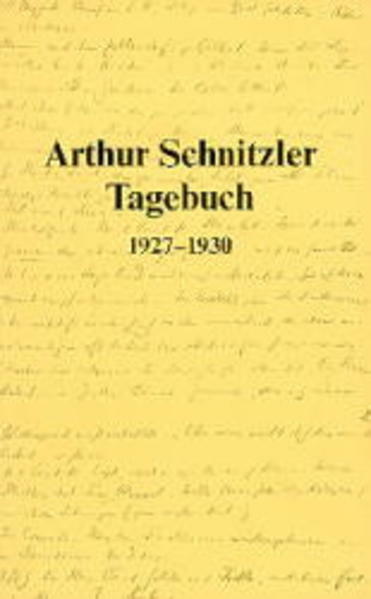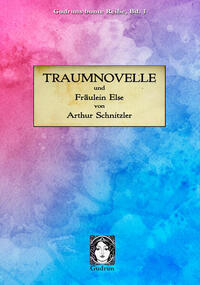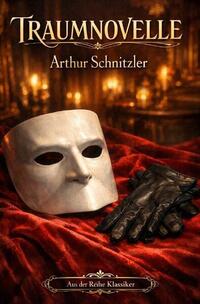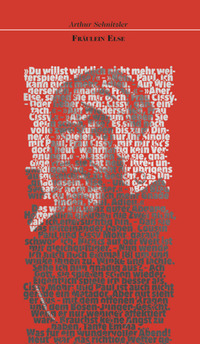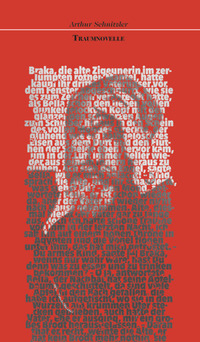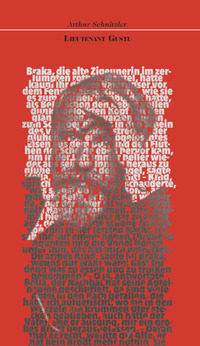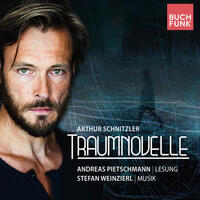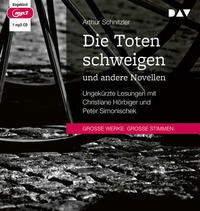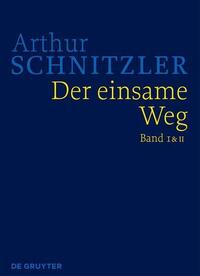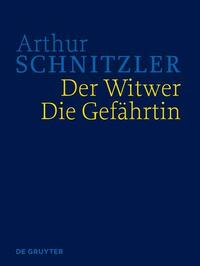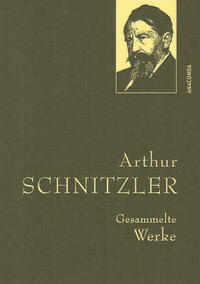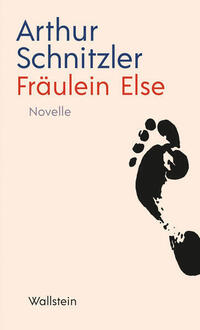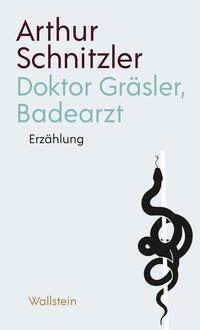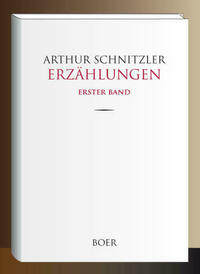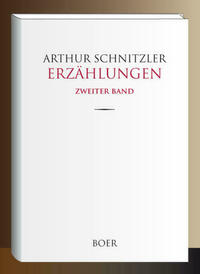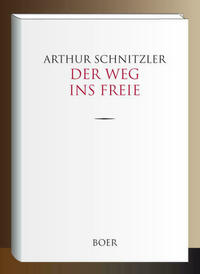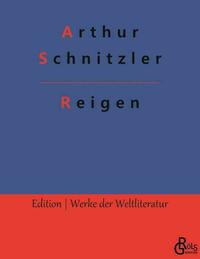„Da schießt’s eini!“
Klaus Nüchtern in FALTER 27/2017 vom 05.07.2017 (S. 32)
Vor 90 Jahren brannte der Justizpalast. Die blutige Niederschlagung der Juli-Revolte war ein traumatisches Ereignis, das nicht nur in der Politik, sondern auch im Geistesleben des Landes tiefe Spuren hinterlassen hat
Es war eines von jenen nicht zu häufigen öffentlichen Ereignissen, die eine ganze Stadt so sehr ergreifen, dass sie danach nicht mehr dieselbe ist“, erinnert sich Elias Canetti an den 15. Juli des Jahres 1927. „Es sind 53 Jahre her und die Erregung dieses Tages liegt mir heute noch in den Knochen“, bekennt er 1980 in „Die Fackel im Ohr“, dem zweiten Band seiner Autobiografie. Wie viele ist Canetti, der damals kurz vor seinem 22. Geburtstag steht, empört über den Ausgang des Schattendorf-Prozesses (siehe Kasten): „Das Gericht hatte die Mörder freigesprochen. Dieser Freispruch wurde im Organ der Regierungspartei als ,gerechtes Urteil‘ bezeichnet, nein ausposaunt. (Tatsächlich lautete die Überschrift in der Reichspost „Ein klares Urteil“, Anm.). Es war dieser Hohn auf jedes Gefühl von Gerechtigkeit noch mehr als der Freispruch selbst, was eine ungeheure Erregung in der Wiener Arbeiterschaft auslöste. Es war eine völlig spontane Reaktion, wie sehr, spürte ich an mir selbst. Auf meinem Fahrrad fuhr ich schleunigst in die Stadt hinein und schloß mich einem dieser Züge an.“
Wie Canetti in Ober-St.-Veit von den Demonstrationen in der Innenstadt gehört hat, wissen wir nicht. Vielleicht hat er den Stromausfall bemerkt und dessen Ursachen in Erfahrung gebracht – sehr im Unterschied zur Quapp, einer der Protagonistinnen aus Heimito von Doderers Roman „Die Dämonen“ (1956), die vom Autor mit geringer Körpergröße, aber einer bemerkenswert langen Leitung ausgestattet wurde. Noch in Hörweite von Canettis Domizil – „sogar das Glöckchen von Ober-St.-Veit vermochte sie zu hören“ – verlässt sie „achtzehn Minuten nach zwölf“ ihre Hietzinger Wohnung, wartet vergeblich auf die Straßenbahn und begibt sich per Taxi in Richtung Oper. Dieses wird auf der Mariahilfer Straße von jungen Angehörigen des Schutzbundes höflichst für Verwundetentransporte requiriert, worauf praktischerweise auch schon der ungarische Diplomat heranbraust, mit dem die Quapp verabredet ist. Als der Chauffeur launig anmerkt, auf Einschusslöcher im Wagen verzichten zu können, und Quapp dann doch glatt wissen will, ob leicht geschossen würde, erteilt Legationsrat Géza von Orkay seinem Chauffeur die Order, stehen zu bleiben: „Das gnädige Fräulein will schießen hören.“
Die folgende Spritzfahrt führt das Ehepaar-to-be an einen beliebten Aussichtspunkt für Ausflügler, von wo aus die beiden den Brand des Justizpalastes als quasi artifiziellen Zusatzeffekt zum Sonnenuntergang wahrnehmen: „Von der Terrasse der Meierei beim Schlosse Cobenzl konnte man das Feuer in der Stadt wie auf einer flachen Hand sehen. Es (…) war durch den gewaltigen Sonnenglast klein gemacht, zusammengedrückt und auf sich selbst beschränkt wie eine Glühbirne, die am hellichten Tage brennt. ,Schaut aus, also ob die Stadt ein rotes Wimmerl hätt’‘, sagte Géza.“
Man kann die Szene wahlweise als zynische Darstellung oder Darstellung von Zynismus lesen. Es ist jedenfalls eine Tatsache, dass nicht alle Literaten so nachhaltig erschüttert reagierten wie Elias Canetti. Arthur Schnitzler notiert in seinem Tagebucheintrag vom 15. Juli: „Gegen 11 tel. C.P. vom Cobenzl: Unruhen,– wegen des gestrigen Freispruchs im Schattendorfer Prozess (…) – Besetzung des Justizpalastes, angelegtes Feuer, Schießereien, Anzünden der (antisem). ,Reichspost‘; die Tram steht still.– Ich arbeite indess ungestört weiter.“
Das liest sich so, als wäre Schnitzler von seiner Geliebten Clara Pollaczek, die sich hinter dem Kürzel verbirgt, über die Vorgänge informiert worden. Um elf Uhr konnte diese vom Cobenzl aus aber nichts gesehen haben, da der erste Brand (im Wachzimmer in der Lichtenfelsgasse) erst gegen 11.30 Uhr gelegt wurde. Schnitzler wird weiterhin telefonisch auf dem Laufenden gehalten, geht nach dem Zusammenbruch des Netzes ein wenig ins Freie und findet „(a)uch atmosph. Gewitterstimmung“, sich selbst aber „nicht nach Gebühr erschüttert“.
Auch Doderer selbst scheint von den Juli-Ereignissen, auf die sein Opus magnum zusteuert, ursprünglich nicht übermäßig aufgewühlt worden zu sein: „Fuit rumor magnus hodie in urbe“ („heute großer Wirbel in der Stadt“), notiert er am Freitag, den 15. Juli in sein Journal. In einem anderen Heft ist zum selben Tag trocken vermerkt: „Bibliotheksdienst heute unmöglich.“ Am Sonntag geht Doderer „über den Beethovengang von Nussdorf nach Grinzing“ und bemerkt, dass die Straßenbahnen wieder fahren, am Montag besichtigt er gemeinsam mit Freunden den „Kriegsschauplatz“.
Am unmittelbarsten und buchstäblich plakativsten reagiert Karl Kraus, der drei Tage lang Sujets mit folgendem Text affichieren lässt: „An den Polizeipräsidenten von Wien / Johann Schober / Ich fordere Sie auf, / abzutreten. / Karl Kraus / Herausgeber der Fackel“ – eine nicht ganz uneitle Geste, die Canetti dazu bewegt, einen glühenden Dankesbrief „an den einzigen Richter Wiens“ zu schreiben und diesem „von ganzem Herzen, ganzem Leib und ganzer Seele“ zu danken.
Die Juli-Unruhen haben in Canettis Werk unübersehbare Spuren hinterlassen. Schon seinen 1931 vollendeten und 1935 erschienenen Romanerstling „Die Blendung“, in dem sich der dem Irrsinn anheimgefallene bibliomanische Sinologe Peter Kien zu schlimmer Letzt samt seiner Bibliothek selbst abfackelt, hat der Autor als „Frucht des Feuers“ bezeichnet. Vor allem aber hat „die Substanz des 15. Juli“ Eingang gefunden in dessen theoretisches Hauptwerk „Masse und Macht“ (1960).
Zentraler Gedanke dieser voluminösen Studie ist die Annahme einer der grundlegenden „Berührungsfurcht“, welche einzig durch die und in der Masse besänftigt werden kann: „Sobald man sich der Masse einmal überlassen hat, fürchtet man ihre Berührung nicht. In ihrem idealen Falle sind sich alle gleich. Keine Verschiedenheit zählt, nicht einmal die der Geschlechter. (…) Es geht dann alles plötzlich wie innerhalb eines Körpers vor sich.“
Canetti beschreibt die Masse nicht als dämonische und destruktive Kraft, die es politisch oder kulturell einzuhegen gilt, sondern als eine Art Metasubjekt mit eigenem Willen, das denjenigen, die mit ihr verschmelzen, Geborgenheit bietet. Seine Konzeption einer führerlosen Masse richtet sich explizit gegen Sigmund Freuds Studie „Massenpsychologie und Ich-Analyse“ (1921), in der dieser die Masse von der Urhorde und deren Führer vom gefürchteten Urvater ableitet.
Der Germanist Gerald Stieg, der ein intimer Kenner der Juli-Literatur ist, vertritt die Auffassung, dass sich Freuds ängstliche Haltung gegenüber der Masse von jener des christlichsozialen Bundeskanzlers Ignaz Seipel, aber auch der sozialdemokratischen Führung nicht grundlegend unterscheide. In der Nationalratssitzung vom 26. Juli hat sich Seipel den Beinamen „Prälat ohne Milde“ erworben, indem er die blutige Niederschlagung der Proteste rechtfertigte. Sein Widerpart Otto Bauer tritt dem kühl kalkulierenden Ordnungspolitiker als Moralist und Anwalt der Humanität entgegen.
Aber auch Bauer zeigt sich skeptisch gegenüber der letztlich unberechenbaren Masse: Im Wissen darum, dass selbst eine „geordnete Demonstration ungeheure Gefahren gehabt hätte“, habe sich die Partei dazu entschlossen, einen entsprechenden Aufruf zu unterlassen, sei im Versuch, „unsere Genossen in den Betrieben zu beruhigen“ allerdings gescheitert. Der wirkliche Fehler des 15. Juli habe, so Bauer, in der Unmöglichkeit bestanden, rechtzeitig eine hinreichend starke Menge an Schutzbündlern zu mobilisieren: „Hätten wir sie dagehabt, wir hätten mit diesen paar Hundert oder äußerstenfalls wenigen Tausend Leuten, die die Feuerlöschaktion beim Justizpalast und in der Lichtenfelsgasse verhinderten, glatt fertig werden können, und es wäre zu diesem entsetzlichen Eingreifen der Polizei gar nicht gekommen.“
In einer emblematischen Szene des 15. Juli versucht der Wiener Bürgermeister Karl Seitz, der sich auf einen Wagen der Feuerwehr gestellt hat, vergeblich, die empörte Menge dazu zu bewegen, die Löschfahrzeuge passieren zu lassen. Davor hatten einige Randalierer die Anstrengungen der Feuerwehr sabotiert, indem sie Schläuche zerschnitten hatten.
„Die Masse, die vor dem Feuer früher davonjagte“, so heißt es in „Masse und Macht“, „fühlt sich jetzt auf das stärkste von ihm angezogen.“ Für Canetti ist das Feuer nicht nur eines der stärksten Massensymbole, sondern überhaupt wesensmäßig der Masse verwandt: „Fasst man diese einzelnen Züge des Feuers zusammen, so ergibt sich ein überraschendes Bild: Es ist sich überall gleich; es greift rapid um sich; es ist ansteckend und unersättlich; es kann überall entstehen, sehr plötzlich; es ist vielfach; es ist zerstörend; es hat einen Feind; es erlischt: Es wirkt, als ob es lebte, und wird so behandelt. Alle diese Eigenschaften sind die der Masse, eine genauere Zusammenfassung ihrer Attribute ließe sich schwer geben.“
Bei aller Komplizenschaft zwischen den beiden unbeherrschbaren Elementen stellt sich allerdings die Frage, wie eine Masse Brandstiftung begeht. Ernst Fischer, der als Redakteur der AZ von den Unruhen berichtet hat, serviert die Juli-Unruhen in seinen Memoiren als schwülstige action- und pathosgeladene Suspense-Story, deren wahrer Held das revolutionäre Subjekt der Masse ist:
„(P)lötzlich fiel uns auf, dass es keine Fahnen gab, die roten Fahnen, die flammenden, die sonst den Demonstrationen der Arbeiter von Wien voranflogen (…). Wo ist der Schutzbund? Die Gruppenführer haben keine Weisung erhalten (…), es fehlt die organisierte Gegenmacht, aber auch die Polizei weiß nicht recht, was sie soll (…), aber die Masse, die wachsende, duckt sich, indem sie weicht, zum Sprung, und sucht ein Ziel, nicht nur an einzelnen Uniformierten, sondern an der Staatsgewalt selbst ihre Wut zu entladen. (…) Jetzt hat die Demonstration ein Ziel: Justizpalast! Die Masse verhilft sich selbst zur Geburt, durch mächtige Symbole. Das dort, knapp vor uns, das protzige Gebäude, war zum Symbol geworden: Justizpalast, Klassenjustiz, Mordjustiz, Bollwerk des Arbeitermords. Und nach dem zweiten Symbol lechzt die Masse: die Flamme, die Fahne, so flieg, du flammende …!“
Fischers „Erinnerungen“ an den 15. Juli lesen sich, als hätte dessen Freund Elias Canetti das Endredigat übernommen: Die zentralen Axiome von „Masse und Macht“ werden exemplarisch bestätigt, selbst der Begriff der „führerlosen Masse“ findet Erwähnung – in einer wohl fantasierten Szene, in der „der Mathematiker der Macht“, Ignaz Seipel, am 15. Juli im Auto die Stadt durchquert: „hinter dem Vorhang der scharfe Schatten, das Cäsarenprofil“.
Dafür taucht jener Mann, der der heranstürmenden Polizei in provokanter Verzweiflung die eigene Brust als Ziel anbietet, auch in „Die Fackel im Ohr“ wieder auf. Während er bei Fischer – „,Schießt, wenn ihr Courage habt!‘, und sie hatten Courage“ – tatsächlich erschossen wird, bleibt sein Schicksal bei Canetti – „Da schießt’s eini! Da! Da!“ – rätselhaft: „Plötzlich war er weg. Umgefallen war er nicht. Wo war er?“
Vor der entscheidenden Tat schreckt aber offenbar auch Fischers revolutionär entflammte Masse zurück. Sie bedarf vielleicht keines Führers, zumindest aber eines Handlangers: „Wir alle wünschen, dass es geschehe, doch alle warten auf den Vollstrecker, auf das Feuer in seiner Hand, auf die Tat. (…) Die aus der Masse Auftauchenden, auf ihre Schultern Gehobenen, von ihren Händen Gehaltenen, ein Fenster Zertrümmernden, in das Gebäude Eindringenden sind keine qualifizierten Arbeiter, keine jungen Revolutionäre, sondern makabre Gestalten.“
Fischers Erinnerungen decken sich in diesem Punkt ausgerechnet mit der gerne als reaktionär gescholtenen Darstellung der Juli-Unruhen in den „Dämonen“. Doderer war bereits am 1. April 1933 der NSDAP beigetreten und hatte sich im September 1936 in einem Schreiben an die Reichsschrifttumskammer den Volksgenossen aus dem Altreich mit seinem um die Jahreswende 1930/31 begonnenen Roman „Die Dämonen der Ostmark“ angedient: „Ich glaube, es ist das erste Mal, dass die jüdische Welt im Osten deutschen Lebensraumes von einem rein deutschen Autor in den Versuchsbereich der Gestaltung gezogen wurde“, distanziert sich der ambitionierte Romancier explizit von seinen jüdischen Kollegen Arthur Schnitzler und Jakob Wassermann und macht sich anheischig, „dieses Theatrum Judaicum (…) auf der Ebene des familiären und erotischen Lebens, auf der Ebene der Presse und der Oeffentlichkeit, und endlich auf der Ebene der Wirtschaft in der Welt der grossen Banken (vorzuführen)“.
Als Doderers „Dämonen“, an denen er mit Unterbrechungen über ein Vierteljahrhundert gearbeitet hat, 1956 endlich erscheinen, sind alle antisemitischen Spuren getilgt, und der Roman fügt sich prächtig in das auf Versöhnung und Verdrängung bedachte politische Klima der jungen Zweiten Republik. Der 15. Juli aber, für den Doderer der Reichsschrifttumskammer gegenüber noch „jene marxistischen Gärungen“ verantwortlich gemacht hatte, ist nun zum „Cannae der österreichischen Freiheit“ geworden.
Schon die Konstruktion des Romans kann als strukturelle Meisterleistung des Beschweigens verstanden werden. Das Ende des Zweiten Weltkriegs ist zwar Bestandteil der erzählten Zeit, nichtsdestotrotz bleibt alles, was sich nach 1927 in Österreich zugetragen hat, ausgeblendet. Noch gewiefter indes ist die revisionistische Volte, mit der Doderer den verfeindeten Fronten Versöhnung in der Fiktion gewährt.
Waren die Wiener Arbeiterschaft und die vielfach aus dem ruralen, christlich-konservativ geprägten Umland Wiens stammenden Polizisten, die eben aus diesen Gründen verächtlich als „Mistelbacher“ tituliert wurden, durch eine tiefe soziale und kulturelle Kluft getrennt, so holt Doderer die Feinde von einst ins gleiche Boot, indem er ihnen einen gemeinsamen Gegner verschafft – den „Ruass“.
Der „Ruass“ ist einem Kommentar des Erzählers zufolge „ein trefflicher Wiener Volksausdruck für das Unterste vom Untersten, das Letzte vom Letzten“ und bezeichnet hier genau jene „makabren Gestalten“, die auch Ernst Fischer bei der Brandstiftung im Justizpalast beobachtet hat. Prominentester Vertreter des „Ruass“ in den „Dämonen“ ist der Mörder Meisgeier. Am 15. Juli begibt er sich bei der Friedensbrücke ins Wiener Kanalnetz und dringt bis zum Schmerlingplatz vor, um dort durchs Kanalgitter mit einer Drahtschlinge Polizisten zu Fall zu bringen, ehe er von einem Wachmann erschossen wird. Die weiteren Neben- und Statistenrollen sind mit Prostituierten, Taschendieben, Falschspielern et al. besetzt und die eigentlichen Verursacher der Unruhen.
Doderers Vorzeigeproletarier Leonhard Kakabsa gehört am 15. Juli bezeichnenderweise nicht der Masse an, ganz im Gegenteil: Er hilft dabei, gerade noch rechtzeitig das Tor der Universität vor den heranstürmenden Demonstranten zu schließen. Aus der Arbeiterklasse hat er sich durch das Studium einer lateinischen Schulgrammatik gleichsam am eigenen Schopf herausgezogen – bei Doderer läuft so was unter dem Begriff der „Menschwerdung“. Kakabsa wechselt von der proletarischen Brigittenau in den bürgerlichen Alsergrund zu seiner Braut, der bürgerlichen Mary K., so wie er auch vom Hackler in der Gurtenfabrik Rolletschek zum Leiter einer prinzlichen Bibliothek avanciert.
Für einen Moment wird Kakabsa beim Rathaus vom Mob mitgerissen, als er zufällig auf zwei Ex-Kollegen trifft, worauf sich ein Inspektor mit einer Frage an die drei Freunde wendet, die am 15. Juli 1927 garantiert kein Polizist gestellt hat: „Sind die Herren Arbeiter?“ Nachdem dies bestätigt wird und somit die Voraussetzung für herrschaftsfreien Diskurs hergestellt ist, kann die Ursachenforschung der finalen Klärung zugeführt – „(I)ch hab’ kan Arbeiter mehr g’sehn. Der Ruass war los, der ganze Ruass aus’m Prater“ – und jenes thanatophile Schlusstableau eröffnet werden, das Gerald Stieg treffend als „exemplarische Veroperung der Wirklichkeit“ bezeichnet hat.
Die buchstäblich schöne Leich’ eines jungen, bei den Unruhen zu Tode gekommenen Polizisten namens Karl Zeitler (ein Freund Kakabsas) wird vom Inspektor einigen Schutzbündlern überantwortet: „So wurde Zeitler von jenen getragen, die ein Samariter-Korps und eine Leichenbrüderschaft geworden waren aus einer militanten Parteitruppe. Als schlüge jemand einen roten Mantel auseinander, innen atlasgefüttert mit jetzt aufglänzendem Weiß. So jene, anima humana, natura autem christiana, so wenig sie dessen Wort haben wollten.“
„Die Dämonen“ verfügen nicht nur die Zwangschristianisierung des Schutzbundes, sie bringen diesen und die Arbeiterschaft auch noch auf die Seite der Polizei, denn alle drei sind letztlich Agenten der Ordnung, denen die Kräfte des Chaos, eben „der ganze Ruass“, entgegenstehen. Das ideologische Manöver ist dreist und doch wiederum so elegant, dass es auch dem ehemaligen Schutzbund-Kommandanten Julius Deutsch entging, der im Dezember 1958 Doderer in einem Brief versichert: „Ich kenne keine literarische Würdigung dieses Unglückstages, die gerechter wäre als die Ihre.“
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: