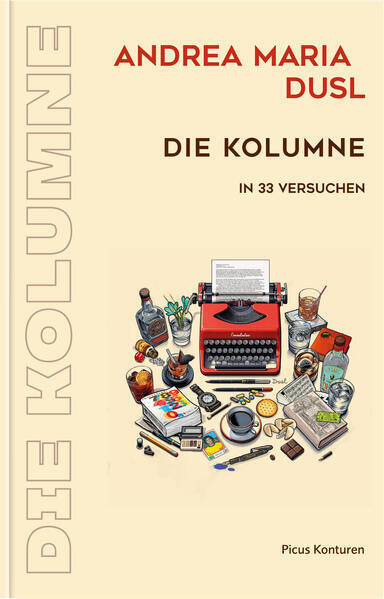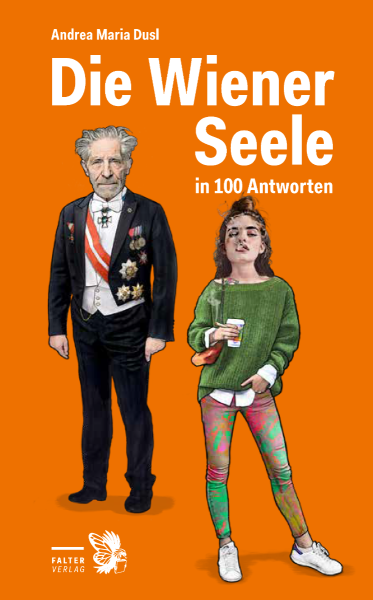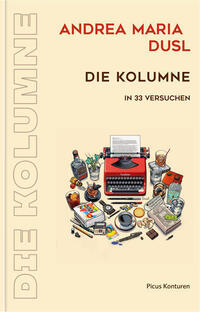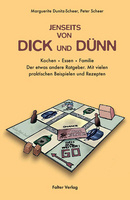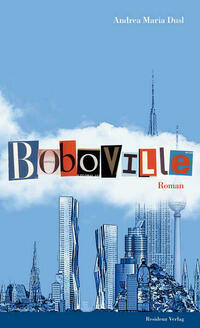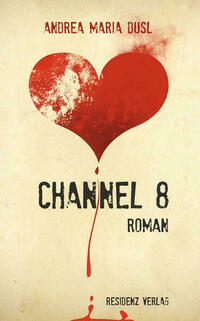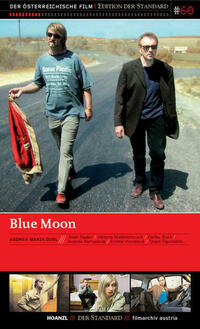"Wien darf nicht Österreich werden"
Lale Ohlrogge in FALTER 37/2025 vom 10.09.2025 (S. 40)
Welchen Ursprung hat die Bezeichnung "Patzenlippel"? Wieso sagt man eigentlich, "der hod a Bankl grissen", wenn jemand stirbt? Seit über 30 Jahren schreibt Andrea Maria Dusl für den Falter eine Kolumne, seit 24 Jahren heißt diese "Fragen Sie Frau Andrea". Darin klärt Dusl über die Bedeutung und den Ursprung von Wiener Redewendungen auf. Doch Dusl, 64, ist viel mehr als nur eine Kolumnistin: Sie ist Künstlerin, Filmemacherin, Schriftstellerin, Kulturwissenschaftlerin -und ein absolutes Wiener Original.
Nun hat Dusl gleich zwei neue Bücher veröffentlicht. In einem hat sie Essays über das Kolumnen-Schreiben zusammengetragen, und das zweite Buch trägt den Titel "Die Wiener Seele in 100 Antworten". Aber was ist die Wiener Seele überhaupt? Stadtleben-Redakteurin Lale Ohlrogge hat das nach zehn Jahren in Wien immer noch nicht verstanden -und sich deshalb mit Dusl zu einem Interview getroffen.
Falter: Was ist an deiner Seele besonders wienerisch?
Dusl: Ich glaube, es ist eine besondere Art von Grant. Also eine Fröhlichkeit, die sich darin erschöpft, nicht fröhlich sein zu müssen. Eine Form von wahrhaftiger Ehrlichkeit: nicht zu lächeln, weil es nichts zu lächeln gibt.
Also authentisch sein dürfen -meinst du das?
Dusl: Na ja, manche sind authentisch, wenn sie dauernd grinsen. Im Englischen gibt es den Ausdruck resting bitch face, also ein schlecht gelaunter Gesichtsausdruck. Ich habe das -deswegen habe ich auch quasi ein Fernsehverbot vom ORF. Ich werde nur ins Radio eingeladen. Aber zurück zum Wienerischen: Ich glaube, an mir ist auch besonders wienerisch, dass ich nicht ganz wienerisch bin.
Wie meinst du das?
Dusl: Eigentlich bin ich ja Ausländerin. Meine Mutter war Schwedin, mein Vater kam aus Graz, und wir hatten nichtösterreichische Verwandte aus ganz Europa. Wienerisch ist nicht an die Geburt in Wien gebunden. Die ersten zehn Minuten, die du am Westbahnhof ankommst, verwienern dich.
Ist Wienerisch-Sein eine Entscheidungssache?
Dusl: Nein, es ist Schicksal. Es ist eine Sache, die dir zustößt, ohne dass du es beabsichtigst. Ich bin Wienerin. Ich bin Europäerin, aber keine Österreicherin. Früher gab es einmal ein kleines Wiener Kaffeehaus, das Salzgries. Heute heißt es Le Salzgries. Zu Beginn der Haider-Ära stand unten bei den Toiletten ein Spruch, der alles über Stadt und Land sagt: Wien darf nicht Österreich werden.
Was ist denn an Österreich so schlecht?
Dusl: Österreich ist zu klein. Zu Zeiten der Donaumonarchie war es groß und wirkmächtig. Es war ein Melting-Pot, wie eine kleine EU - politisch nicht okay, es war größtenteils eine Militärdiktatur, aber es war ein großes Land mit vielen Einflüssen. Und die sind alle hier in der Metropole Wien zusammengekommen. Aber das umliegende Österreich, die Kronländer damals, konnten das nicht leisten. Sie waren immer Provinz - das ist auch gut, aber eben nicht Metropole.
Wien und das Wienerische sind ja immer noch geprägt von all diesen internationalen Einflüssen von einst. Aber in deinem Buch gibt es auch Beispiele, die zeigen, wie das Wienerische immer wieder auch den politischen Zeiten unterlag. Ich habe mich schon häufiger gewundert, warum sich manche Leute mit dem Wort "Mahlzeit" begrüßen. Ich fand das immer befremdlich - bis ich in deinem Buch gelernt habe, was für einen heldenhaften Ursprung das hat.
Dusl: Diese Begrüßung wird vor allem in Ämtern und großen Büros gepflegt. Das kommt aus der Zeit, als sich die Österreicher dem Nationalsozialismus angeschlossen haben. Sozialdemokraten begrüßten sich damals mit einem "Freundschaft" oder "Guten Tag". Die Katholiken sagten "Grüß Gott". Doch die Nazis wollten, dass man sich mit "Heil Hitler" begrüßt. Die Behörden waren damals noch stark monarchistisch geprägt, man wollte sich dem nicht beugen und benutzte stattdessen eine Formel, die im Sinne der Nazis nicht strafbar war. "Mahlzeit" war damals eine Umgehung -und die ist bis heute geblieben.
In deiner Kolumne "Fragen Sie Frau Andrea" beantwortest du seit unglaublichen 30 Jahren Fragen von Lesern, die wissen wollen, woher gewisse Redensarten kommen. Wie arbeitest du eigentlich?
Dusl: Ich weiß natürlich nicht alles. Aber ich habe eine enorme Bibliothek mit Lexika, und da schaue ich nach - und im Internet natürlich auch. Die meisten schauen sich bei Google nur die ersten zehn Ergebnisse an. Ich schaue mir die ersten 300 Treffer an. Einiges davon ist völlig falsch, und dann geht es darum, herauszufinden, was stimmt. Es ist wie wissenschaftliches Arbeiten, und das habe ich als Kulturwissenschaftlerin gelernt. Außerdem kenne ich viele dieser Begriffe seit meiner Kindheit. Gleichzeitig ist Deutsch nicht meine Muttersprache. Die Sprache meiner Mutter ist Schwedisch. Ich habe also ganz früh angefangen, Deutsch und Wienerisch als zwei verschiedene Fremdsprachen zu lernen. In der Volksschule wurde ich gemobbt, weil ich so seltsam gesprochen habe. Ich musste also lernen -es war eine Immunisierung gegen Mobbing.
Ich höre oft, wie sich Wiener -vor allem Eltern -beschweren, dass ihre Kinder kein Wienerisch mehr sprechen. Dass die Wiener Mundart verlorengeht und die junge Generation nur noch Hochdeutsch spricht, weil sie auf Tiktok, Youtube und Instagram deutschen Influencern folgt. Wenn ich mit jüngeren Wienern zu tun habe, höre auch ich selten einen der Ausdrücke, die in deinem Buch oder deiner Kolumne besprochen werden. Wird das Wienerische bald sterben?
Dusl: Ich glaube nicht -aber die Wahrnehmung ist richtig. Wien konnte lange kein ARD und ZDF empfangen. Wien war also sowieso später dran mit der Verhochdeutschung der Sprache als Westösterreich. Seitdem ist viel passiert. Die gemeinsame Sprache, die uns Österreicher von den Deutschen trennt, ist durch Podcasts, Tiktok und so weiter eingedrungen. Aber ich glaube nicht, dass das Wienerische aussterben wird - genauso wenig wie die Begriffe. Denn die Menschen hören sie von ihren Eltern und Großeltern und geben sie an ihre Kinder weiter. Ich bekomme ja nach wie vor Leserfragen, die ich in meiner Kolumne beantworte. Aber im Wienerischen gibt es Veränderungen.
Welche denn?
Dusl: Zum Beispiel "Oida". Das hat früher kaum jemand so verwendet -das ist ein Wort, das die jungen Wiener eingeführt haben. Die Jungen schaffen ein neues Wienerisch. Es gibt zum Beispiel auch das Migranten-Wienerisch. Das wird überhaupt nie verschwinden.
Ich habe auch den Eindruck, dass diejenigen, die das Wienerische am meisten bewahren und somit quasi österreichische Tradition pflegen, Migranten sind.
Dusl: Das ist ein Soziolekt, also eine Sprache, die eine bestimmte soziale Gruppe gebraucht. Es gibt viele verschiedene Wienerische, Abstufungen, die du als Deutsche vielleicht gar nicht unterscheiden kannst. Da gibt es Leute, die sich anhören, als ob sie in einem Palais aufgewachsen wären, die ganz nasal sprechen, und so weiter.
Kürzlich erschien eine Studie, in der Österreicher zu ihrer Sprache befragt wurden. Sie fanden ihre Sprache sympathischer, gebildeter und schöner als deutsches Deutsch. Ich musste über diesen Stolz und diese Heimatliebe schmunzeln. Nun möchte ich es umkehren: Was gefällt dir als Wienerin an der Stadt und ihren Bewohnern gar nicht?
Dusl: Es gibt nichts, was mich stört.
Ehrlich? Auch schön, wenn du als Wienerin nichts zu granteln hast.
Dusl: Doch, mir fällt etwas ein. Es gibt Menschen aus anderen österreichischen Gegenden, die ihre Nicht-Wienerischkeit mitbringen. Denen würde ich gerne zurufen: "Heast, beruhig di a bissl!"
Was meinst du damit? Sind die Leute vom Land besonders laut, aufbrausend und pöbeln herum?
Dusl: Es geht nicht ums Aufbrausende. Das Wienerische antwortet mit Schmäh. Die Wiener antworten auf diese Leute mit einer eigenen Weisheit, die viele nicht verstehen. Kellner haben das drauf. In guten Wiener Kaffeehäusern gibt es gute, grantige Kellner -die haben diese Attitüde. Die Ehrlichkeit ist ein Goldstandard, eine Währung. Sei ehrlich - aber sag nicht, dass es ehrlich ist.
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Dusl: Ein Beispiel, ganz radikal: Wenn Amerikaner zu uns kommen, sind die immer verzweifelt, dass man sie nicht fragt: "How are you?" Oder Deutsche, die fragen dann: "Wie geht es Ihnen heute?" Und der Wiener antwortet: "Na ja, wie soll's mir schon gehen?" Mich stört nichts an den Wienern, aber die Touristen sind mir ein bisschen zu anstrengend.
Es gibt Umfragen unter Expats, also Leuten aus dem Ausland, die hier leben und arbeiten, die besagen, dass Wien seit Jahren zu den unfreundlichsten Städten gehört. Auch weil es hier schwer ist, Anschluss zu finden. Sind die Wiener Ausländern gegenüber besonders gemein und verschlossen?
Dusl: Genau umgekehrt. Die Expats könnten hier viel lernen in Sachen Wahrhaftigkeit. Es gibt viele, die sich interessieren und diese Verwienerung annehmen. Aber viele bringen aus ihren Kulturen mit, dass sie sich eine freundliche Maske aufsetzen. Und in Wien nehmen sie wahr, dass die Leute ehrlich zu ihnen sind. Ein Beispiel: Jemand hat die Nachricht bekommen, dass die Krankenkasse seine Zahnbehandlung nicht zahlen wird. Soll er dann sagen: "Ja, mir geht es wunderbar, und Ihnen?" Das machen Wiener eben nicht. Und das erzeugt dann das Bild eines mieselsüchtigen, unfreundlichen, tragischen Wieners. Und unseren Humor verstehen sie auch nicht. Und überhaupt Expats -wie können sie sich überhaupt anmaßen, hier nur drei Jahre zu bleiben? Das ist doch eine Beleidigung für die schönste Stadt der Welt. Außerdem sprechen viele von ihnen zu laut.
Lass uns einen Zeitsprung machen ins Wien des späten 19. Jahrhunderts. Diese Zeit war sehr prägend für die Stadt. Damals hatte Wien zwei Millionen Einwohner, es war viel los. Aus dieser Zeit gibt es berühmte Illustrationen von den sogenannten Wiener Typen, also Menschen, die damals das Stadtbild geprägt haben sollen: das Lavendelweib oder der Würstler zum Beispiel. Du hast ja dein Buch selbst illustriert -und da gibt es auch Wiener Typen. Was sind denn typische Wiener Gestalten von heute?
Dusl: Eine sehr wienerische Figur ist nach wie vor der Würstelmann. Oder der Strizzi. Dann gibt es eine Figur, die man nur sieht, wenn man nachts auf dem Gürtel unterwegs ist -die sogenannte Praterfee. Eine Prostituierte, eine Sexarbeiterin.
Eine Praterfee vom Gürtel?
Dusl: Nein, die Praterfee vom Gürtel heißt natürlich Gürtelhur. Aber das ist alles schon sehr unwoke Sprache, die aber existiert oder existiert hat. Und die Praterfee gehört zum Strizzi dazu, der betreut sie. Dann gibt es noch den Gschaftlhuber. Dem habe ich das Gesicht von Elon Musk gegeben. Auf Deutsch heißt das "Hansdampf in allen Gassen". Es gibt auch einige Politiker, die ausschließlich gschaftlhuberisch nach oben getrieben sind. Aber da das alles substanzlos ist, fliegen ihre Gebarungen irgendwann auf - und sind erfolglos. Aber der Gschaftlhuber findet immer wieder eine neue Betätigung.
In Deutschland würde man auch "Windbeutel" sagen. Ein Typ in deinem Buch ist mir gefühlt schon tausendfach in dieser Stadt begegnet: der Hubertusmantler mit der Attersee-Familienfrisur.
Dusl: Das kommt von Lukas Resetarits, der hat den erfunden. Das sind Leute, die am Graben verkehren, die durch die Nase sprechen und sich in schicken Lokalen aufhalten. Sie haben altes Geld, Besitz und Attitüde. Sie sind in Wien zugegen, haben aber auch Villen am Attersee, im Salzkammergut, in Altaussee. Es sind alte Familien, wo sich Großbürgertum, Schickimicki und Aristokratie vermischen. Und eines der Kleidungsstücke, die sie tragen, ist der Hubertusmantel: Er besteht aus einem grünen, filzernen Stoff, die Knöpfe sind mit einem geflochtenen Leder überzogen. Das kommt von der Jagd, aber normale Jäger auf dem Land aus Oberösterreich oder Tirol, die tragen das nicht. Es ist ein Angebermantel, der nur in Wien und Salzburg getragen wird. Aber der Hubertusmantler ist nur eine von vielen Wiener Figuren. Diese Vielfalt, auch das ist Wien.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: