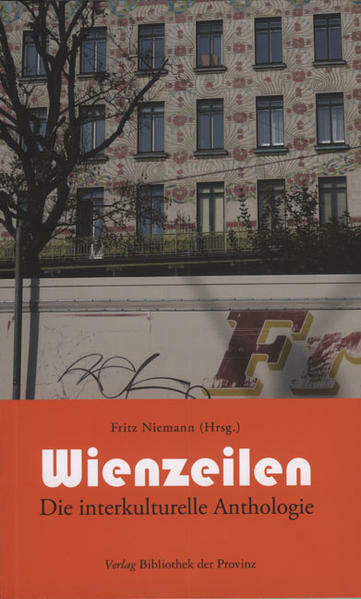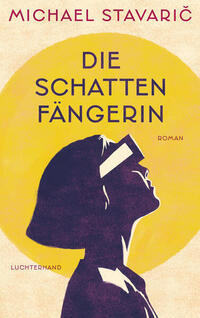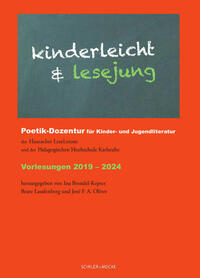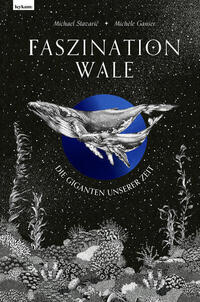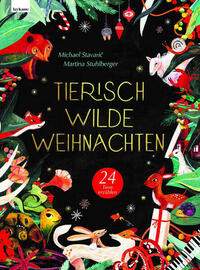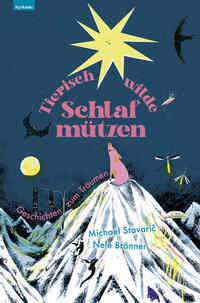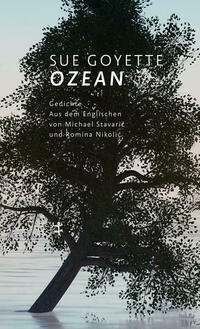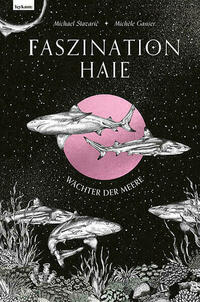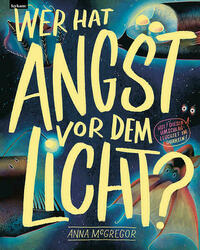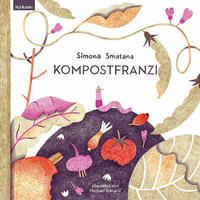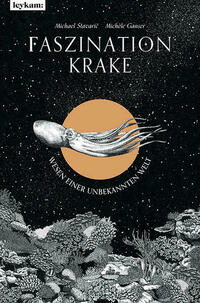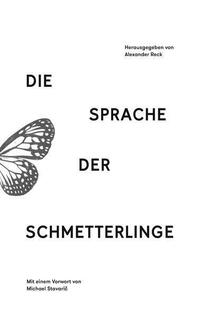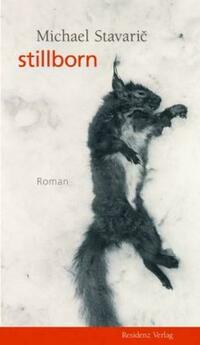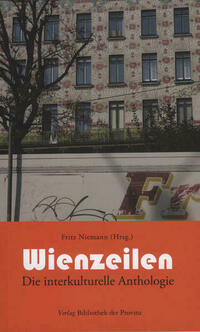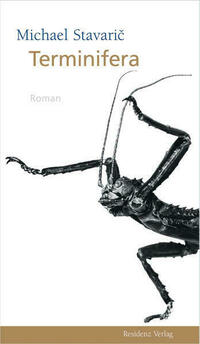Der Blick der Fremden auf ihre Wiener Heimat
Peter Menasse in FALTER 41/2009 vom 07.10.2009 (S. 18)
Welche ideen haben die sich im inneren befindlichen menschen vom inneren des anderen?", fragt Semier Insayif, "und ist nicht jeder, der von einer außenwelt kommt, auch ein mensch aus einer inneren welt?"
Einfache Fragen, gestellt in einer Stadt, die immer schon Anziehungspunkt für Menschen aus ganz Europa war, auch wenn sie hier von den Verteidigern ihres Besitzstands nicht willkommen geheißen wurden. Herausgeber Fritz Niemann, vor zwei Jahren aus Deutschland nach Wien gezogen, und von ihm eingeladene Autoren, die in erster oder zweiter Generation das Ankommen in dieser Stadt kennengelernt haben, erzählen in der interkulturellen Anthologie "Wienzeilen," wie es ist, daheim fremd zu sein, von der Außenwelt nach innen zu reisen, die Barrieren der Sprache zu überwinden, richtig anzukommen und doch immer die Sehnsucht nach der Vielfalt der Kulturen und nach der verlorenen Heimat in sich zu tragen. Entstanden ist ein schmaler Band, der, einem Reiseführer gleich, die Stadt aus einer neuen Perspektive entwickelt.
Der Herausgeber hat seinen Autoren keine Form vorgegeben. So finden wir in diesem Büchlein Gedichte, Erzählungen, politische Statements und kritische Analysen, allesamt kurz, schnell zu lesen. In der Gesamtheit wirkt es wie ein Spiegel, in dem die Wiener sich erkennen können, der es aber auch erlaubt, durchzublicken, hin auf das eigene und das fremde Innere.
Die Menschen, die am "Zidbanof", am Flughafen oder mit dem Auto als Fremde ankommen und bald getreten, gepeinigt, gedemütigt oder auch angenommen, geliebt, eingemeindet wurden, gehen erstaunlich liebevoll mit uns "Alteingesessenen" um. Vladimir Vertlib schreibt über seine vielfältigen Identitäten als Jude, als Russe, als jüdischer Russe, als Ausländer, als Mann mit guten Manieren und Deutschkenntnissen, an dem sich "die Türken und Jugoslawen ein Beispiel nehmen sollten". In jeder Gruppe, bei den Urwienern, bei den russischen Immigranten, bei den Juden, überall ist er Außenseiter, da Jude, dort "Goj". Das habe etwas Tröstliches, meint Vertlib: "Vielen von uns fällt es leichter, unser Selbstverständnis als das zu erkennen, was es letztlich für alle Menschen ist – ein mehrschichtiges, ein oft widersprüchliches Ganzes, das ständig im Fluss ist und immer wieder neu definiert werden muss."
Dieser spielerische Umgang mit der Vielfalt der Stadt, dieses eigentlich Wienerische durchzieht die Beiträge trotz ihrer unterschiedlichen Form wie ein roter Faden. Julya Rabinowich erzählt über Sprache, über die deutsche als jene des Kampfs, die russische als jene der Familie. Das Kind, das schnell gelernt hat, beherrscht die Eltern, die "nach Worten ringen wie Fische am Trockenen nach Luft", und es fühlt gleichzeitig die Ohnmacht des Abhängigen. Es ist ein "Janus mit einem Gesicht nach innen und einem nach außen". Immer ist der Bruch der Identität, die Zerrissenheit ein Thema. "Vor dem Ankommen liegt das Annehmen." Und weiter: "Am Anfang war das Wort. Ich träume von Heimat."
Barbara Markovic erzählt in der Geschichte "Wir" über eine berühmte serbische Jazz- und Popsängerin, die in Wien strandet. Nichts bleibt hier von dem über, was sie dort war. Die Not lässt sie in einem Animierschuppen landen, aus dem sie mit Mühe entkommt. Dann wird sie von der serbischen Community entdeckt und mitten in Wien wieder genau in die Starrolle eingepasst, die sie in Serbien innehatte. Und noch einmal kann sie flüchten.
Tarek Eltayeb, in Kairo geboren, schreibt über uns: "Menschen in eleganten Uniformen mit denselben Krawatten sitzen in Cafés, sehr beschäftigt mit ihren großen Heften und Telefonen." Er kann sich uns wegträumen, das Andere hervorholen, uns flüchten: "Ich lege mich auf den Rücken, wie damals im taufrischen Sand, überlasse mich dem Schweben im weiten All und singe."
Radek Knapp kam im Alter von zwölf Jahren 1976 aus Polen nach Wien. Die zwei einzigen deutschen Sätze, die er kannte, stammten aus einer polnischen Fernsehserie zum Zweiten Weltkrieg und lauteten: "Mein Gewehr hat schon wieder eine Ladehemmung" und "Wo ist der Sturmbannführer Stettke". Die halfen ihm allerdings nicht, als er das erste Mal die Schwelle eines Gasthauses in Ottakring überschritt und ihm ein "Sprüh a Wolkn!" entgegenschlug. Knapp beschreibt in seinen "Wienzeilen" die Idiome der Wiener, die trotz der schnellen U-Bahn die Bezirksgrenzen nie überspringen. In Wien herrsche eine Dialektvielfalt "wie im Kongobecken".
Die Vielfalt der Kulturen, die Wien über die Jahrhunderte besiedelt haben, ist in der Einleitung von Fritz Niemann kurz und informativ zusammengefasst. Er schreibt über Türken, Serben und Polen, über Chinesen, Italiener, Deutsche, US-Amerikaner und Menschen aus vielen anderen Ländern auch. So sind Niemanns "Wienzeilen" eine gelungene Mischung aus Informationen, von denen wir bisher nicht gewusst haben, dass wir sie unbedingt brauchen, aus literarischen Texten, hintergründigen Wien-Berichten und politischen Analysen zu Fremdenfeindlichkeit und zu gelungenem Zusammenleben.
Nur in einem Punkt trägt Niemann zur Verwirrung des gelernten Wieners bei. "Der Österreicher unterscheidet sich vom Deutschen durch die gemeinsame Sprache." Dieser Satz wird hierzulande zumeist Karl Kraus unterlegt, von einigen wenigen auch Karl Farkas. Bei Niemann war George Bernard Shaw der Urheber, und das lässt uns Wiener jetzt doch einigermaßen ratlos zurück. Ist denn Shaw etwa auch nach Wien emigriert? Na, dann sollten wir in guter österreichischer Tradition unbedingt seinen Nobelpreis für Wien reklamieren.