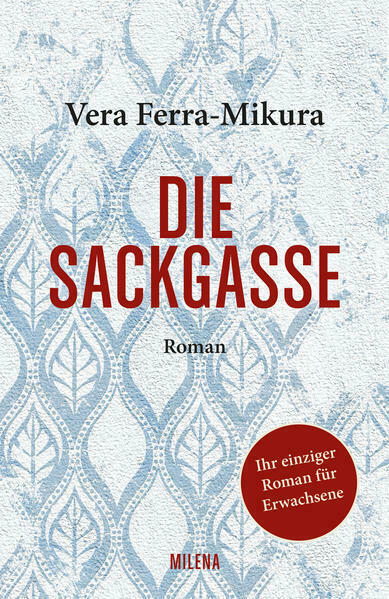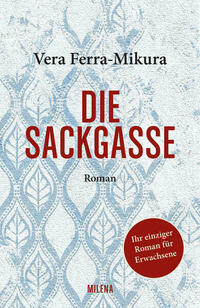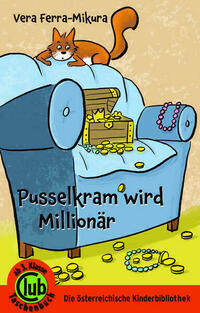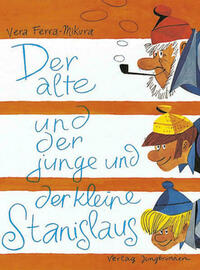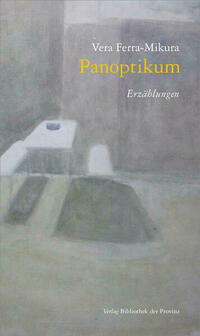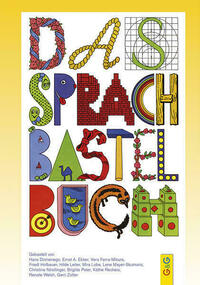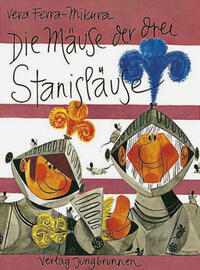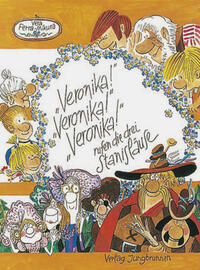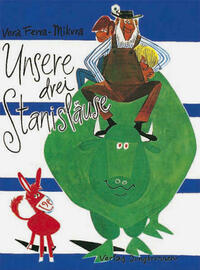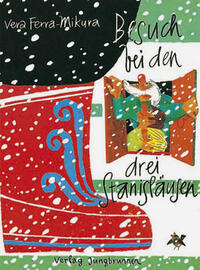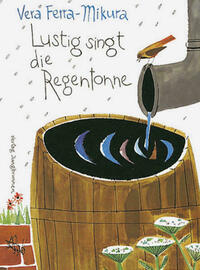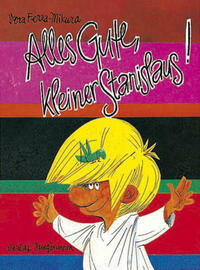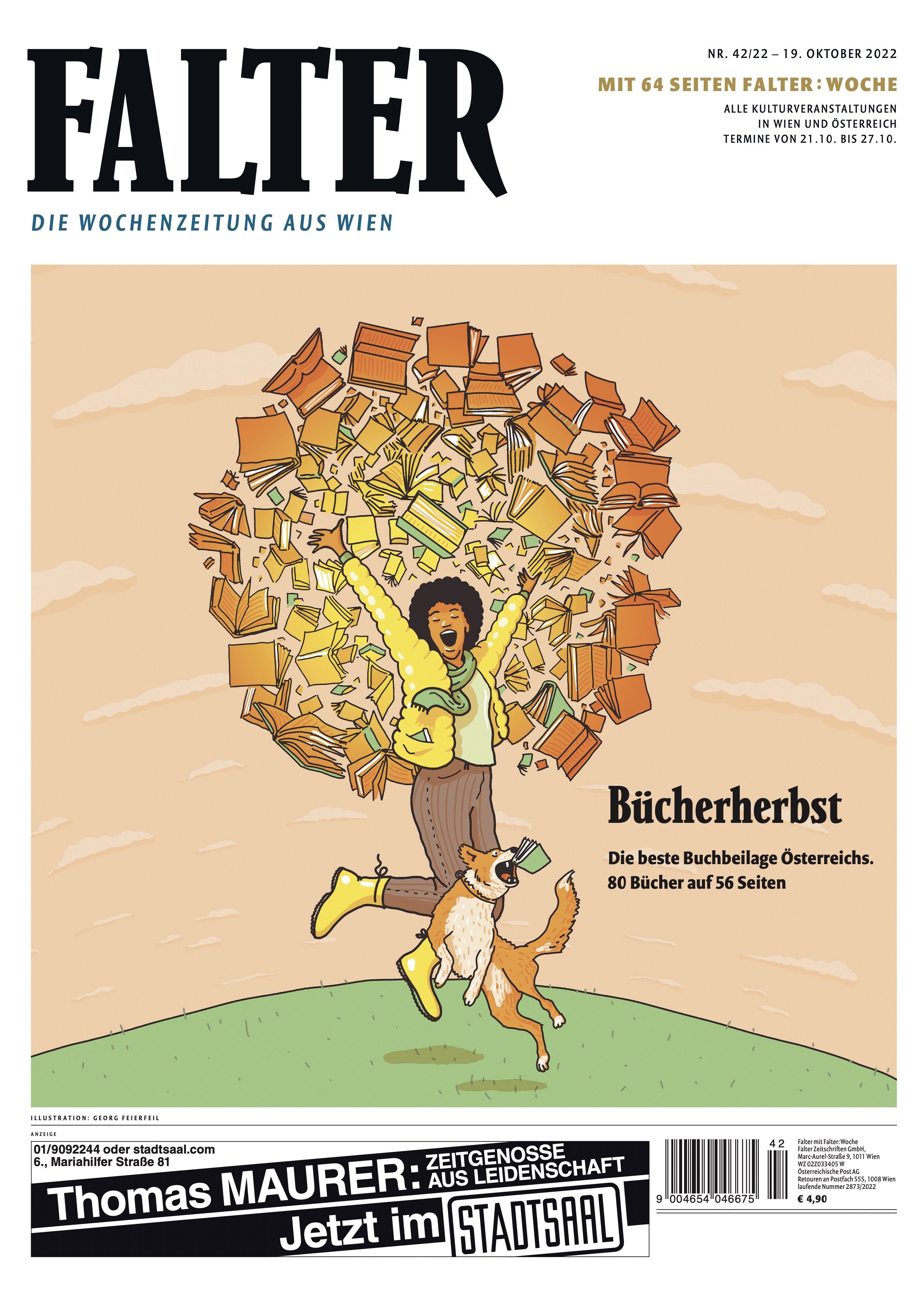
Mietskasernendrama im Nachkriegswien
Alfred Pfoser in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 20)
Die Wiener Autorin Vera Ferra-Mikura (1923–1997) ist vor allem als Kinder- und Jugendbuchautorin bekannt; „Die drei Stanisläuse“ sind nach wie vor beliebt. Wiewohl sie heute in der Literaturgeschichte als Vertreterin eines „Magischen Realismus“ gilt, hat sie zu Beginn ihrer Schriftstellerlaufbahn auch ganz andere Schreibstile ausprobiert. „Die Sackgasse“, jetzt bei Milena wiederaufgelegt und erstmals 1947 publiziert, huldigt einem sozialen Realismus, mit einem Schuss Kolportage.
Der Roman arbeitet mit vielen Dialogen, streut kräftige Adjektive, starke Lyrismen oder schwülstige Formulierungen als Würze ein. Am Ende fühlt sich die Autorin geradezu verpflichtet, uns nicht ohne positiven Abschluss zu entlassen. Im letzten Satz glüht der letzte Rest der Sonne „wie eine Verheißung“ am Horizont.
Schauplatz ist eine Mietskaserne in der „Sackgasse“. Auf engstem Raum entsteht viel Reibung, gedeihen Missgunst und Neid, blühen Tratsch und soziale Kontrolle. In einer starken Passage führt uns der Roman, wie in einem Film, kursorisch in das Leben aller Hausbewohner ein, in deren Schilderung die Autorin einen beinahe satirischen Ton anschlägt.
Mittendrin befindet sich die Familie Kleist, mit der sich das Romandebüt näher beschäftigt: Der Vater ist verstorben, die Mutter, eine veritable Bissgurn, kämpft jeden Monat ums Überleben, die drei Kinder, 17 bis 23 Jahre alt, sind im Aufbruch und versuchen den Absprung.
Das Ziel ist klar: Ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben soll es sein. Das kann nicht gutgehen: Sowohl im Arbeits- und Liebesleben als auch im künstlerischen Milieu, in das sie streben, geht es härter zu als erwartet. Ohne Opfer kommt dieses Drama nicht aus.
Zwischendurch überrascht uns Ferra-Mikura mit schrägen Szenen und bizarren Typen: Rupert, der Sohn mit der poetischen Mission, verschreibt sich einem harten Sportprogramm, um seinen Körper zu züchtigen; in einer beengten Wohnung erweist sich dies als kompliziertes und ziemlich komisches Vorhaben. Wie aus der Zeit gefallen auch das Auftreten eines schrulligen Alten, der Alkohol und Nikotin, Milch und Käse ablehnt und Nüsse als Fleischersatz preist. Er hat die Rolle des Weisen vom Dienst, der Rupert beherzt zusetzt und ihm als „Kaltwasserfreund“ eintrichtert, nicht wie „ein alter Dudelsack“ zu jammern.
Dem Text ist anzumerken, dass die Autorin ihre eigene Suche, ihre eigene Emanzipationsgeschichte und das ihr vertraute Milieu einbringt. Ferra-Mikura arbeitete als sogenanntes „Laufmädchen“ in einem Warenhaus, verdingte sich als Stenotypistin, hatte sicherlich genug Schwierigkeiten, nach 1945 in ihre Rolle als Schriftstellerin zu finden. Die entsprechenden Lebenserfahrungen finden sich unverkennbar im Roman wieder. Obwohl Ort und Zeit nicht genannt und obwohl der Krieg und seine Folgen ausgespart werden, lokalisieren das äußere Ambiente, die Armut und Trostlosigkeit, den Schauplatz relativ eindeutig als das Wien der Nachkriegszeit.