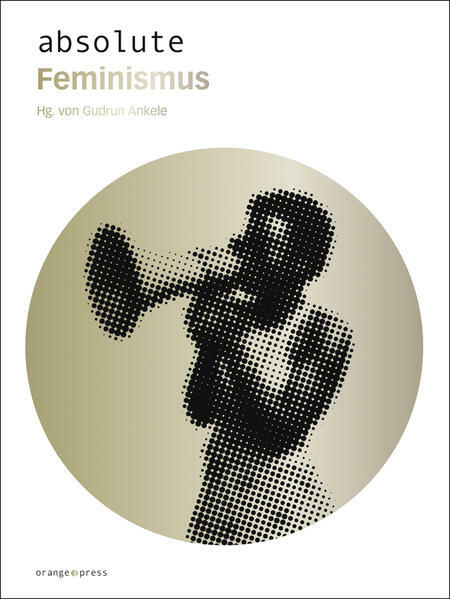Sprache, Geschlecht und Feminismus: die Buchtipps unserer Autoren
Matthias Dusini in FALTER 30/2014 vom 23.07.2014 (S. 11)
Matthias Dusini empfiehlt:
Die Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch veröffentlichte 1984 den Sammelband "Das Deutsche als Männersprache". Darin schildert sie die "Instandbesetzung" der deutschen Sprache. "Die Regeln der Grammatik werden feminisiert und dadurch humanisiert." Ein Dokument, das das Engagement der Sprachbesetzerszene anschaulich macht. Um die andere Seite zu verstehen, hilft "Nach den großen Erzählungen" von Beat Wyss. Der Kunsthistoriker rechnet darin mit 1968 und dem Feminismus ab.
Sibylle Hamann empfiehlt:
"Wie bleibe ich FeministIn": Die Frage aus dem Untertitel des Essaybands "Das wird mir alles nicht passieren
" handelt Streeruwitz in elf Biografien ab. Geschlechterrollen spielen in ihren Settings eine Rolle – ob man sich ihnen fügt oder widersetzt, sie sind immer da. Die Gehaltsschere, die Verteilung von unbezahlter Arbeit: Das sind keine voneinander unabhängigen Themen. Im Sammelband "Absolute Feminismus" sucht und findet die Kunsthistorikerin Gudrun Ankele die großen Linien des Feminismus.
Armin Thurnher empfiehlt:
Niemand wird aus einem Buchtipp sprachkundig, sprachaffin oder gar sprachsensibel. Aber manche Bücher können einen der Sprache näherbringen. Etwa die Aufsatzsammlung "Die Sprache" von Karl Kraus. Oder das wunderbare Buch "Als Freud das Meer sah" des deutsch-französischen Autors Georges-Arthur Goldschmidt, der deutsche und französische Wörter untersucht und beschreibt, wie Hölderlins Sprache knechtisch werden konnte und "zum kriminellen Idiom par excellence", zur Sprache der Nazischergen.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen:
Wenn den Frauen die Triebe gestutzt werden
Sibylle Hamann in FALTER 50/2010 vom 15.12.2010 (S. 20)
Das Mitleid mit Migrantinnen hat lange den feministischen Diskurs ersetzt. Zwei Bücher laden das Thema endlich neu auf
Mit dem Feminismus ist es ähnlich wie mit der Gesundenuntersuchung. Man denkt nicht gern dran. Man spürt zwar schon die längste Zeit, dass es an vielen Stellen zwickt, aber man redet sich ein, es werde schon nichts Ernstes sein. Das gehe von selber wieder vorbei, man könne sich eh prima ablenken, und wenn man sich sehr bemühe, spüre man die Symptome fast gar nicht mehr.
Aber dann gibt es doch wieder einen Befund. Mit schlechten Blut- und Leberwerten. Und irgendwie entkommt man auf Dauer der Frage nicht, ob die vielen Symp-
tome nicht vielleicht doch mit einem größeren Krankheitsbild zusammenhängen.
Die Schriftstellerin Marlene Streeruwitz ist eine, die uns seit Jahren solche Untersuchungen aufdrängt. Einem widerwilligen Österreich, das sich für pumperlgesund hält und genervt die Augen verdreht, wenn man ihm sagt, dass ihm ein paar Veränderungen im Lebensstil guttäten. Stree-
ruwitz scheut sich nicht einmal, das Wort auszusprechen, das Frauen üblicherweise sofort in die Schreckschraubenecke verbannt, samt Binnen-I. "Wie bleibe ich FeministIn" lautet der Untertitel zu ihrem Buch "Das wird mir alles nicht passieren
".
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Wie vergrößere ich meine Autonomie, ohne einsam zu werden? Wie kämpfe ich, ohne zu verbittern? Wie sind Sinn und Nähe und Beziehungen und Liebe möglich, ohne sich selbst aufzugeben?
Elf Versuchsanordnungen
Streeruwitz handelt diese Frage anhand von elf knapp abgesteckten Biografien ab. Neun Frauen, zwei Männer, alle vom Leben ein bisschen beschädigt. Alle stecken in einem Knäuel aus Erwartungen, eigenen und fremden, und haben Entscheidungen getroffen, richtige und falsche. Sie haben sich fortgepflanzt oder auch nicht, sie haben gelogen oder sich betrügen lassen, sie haben sich verausgabt und zweifeln, ob für die richtige oder die falsche Sache. Und jetzt stehen sie allesamt an einem Punkt, an dem die nächste Entscheidung fällig ist.
"Dass die Liebe zu einem so viel älteren Mann das Licht sein musste, in dem sie vereint standen. Sie hatte sich mächtig und schön darin gefühlt und es war alles nicht wahr gewesen", heißt es etwa über "Felicity P.". Es sind exemplarische Settings, die beinahe an physikalische Versuchsanordnungen erinnern. Ein wesentlicher Teil des Settings sind die Geschlechterrollen. Egal ob man sich ihnen fügt oder widersetzt – da sind sie immer. Bei der Frage, was Geld bedeutet. Wie man Schmerzen erträgt. Wodurch sich der Status bestimmt. Wovor man sich fürchtet. Wenn ein Mann und eine Frau dasselbe tun, wird es selten als dasselbe wahrgenommen.
Diese Unterschiede diagnostiziert
Streeruwitz präzise, nicht auf einer akademischen, sondern auf einer sehr alltäglichen Ebene. Damit zerschmettert sie eine Behauptung, die speziell in Österreich gern dröhnend vorgetragen wird: dass eh schon längst alles erledigt sei mit der Gleichberechtigung der Geschlechter. Alles paletti, alles abgehakt, wer jammert, sei überempfindlich und/oder selber schuld.
Große Linien
Tatsächlich ist interessant, dass die Frauenfrage derzeit hauptsächlich als Migrantinnenfrage diskutiert wird. Jeder zweite "Tatort" arbeitet sich an einem Ehrenmord oder einer Zwangsehe ab. Bei der Ablehnung des anatolischen Patriarchen, der seine Ehefrau unters Kopftuch zwingt und seine Töchter verprügelt, sind sich alle rasch einig – inklusive jener, die das Thema häusliche Gewalt nie für wichtig hielten.
Feminismus wird hier für die Abwehr von Migranten instrumentalisiert. Das wäre noch nicht verwerflich. Doch schwingt in der lauten Empörung über die patriarchalen Fremden stets auch eine zweite Botschaft an die eigenen Frauen mit: Schaut doch, wie gut es euch geht! Wer wird sich denn kleinlich über die Gehaltsschere beschweren, wenn anderswo Frauen gesteinigt werden? Denkt immer dran – wir könnten auch anders!
Viel Selbstgefälligkeit kommt in dieser Debatte zum Ausdruck. Eine Selbstgefälligkeit, die einen kritischen oder sogar utopischen Blick auf die Geschlechterverhältnisse in der eigenen Gesellschaft kaum mehr zulässt. Genau diese Leerstelle will ein Sammelband der Kunsthistorikerin Gudrun Ankele füllen: "Absolute Feminsimus", der Teil einer von Klaus Theweleit herausgegebenen Philosophiereihe ist.
Ankeles Verdienst ist, nicht an den kleinen Brocken Feminismus pickenzubleiben, die in der Politik von Zeit zu Zeit aufblitzen – der Gehaltsschere, der Verteilung von unbezahlter Arbeit, der Quotenfrage. Ankele (Jg. 1973) bemüht sich um die großen Linien der Auseinandersetzung, von der Französischen Revolution bis zu den Riot Girls. Sie findet Gemeinsamkeiten in der Utopie einer "Stadt der Frauen" von 1405 mit der SCUM-Bewegung von 1968 ("Society for Cutting Up Men"), die Andy Warhol auf dem Gewissen hat.
Ankele verweigert sich konsequent allen Versuchen, die Frauenbewegung in "Generationen" zu zerteilen und diese in TV-Shows aufeinanderzuhetzen, wie es derzeit so beliebt ist. Dabei kann man sie tatsächlich finden, die großen Linien, die alles verbinden. Die aus den losen Symptomen eine einzige Krankheit machen, die Patriarchat heißt. "Eine bloß äußerliche Emanzipation hat aus dem modernen Weibe ein künstliches Wesen gemacht, das an die Ergebnisse französischer Gärtnerkunst gemahnt", schreibt die US-amerikanische Anarchistin Emma Goldman im Jahr 1906. "Arabeskes Laubwerk und Gesträuch, Pyramiden, Räder und Kränze – alles nur nicht diejenigen Formen, welche die Pflanzen und Bäume durch die Entfaltung ihrer eigenen Triebe erreicht hätten." So ähnlich fühlen sich Marlene Streeruwitz' Charaktere wohl auch.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: