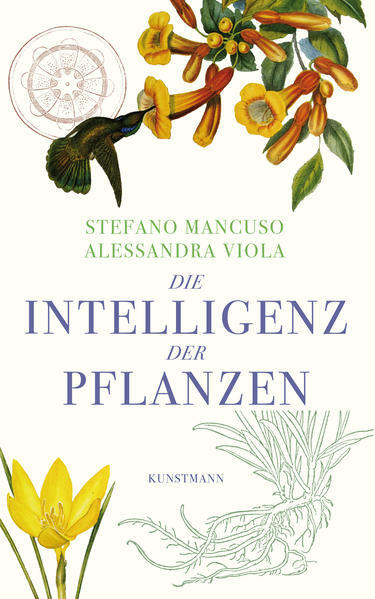Freche Früchtchen
Anna Goldenberg in FALTER 26/2024 vom 26.06.2024 (S. 44)
Intelligenz ist ein dehnbarer Begriff. Pflanzen können wahrnehmen, was um sie herum geschieht, auf Reize wie Licht oder Wasserknappheit reagieren. Wer sesshaft ist, muss schließlich wissen, wie man sich schützt. Aber macht sie das gleich klug? Uns fehlen wohl die Wörter, um die anders veranlagte Intelligenz der Pflanzen zu begreifen, also leihen wir sie aus dem Menschenreich. Pflanzen können sehen, fühlen, schmecken, schreibt der israelische Pflanzenforscher Daniel Chamovitz (siehe Marginalie).
Wie wir nützen auch Pflanzen Neurotransmitter wie Dopamin, wofür, ist noch unklar. Sie können Daten aus dem Boden, über Temperatur oder Schwerkraft verarbeiten. Ganz ohne Gehirn. Der Journalist Michael Pollan schreibt deshalb im New Yorker, dass es nur menschliche Arroganz sei, pflanzliche Intelligenz nicht wertzuschätzen. Und der Pflanzenwissenschaftler Stefano Mancuso sagt gar, dass ein Gehirn zu haben für eine Pflanze ohnehin ein Nachteil wäre - denn als Organismus, der nicht weglaufen kann, wäre es schlecht, unersetzbare Organe zu haben. Die vielleicht einfach abgebissen werden. Ein Ausschnitt aus dem grünen Leistungskatalog.
Feinde als Freunde
Die Einwohner der Anden domestizierten die Limabohne wohl schon um 2000 vor Christus. Dass sie so alt werden konnte, liegt sicherlich auch an einem ihrer besonderen Talente: Wird die Bohne angegriffen, etwa von Spinnmilben, reagiert sie auf zwei Weisen. Die angeknabberten Blätter geben einen Mix an Duftsignalen an die Luft ab; die Blüten produzieren einen Nektar, der fleischfressende Milben anzieht, welche die "Schädlinge" für die Pflanze entfernen (und dabei auch noch satt werden).
Getreu dem Motto "Die Feinde meines Feindes sind meine Freunde". Auch andere Pflanzen bekämpfen Angreifer so. Bestimmte Akazienarten produzieren Abwehrstoffe bereits dann, wenn man ihnen die Geräusche von mampfenden Raupen vorspielt. In den Tropen kommen den Akazienbäumen dann Ameisen zu Hilfe, um die gefräßigen Tiere zu vertreiben.
Räuberin mit Erinnerungsvermögen Sie ist wohl das blutrünstigste, aber auch eines der schlausten Gewächse der Pflanzenwelt: Dionaea muscipula, besser bekannt als Venusfliegenfalle. Wenn ein Insekt auf ihren Fangblättern landet, weiß es wohl noch nicht, was es erwartet. Doch die hungrige Pflanze braucht ihr Fleisch. Eigentlich kommt sie aus den Sümpfen der US-amerikanischen Ostküste, wo die Böden nicht genug Stickstoff und Phosphor hergeben. Deshalb hat sie sich auf tierisches Protein spezialisiert.
Sie ist nicht nur anpassungsfähig, sondern auch gerissen: Die Venusfliegenfalle besitzt nämlich so etwas wie ein Kurzzeitgedächtnis. Die Fangblätter wieder zu öffnen ist energieaufwendig und dauert mehrere Stunden. Es muss sich also lohnen. Die Strategie? Härchen an den Fangblättern fühlen die Beute, aber wenn ein Insekt nur eines davon berührt, schließen sich diese nicht sofort. Ein Tier passender Größe wird höchstwahrscheinlich zwei Haare innerhalb von 20 Sekunden berühren - das löst den Schließreflex aus. Die Pflanze behält die erste Information wie eine Erinnerung - und ruft diese bei zweiter Berührung wieder auf.
Aspirin zur Selbstheilung
Schon im alten Rom ernteten Menschen Acetylsalicylsäure aus Weidenrinde, um es Kranken zu verabreichen. Später stellten Chemiker daraus das Medikament Aspirin her -bis heute nützen Mediziner es, um Fieber zu senken und Schmerz zu stillen. Die Pflanzen produzieren diese Chemikalie aber nicht aus Nächstenliebe. Sie brauchen es selbst als Abwehrhormon, das das pflanzeneigene Immunsystem stärkt.
Greifen Viren oder Bakterien Weiden (und andere Pflanzen mit diesem Talent) an, produzieren sie die Säure am Startpunkt der Infektion, um den Rest der Pflanze darüber zu informieren. Die gesunden Teile bilden dann eine Barriere aus toten Zellen rund um den Infektionspunkt, damit sich das Bakterium nicht auf andere Teile der Pflanze ausbreiten kann. Man sieht sie als weiße Flecken auf Blättern. Selbstaufopferung für das Gemeinwohl!
Umstrittenes Netzwerk "Wie Bäume miteinander sprechen" lautet der Titel des Ted-Talks der kanadischen Pflanzenforscherin Suzanne Simard, der seit 2016 rund 5,7 Millionen Mal angeklickt wurde. Ihre These ist breitenwirksam: Bäume eines Waldes seien miteinander verbunden, und zwar über sogenannte Mykorrhiza-Pilze. Diese agieren wie verlängerte Wurzeln und bereiten Nährstoffe aus dem Boden auf. Im Gegenzug erhalten sie Zucker. Und so entsteht ein Netzwerk, mithilfe dessen die Bäume Nährstoffe zueinander transportieren, auch, um eigene Abkömmlinge zu stärken.
So beliebt die These, so sehr wird sie mittlerweile von der Fachwelt in Frage gestellt. Im Vorjahr erschienen mehrere kritische Übersichtsartikel, in denen auch Simards frühere Koautoren beanstandeten, die Ergebnisse seien überinterpretiert worden. Nur kleine Mengen an Nährstoffen würden über das Pilz-Netzwerk transportiert. Auch der Transfer über die Erde oder die Luft sei möglich. Zudem stammen viele von Simards Daten von Glashausexperimenten und nicht aus der Natur. Die - und da sind sich alle einig -noch genauer untersucht werden muss.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen:
Ehrliche Lupine, betrügerische Ragwurz
Julia Kospach in FALTER 11/2015 vom 11.03.2015 (S. 44)
Biologie: Stefano Mancuso legt ein leidenschaftliches Plädoyer für einen neuen Blick auf alles Grüne vor
Da wir uns als Krone der Schöpfung betrachten, halten wir Pflanzen zwar für Lebewesen, gehen aber im Grunde davon aus, dass sie plan- und ziellos vegetieren und höchstens reaktiv im Austausch mit ihrer Umwelt stehen. Geht es nach uns, sind sie dazu da, uns zu nähren, zu heilen, mit Werkstoffen zu versorgen und unser Auge zu erfreuen.
Bereits Aristoteles hatte in seinem für die abendländische Kultur so einflussreichen Werk "De Anima" den Pflanzen in der Ordnung aller Organismen einen Platz an der Grenze zwischen lebendig und nicht lebendig zugeteilt. Und in der biblischen Überlieferung nahm Noah vor der großen göttlichen Flut von jedem Geschöpf ein Paar mit auf seine Arche, aber keine einzige Pflanze.
Der Ölzweig im Schnabel der Taube, der Noah später die Nähe von Land anzeigte, kam gleichsam aus dem Nirgendwo.
Schon immer hatte diese wirkmächtige Haltung auch Gegenspieler – zwei ihrer bekanntesten waren der griechische Philosoph Demokrit und, fast 2500 Jahre später, Darwins Sohn Francis. Aber die wenigen, die Pflanzen für intelligente Wesen hielten, konnten sich bis in die 1950er-Jahre auf nicht viel mehr als ihre Intuition verlassen.
Seither hat sich die Faktenlage massiv verändert, und jährlich kommt viel neues Wissen hinzu. "Aberwitzig wenig" wüssten wir im Vergleich zu Mensch und Tier immer noch über die Pflanzen, schreibt der italienische Pflanzenforscher Stefano Mancuso in seinem von tiefer Leidenschaft beseelten Buch "Die Intelligenz der Pflanzen".
Klar bewiesen ist aber inzwischen Folgendes: Pflanzen sind empfindsame Wesen, "die über kommunikative Fähigkeiten, ein Sozialleben und raffinierte Problemlösungsstrategien verfügen". Sie sind imstande, "sorgfältig abzuwägen und Entscheidungen zu fällen", sie besitzen Lern- und Erinnerungsvermögen, erkennen ihre Verwandten (das weiß man erst seit 2007) und können zwischen Handlungsalternativen abwägen.
Stefano Mancuso muss es wissen. Der Italiener leitet in Florenz das Internationale Laboratorium für die Neurobiologie von Pflanzen und gilt mit über 250 wissenschaftlichen Publikationen zum Thema weltweit als der große Experte zum Thema Pflanzenintelligenz.
Die Definition von Intelligenz, die seinen Thesen dabei zugrunde liegt, meint die Fähigkeit, Problemlösungen zu finden. Diese besitzen Pflanzen in hohem Maß. Dass wir uns so schwer damit tun, das nachzuvollziehen, glaubt Mancuso, hat auch mit einem Mangel an Vorstellungskraft zu tun. Denn Pflanzen hören ohne Ohren, sehen ohne Augen und fühlen ohne Nervenbahnen und Hirn. Sie sind völlig anders strukturiert, weil sie sesshaft leben.
Sie haben nicht wie der Mensch und die meisten Tiere im Lauf der Evolution alle lebenswichtigen Funktionen auf einige wenige Organe wie Hirn, Lunge oder Magen konzentriert. Im Gegenteil: "Ihr Körper ist modular aufgebaut, das heißt, jeder Körperteil ist wichtig, aber letztendlich keiner unverzichtbar." Das ist günstig, wenn man nicht flüchten kann.
Am Beispiel unserer fünf Sinne dekliniert Mancuso die pflanzlichen Techniken der Wahrnehmung durch. Vieles davon war in den letzten Jahren bereits in den unterschiedlichsten Sachbüchern nachzulesen, aber es ist noch nie mit solcher Verve vorgetragen worden wie hier. Von chemischen Düften als der bisher noch weitgehend unentschlüsselten Sprache von Pflanzen ist hier die Rede. Von den "mechanosensiblen Kanälen" an ihrer Epidermis, mit denen sie fühlen und hören.
Das Einfalten der Blätter bei Berührung, für das Mimosen so berühmt sind, zeigt sich hier plötzlich in neuem Licht: Es ist, wie man inzwischen weiß, kein konditionierter Reflex, sondern abwägendes Handeln. Denn wenn Mimosa pudica einen Reiz, etwa Regen oder Wind, als ungefährlich einstuft, bleiben die Blätter offen.
Bei Mancuso ist von ehrlichen Lupinen oder betrügerischen Ragwurzen die Rede, von wehrlosen und wehrhaften Maissorten, von der "Schüchternheit der Baumkronen" und von der Gehirnfunktion der Pflanzen, die in allen Zellen verfügbar ist und nicht wie bei Mensch und Tier auf ein Organ zusammengezogen. Er erklärt, wie Pflanzen ohne Nervenbahnen höchst effizient Informationen übermitteln und dass Wurzeln häufig Entscheidungen treffen müssen und das auch tun.
Wie man festgestellt hat, besitzen sie sogar eine Art "Schwarmintelligenz". Anders als der Mensch haben Pflanzen nicht nur fünf Sinne bzw. Pendants dazu, sondern insgesamt 15. Unter anderem für Bodenfeuchtigkeit, für Schwerkraft und elektromagnetische Felder.
So weitreichend sind ihre Fähigkeiten und so groß unsere diesbezügliche Blindheit, dass Mancuso abschließend mit einigem Recht sogar die Frage stellt, "was passieren würde, wenn wir eines schönen Tages außerirdischer Intelligenz begegnen? Würden wir sie überhaupt erkennen? Wahrscheinlich nicht. Denn offensichtlich kann sich der Mensch keine andere Intelligenz als seine eigene vorstellen."
Fast außerirdisch klingt deshalb auch die Kunde von Plantoiden, also Robotern, die pflanzliche Fähigkeiten nachahmen. Tatsächlich aber führt die Erforschung pflanzlicher Kommunikations- und Sozialsysteme schon seit einigen Jahren zur Entwicklung "völlig neuartiger, bisher unvorstellbarer Anwendungstechnologien", wie Mancuso berichtet.
Vielleicht werden diese bald den von menschlich-tierischen Eigenschaften beeinflussten androiden Robotern den Platz streitig machen.