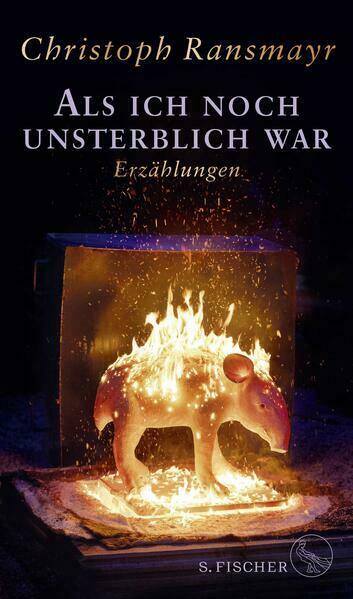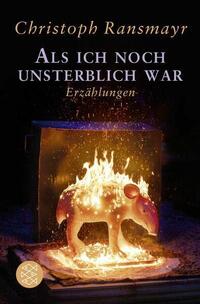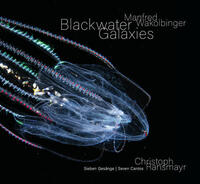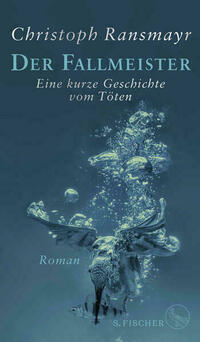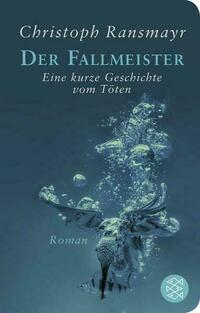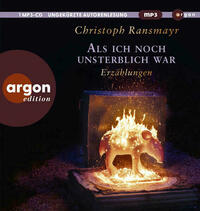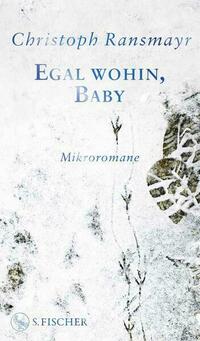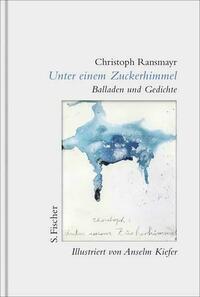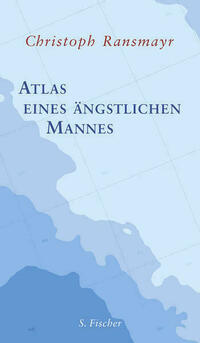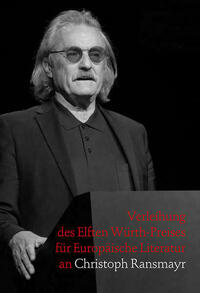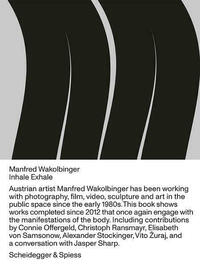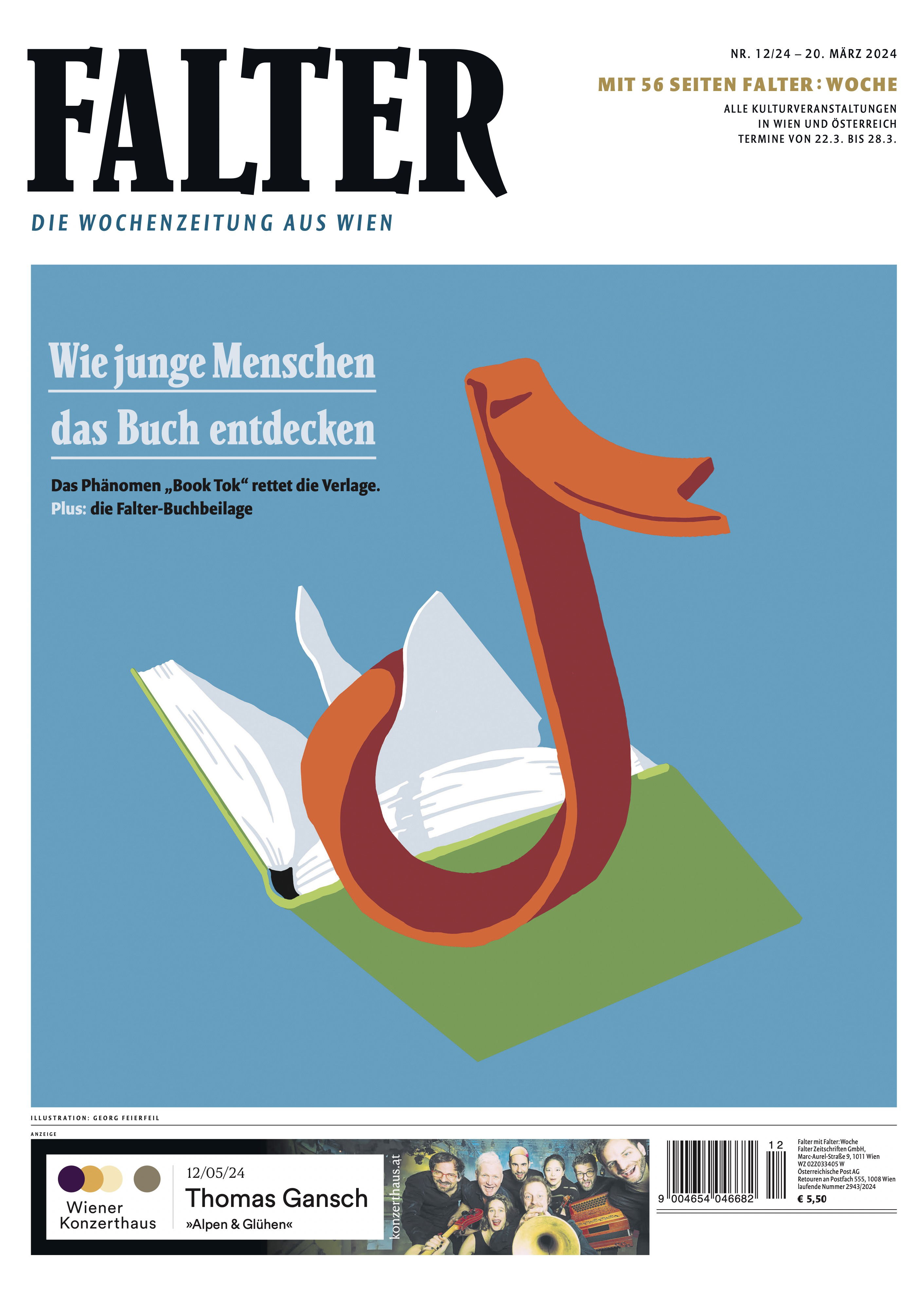
Metaphysische Verzückung
Björn Hayer in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 10)
Am Anfang war das Wort, aber ganz am Anfang die Buchstabensuppe. Darüber besteht zumindest im Falle des sich an seine Kindheit erinnernden Ich-Erzählers Gewissheit. Klar wie Brühe schimmert aus dem „S“ die Schlange hervor, mithin lassen sich mit den Zeichenketten sogar Soldaten- und Elfenvölker gründen.
„Es liegt an dir“, sagt man dem Protagonisten, „du hast mit dem einen Löffel voll Buchstaben dein Leben, die Welt in der Hand“. Nur eines wird ihm erst nach dem Tod seiner Mutter bewusst, nämlich dass „bei allem Glanz des Zaubers der Verwandlung von etwas in Sprache, in Schrift, der ungeheuerliche und unfaßbare […] verlorene Rest doch – das Schweigen war.“
Diese Stille birgt wohl das, was in Christoph Ransmayrs Werken seit jeher als der spirituelle Überschuss gelten darf. In seinen aktuellen, in dem Band „Als ich noch unsterblich war“ versammelten Erzählungen ist er omnipräsent, insbesondere als Erbe einer Romantik, die in der Literatur symbolisch jene religiösen Tempel wiederauferstehen ließ, von denen in der Realität längst nur noch Ruinen übrig geblieben waren.
Was hier bildlich gemeint ist, trifft der 1954 in Wels geborene Autor auf einer Reise nach Sri Lanka in konkreter Weise an. Nach Jahrhundertfluten und Stammeskriegen liegt an der Ostküste sowohl ein Heiligtum als auch ein Kino in Trümmern. Wenn einmal die Rekonstruktion beginnen sollte, stellt sich die Frage: Welchem Bauwerk kommt nun die Priorität zu?
Beide Orte, weiß ein örtlicher Mönch, dienen als „Zuflucht vor der brennenden Wirklichkeit“. Dennoch schätzt er die Chancen für das Filmhaus höher ein, da seine Erlöser völlig aus Licht bestünden. Um eine Transzendenzerfahrung geht es ebenso in einem Text über eine Reise zur bei Hongkong gelegenen Joss House Bay.
Dass man vom Schiff aus die brennenden Opfergaben zu Ehren der Göttin Tin Hau bestaunen kann, die einst viele Menschen vor dem Ertrinken gerettet haben soll, versetzt den Erzähler in geradezu metaphysische Verzückung. Im Glauben, in diesem Augenblick auch von der Himmelsmacht bewacht zu sein, kommen ihm Zitate aus dem Langgedicht „Der Untergang der Titanic“ von Hans Magnus Enzensberger in den Sinn.
Seit seinem Roman „Die Schrecken des Eises und der Finsternis“ (1984) über die Payer-Weyprecht-Expedition gilt Ransmayr als der deutschsprachige Reiseschriftsteller schlechthin. Immer ist sein Blick zugewandt, voller Respekt und Bewunderung für das Andere.
Während die westlichen Gesellschaften sich über die Migrationsfrage und der Angst vor Überfremdung zu zerreißen drohen, zeigt der Autor stets die Bereicherung im Kontakt mit Menschen unterschiedlichster Kulturen auf. Die Schönheit der Begegnungen ist dabei nie bloß Theorie, sondern Resultat gelebter Praxis.
In seiner Literatur manifestiert sich die Idee einer Friedensordnung auf Basis eines emphatischen Verstehenwollens. Dies schließt nicht aus, dass er aber auch dezidiert Kritik an politischen Heucheleien übt. So etwa in der Kurzprosa „Mädchen im gelben Kleid“: Aus einer Tour zu afrikanischen Berggorillas entwickelt sich eine scharfe Auseinandersetzung mit kolonialer Vergangenheit.
Europa „hat die Rechnungen für seine durch Jahrhunderte unternommenen Raubzüge quer über alle Kontinente dieser Erde nie bezahlt“, betont der Erzähler und macht im Anblick eines wasserschleppenden Mädchens eine Beobachtung zur globalen, sozialen Ungleichheit: Für Hotelkonzerne werden Leitungen verlegt, derweil muss sich die Bevölkerung mit schmutzigen Pfützen arrangieren.
Gemein haben diese Anklagen mit der Weitherzigkeit der anderen Erzählungen eine Passion, die keine faulen Kompromisse kennt. Ransmayr zeigt sich auf der Höhe seines Denkens und Schaffens. Er wird wohl noch so manch weiteren metaphorischen und echten Berg besteigen.