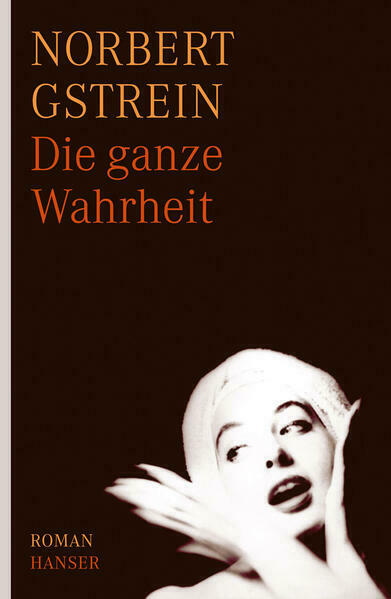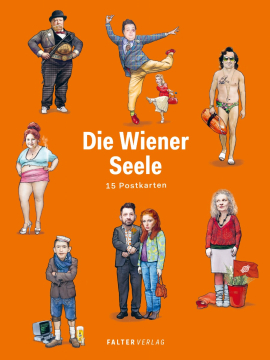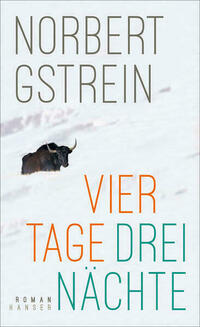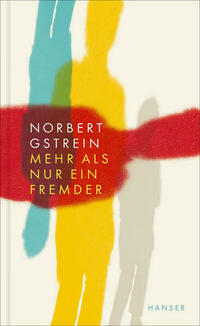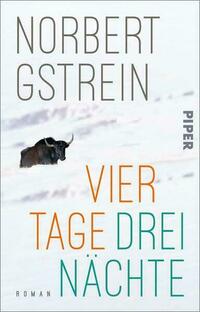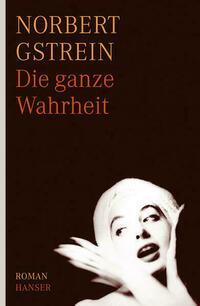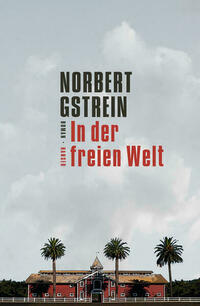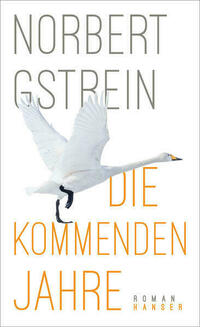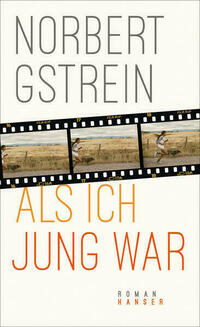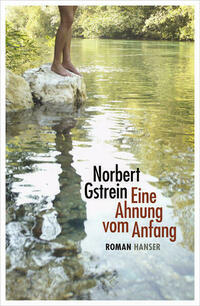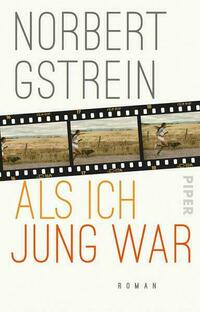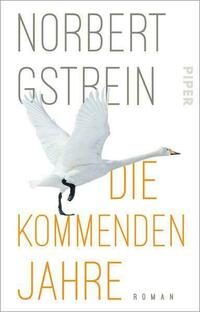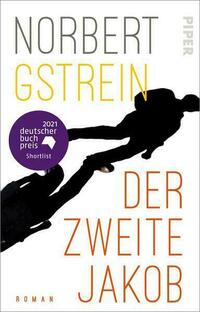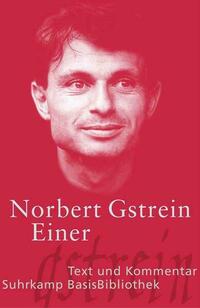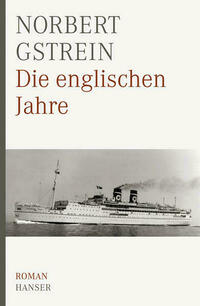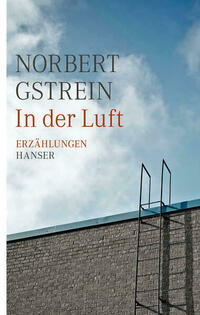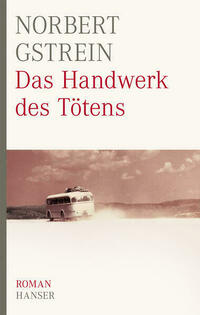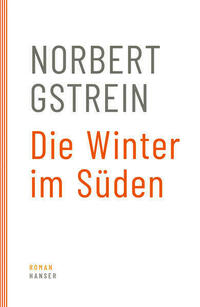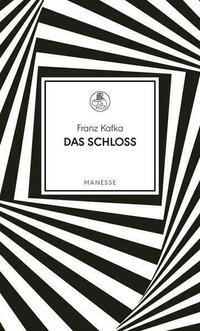Lakai gegen Schnepfe: Das ist Brutalität
Julia Kospach in FALTER 33/2010 vom 18.08.2010 (S. 29)
In seinem neuen Roman "Die ganze Wahrheit" betreibt Norbert Gstrein fruchtloses Verlegerwitwen-Bashing
Norbert Gstrein, heißt es, sei gewarnt worden, diesen Roman zu schreiben. Er selbst hat sein Buch im Vorfeld als "Prosa mit schwerem Wirklichkeitsgewicht" bezeichnet und bei einer Vorpräsentation in Berlin vor einigen Wochen davon gesprochen, dass es eine "Konstellation" beschreibe, die "an eine Konstellation im Suhrkamp Verlag erinnert".
Nein, er befürchte keine Klagen, und ja, er halte seinen Roman tatsächlich für einen Roman und fühle sich dadurch ausreichend abgesichert. Er vertraue der Macht der Fiktion und bediene sich gleichzeitig der Realität als Material.
So weit, so vieldeutig. Gstreins neuer Roman heißt unübersehbar ironisch "Die ganze Wahrheit", und wenn er jetzt, Mitte August, erscheint, eilt ihm schon seit einiger Zeit der Ruf eines Literaturskandals mit Ansage voraus. Denn das Buch wird unvermeidlich als Schlüsselroman über Ulla Unseld-Berkéwicz, die Suhrkamp-Verlegerin und Witwe von Siegfried Unseld, gelesen werden – und gewiss auch als Abrechnung des ehemaligen Suhrkamp-Autors und Siegfried-Unseld-Intimus mit der Witwe seines Verlegers, die seit dem Tod ihres Mannes 2002 im Flaggschiff des deutschsprachigen Verlagswesens keinen Stein auf dem anderen gelassen hat.
Gstrein ist nur einer von einer ganzen Zahl renommierter Suhrkamp-Autoren, die in den Jahren nach Siegfried Unselds Tod – enttäuscht, erzürnt oder geschasst – den Verlag verließen; ebenso wie einige wesentliche Mitarbeiter des Hauses.
Der Verlag, den Gstrein für seinen Roman erfunden hat, sitzt nicht in Frankfurt, sondern in Wien. Seine Bedeutung für die deutschsprachige Literatur ist mehr als überschaubar, seine Erfolge erschöpfen sich in der Entdeckung der katholisch-mystischen Lyrik einer jungen, im Selbstmord geendeten Tirolerin, die es zu sagenumwobenem Nischenruhm brachte.
Der Verleger, Heinrich Glück, ist ein in die Jahre gekommener, sympathischer Lebemann. Die Handvoll Mitarbeiter des Verlags arbeitet in gemütlicher, langjähriger Vertrautheit – allesamt finanziert durch die regelmäßigen Zuwendungen der reichen Exfrau des Verlegers. Der, der die Geschichte erzählt, heißt Wilfried und ist seit vielen Jahren Lektor des Verlags. Aber nicht nur das: Er ist auch Lakai, Zuträger, Betreuer, Chauffeur des Verlegers Heinrich Glück, ein kluges, willfähriges Mädchen für alles, das sich daneben so seine Gedanken macht. Dieser Wilfried erzählt im Rückblick, beginnend mit einem Zeitpunkt, als Heinrich Glück schon tot und er selbst seinen Job längst los ist.
Die Zentralfigur des Romans heißt Dagmar und ist Glücks sehr viel jüngere zweite Ehefrau. Sie schwingt sich nach dem Tod ihres Mannes zur Verlegerin auf und reißt sich alles unter den Nagel – vor allem die Erzählhoheit über das Sterben von Heinrich Glück, über das sie einen Roman schreibt.
Als Wilfried sich weigert, das esoterisch unterfütterte, sexuell aufgeladene Machwerk der Witwe zu lektorieren, wird er gefeuert und beschließt, dem Sterbebuch der Witwe ein Lebensbuch, gleichsam eine Biografie Heinrich Glücks gegenüberzustellen.
Gstreins Verlegerwitwe Dagmar ist eine üble, dumme Figur, der Paranoia und dem Alkohol zugeneigt, eine Freundin schlüpfriger Anspielungen, unbeherrscht und herrisch, angetrieben von einer starken Neigung zu Esoterik und Mystik, englischen Kornkreisen und Ufos. Sie faselt von Licht und Teufel, Todesnähe und Kabbala, fantasiert sich eine jüdische Großmutter herbei, redet dem übelsten Antiamerikanismus das Wort und neigt zu schwülstigen und pathetischen öffentlichen Auftritten.
Und sie schreibt. Auch das in unerträglicher Schwülstigkeit. Billige Charmeurin und Witzfigur in einem, durchschaubar und lächerlich, vor allem aber eines: hochgradig uninteressant. Gstrein hat ihr alle Klischeebilder und Gerüchte umgehängt, die so oder ähnlich in den letzten Jahren auch über Ulla Berkéwicz die Runde machten, inklusive eines klagwütigen persönlichen Anwalts, der in ihrem Namen um sich schlägt.
Sicher geht es Gstrein um das Spannungsverhältnis zwischen Literatur und Realität, das sich gerade am Fall Suhrkamp so wunderbar durchexerzieren lässt und im Zuge dessen aus einer mittelmäßigen Schriftstellerin und noch mittelmäßigeren Verlagsleiterin jene schwarze Witwe und Personifizierung des Monströsen werden konnte, als die Ulla Berkéwicz jahrelang durch die Feuilletons geisterte – zuletzt als der Suhrkamp-Verlag von Frankfurt nach Berlin zog.
Das allein war bereits erstaunlich und
zuletzt auch wirklich schon langweilig, doch ging es dabei wenigstens um den Niedergang des großen Suhrkamp-Verlags. Gstreins ins Wiener Milieu rund um einen unbedeutenden Kleinverlag verlegte Geschichte geht schon gar nicht auf. Wieso 300 Seiten lesen über eine überspannte, exaltierte Figur, die Gstrein auch noch mit Attributen und Adjektiven zuschüttet?
Dazu kommt, dass Gstrein seinen Erzähler sich in Andeutungen und Ankündigungen von kommenden Schreckensszenen ergehen lässt ("aber nichts bereitete mich auf die Szene vor, auf die ich stoßen sollte"), denen gegenüber die gemeinten Vorgänge stets an Dramatik nachhinken.
Das macht müde, genauso wie Wilfrieds Rundumschläge gegen "Jubel-Steirer und Hurra-Tiroler" genannte willfährige Literaturkritiker, durchgeknallte Eso-Jünger, die Wiener Promiszene oder Lebenserinnerungen schreibende Politiker.
Ein wadlbeißender, mutloser Lakai gegen eine überdrehte Verlegerinnenschnepfe – man kommt an den Punkt, an dem man findet, dass die beiden einander verdient haben, und an dem man sich fragt, warum ein Autor wie Gstrein dem ganzen Sujet so viele Gedanken und Sätze widmet. Und man hofft, dass Gstreins Absicht tatsächlich nicht das Ulla-Bashing war, nach dem es aussieht. Eine Siegfried-Verteidigung ist es schon gar nicht.