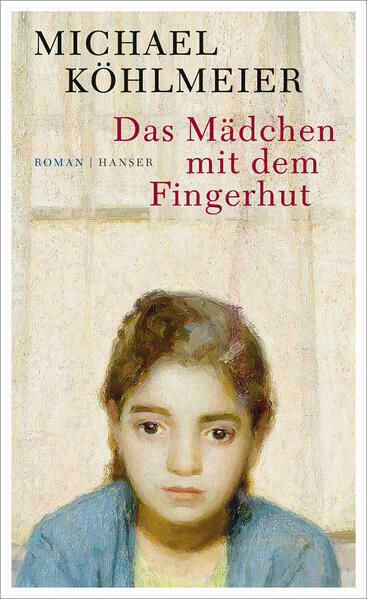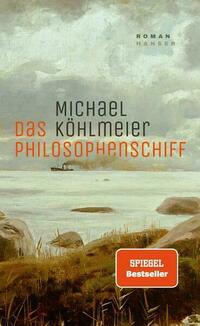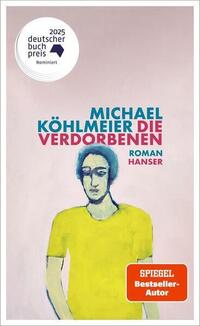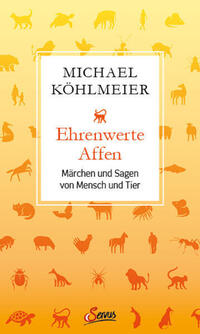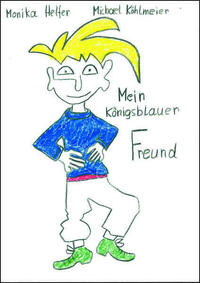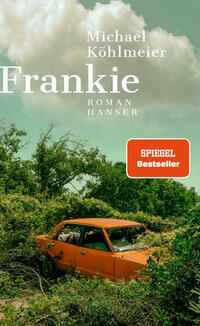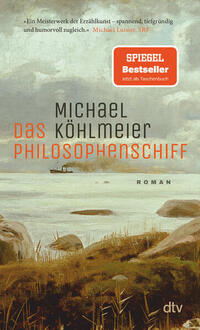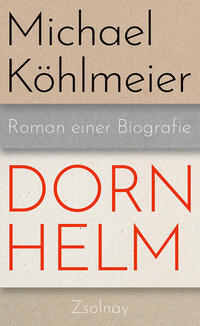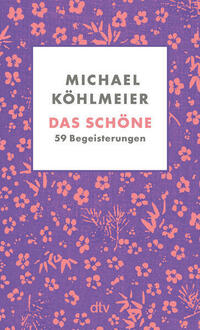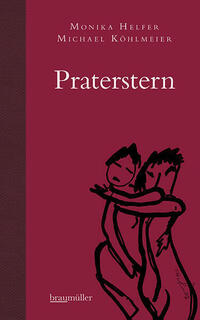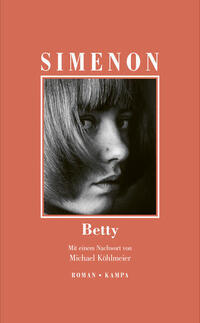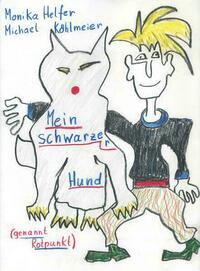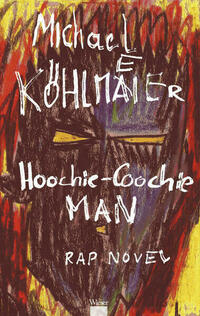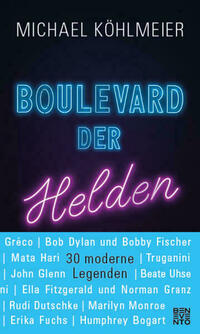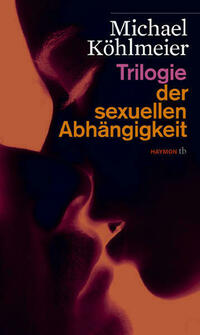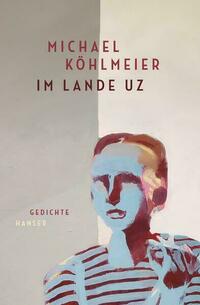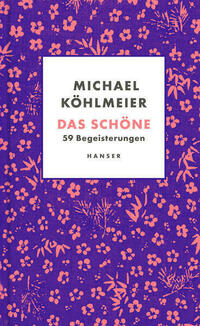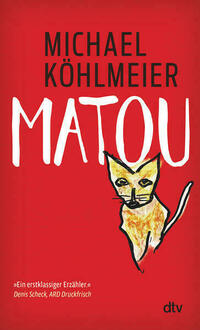Der mitleidigste Mensch ist nicht der beste
Klaus Nüchtern in FALTER 6/2016 vom 10.02.2016 (S. 30)
Wie schnell kann die Kunst auf aktuelle politische Ereignisse reagieren und inwieweit ist das überhaupt ihre Aufgabe? Die jüngsten Romane von Abbas Khider und Michael Köhlmeier behandeln die Flüchtlingsfrage aus Sicht der Betroffenen
LEKTÜRE:
KLAUS NÜCHTERN
Literatur kann viel falsch machen. In Hinblick auf die „brennenden Fragen“ zum Beispiel. Lässt sie sich Zeit mit dem, was man gerne „Aufarbeitung“ nennt, riskiert sie den Vorwurf, weltfremd zu sein; reagiert sie prompt, setzt sie sich dem Verdacht aus, auf Verkaufszahlen zu schielen oder gar das Leid anderer Leute zu missbrauchen, um daraus ästhetisches und, ja, auch pekuniäres Kapital zu schlagen.
Es wäre zynisch, hier von einem „Totschlagargument“ zu sprechen. Der Sache indes ist die fragwürdige Formulierung nicht so fern: „Die sogenannte künstlerische Gestaltung des nackten körperlichen Schmerzens der mit Gewehrkolben Niedergeknüppelten enthält, sei’s noch so entfernt, das Potential, Genuß herauszupressen. Die Moral, die der Kunst gebietet, es keine Sekunde zu vergessen, schliddert in den Abgrund ihres Gegenteils.“
Das hat Theodor W. Adorno in seinem berühmten „Engagement“-Essay sogar noch gegen den von ihm verehrten Arnold Schönberg und dessen Komposition „Ein Überlebender aus Warschau“ geltend gemacht. Schönbergs Opus 46, das die Niederschlagung des Aufstands im Warschauer Getto von 1943 zum Thema hat, wurde 1947 komponiert und ein Jahr später uraufgeführt. Eine „Verzögerungsfrist“ von einigen Jahren scheint der Normalfall zu sein. Die einschlägigen 9/11-Romane von Jonathan Safran Foer, John Updike oder Don DeLillo etwa kamen in den Jahren 2005 bis 2007 heraus.
Wer mit den Produktionsrhythmen der Buchbranche vertraut ist, weiß, dass es fast unmöglich, jedenfalls ausgesprochen selten ist, ganz unmittelbar auf aktuelle Ereignisse zu reagieren. Mitunter erscheinen Bücher aber auch zufällig gerade im richtigen Moment. So geschehen im Falle von Jenny Erpenbecks Roman „Gehen, ging, gegangen“, der im August vergangenen Jahres herauskam. Er handelt von der Empathie eines emeritierten Professors mit afrikanischen Asylsuchenden in Berlin und wurde durchaus unterschiedlich wahrgenommen: Erschien er den einen als „brandaktuell“ und als wertvoller und reflektierter Beitrag zur „Flüchtlingsdebatte“, so kritisierten andere dessen mangelnde Komplexität oder ungelenke Sprache.
Tatsächlich tendieren Rezensenten und Publikum dazu, angesichts verbürgter Triftigkeit der Thematik das kritische Besteck in der Lade zu lassen. „Ohrfeige“, der jüngste Roman von Abbas Khider, steht schon mit seinem Erscheinen auf der Bestenliste des SWR. Dass er dort hingehört, sei bezweifelt, dass er die laufende Debatte bereichert, nicht in Abrede gestellt.
Der Titel verweist auf den Einstieg in den Roman und darf durchaus als Schlag ins Gesicht deutscher Selbstgefälligkeit und Indolenz verstanden werden. Verkörpert wird diese von einer gewissen Frau Schulz. Sie wird der Ich-Erzähler, ein junger, aus dem Irak geflüchteter Mann namens Karim Mensy, der um die letzte Jahrtausendwende auf seinen Asylbescheid wartet, schon im ersten Satz ordentlich maulschelliert haben. Anschließend fesselt er Frau Schulz an ihren „teuren schwarzen Lederstuhl“, verklebt ihr den Mund, um ihr für den Rest des Romans – auf Arabisch! – sein Leben zu erzählen: „Sie wissen ganz genau, wer ich bin. Ich bin einer der vielen, deren Akten Sie gelesen und bearbeitet haben, um sie wieder abzulegen. (…) Für Sie war ich wohl Asylant 3873 oder so.“
Für seinen Protagonisten hat sich Khider, der unter Saddam Hussein mehrmals verhaftet und von dessen Schergen gefoltert wurde, einen weniger wasserdichten und heroischen Fluchtgrund ausgedacht: Im Irak läuft Karim Gefahr, zum Militär eingezogen zu werden. Außerdem leidet er unter einer Gynäkomastie, sprich, ihm sind während der Pubertät Brüste gewachsen, was sich durch einen chirurgischen Eingriff korrigieren ließe, der auf 6000 Euro veranschlagt wird: „Als der Arzt mir das sagte, traf mich die Zahl wie ein Keulenschlag.“
Die Vergleiche und Metaphern, die der Erzähler mit großzügiger Hand ausstreut, treffen den Leser wie ein Teller kalter Köfte. Der Busen von Karims Angebeteter im Irak ist „rund und mystisch wie die Kuppel einer wunderschönen Moschee“, ihre Haare erinnern „an die Mähne eines spanischen Pferdes“, „ihre winzige Nase glich der von Biene Maja“. Dafür zittern Karims „kräftige Pobacken wie die einer Samba-Tänzerin“, sobald diesen die „boshafte europäische Eiseskälte“ anfällt „wie ein Ungeheuer“, und die Schneeflocken „wie ein Sandsturm“ über die bayerische Landschaft fegen, um diese in „eine käsigweiße Leiche“ zu verwandeln. Ausmalen mag man sich das alles lieber nicht.
Khiders „Ohrfeige“ lappt immer wieder ins Groteske und setzt auf einen meist halblustigen Humor, kann aber einen durchgängigen Ton, der das Buch etwa als Schelmenroman ausweisen würde, nicht finden. Ohne Tempo und Ökonomie liefert es die nötigen Basisinfos und politische Allerweltskommentare mit der Verve eines viskosen Funkkollegs. „Die Ohrfeige“ zerfällt in eine Reihe von Episoden, die dort am überzeugendsten sind, wo sie ungeschönt die Gruppendynamik unter den Asylwerbern unterschiedlicher Herkunft oder den prekären, aber auch bleiern öden Alltag eines Lebens in der Warteposition beschreiben.
Knapper und konzeptuell konziser ist Michael Köhlmeiers jüngstes Buch geraten. Es wurde ebenfalls nicht aus unmittelbar aktuellem Anlass geschrieben, denn das Schicksal der sogenannten „Wolfskinder“, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Wälder des Baltikums schlagen mussten, beschäftigte den Autor schon seit längerem. Wie diese ist auch „Das Mädchen mit dem Fingerhut“, die sechsjährige Protagonistin des schmalen Romans, sehr bald auf sich alleine gestellt. Ihr Onkel, der sie täglich in die fremde Stadt bringt, mit strategischen Tipps versorgt – sofort losplärren, sobald das Wort „Polizei“ fällt! –, holt sie eines Tages nicht mehr ab.
Auf Freundlichkeit darf das Mädchen, das später behaupten wird, Yiza zu heißen, zählen, denn sie sieht lieb aus. Auch im Heim, in das sie schließlich kommt, verschaut sich die Schwester sofort in die Kleine, die indes sofort mit zwei älteren Buben, Arian und Schamhan, abhaut, von denen nur einer ihre Sprache spricht.
Köhlmeier hat sich entschieden, den Roman strikt aus der kindlichen Perspektive zu erzählen und braucht gerade deswegen nicht auf die Tränendrüse zu drücken. Kommentarlos und unsentimental konzentriert er sich auf den ganz in der Physis wurzelnden Pragmatismus seiner Protagonisten: Wo finde ich was zu essen, zu trinken, einen Platz zum Schlafen? Wie kriege ich meine Kleidung wieder trocken? Und wie bekomme ich beim Schnorren das meiste Geld zusammen? (Arians Antwort: die fremdländischen Augenbrauen verstecken!)
Fragwürdig wird die Entscheidung dort, wo sie eine etwas enervierende Umständlichkeit erzeugt, weil der Erzähler sich weigert, Informationen bereitzustellen, über die Yiza nicht verfügt. Diese trinkt daher keinen Orangen-, sondern „gelben Saft“. Ein paar Zeilen davor aber ist ganz selbstverständlich von „Artischocken“ die Rede. Ausgerechnet die sollten dem Mädchen bekannt sein?
Allerdings hat Köhlmeier dann doch kein hinreichend großes Vertrauen in sein eigenes Konzept und die Kompetenz seiner Leserinnen und Leser. Die hätten die Mitleidskritik wohl auch verstanden, wenn sie ihnen nicht abschließend noch fett als Botschaft serviert worden wäre.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: