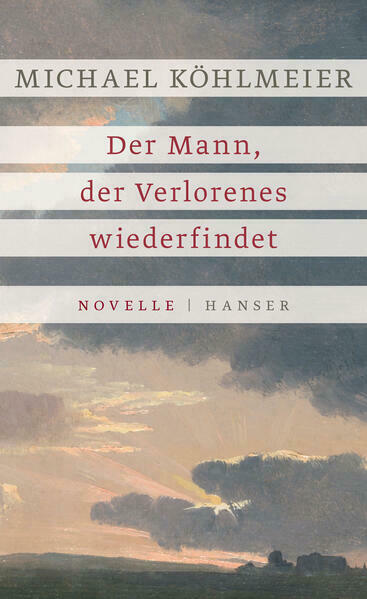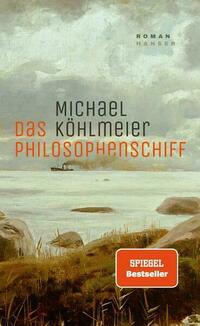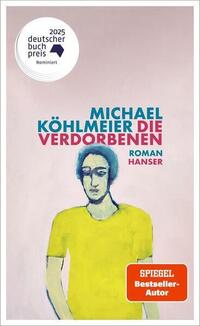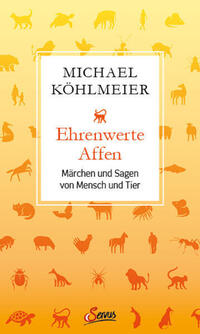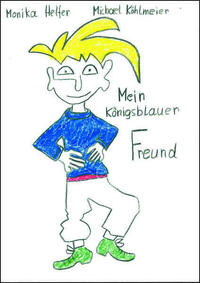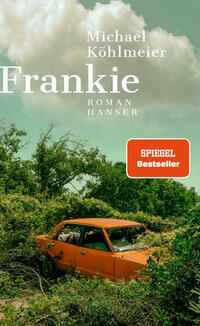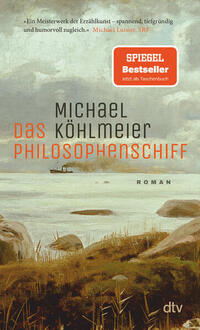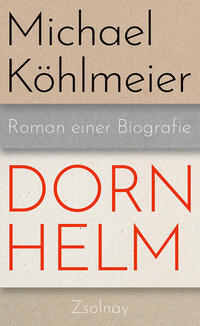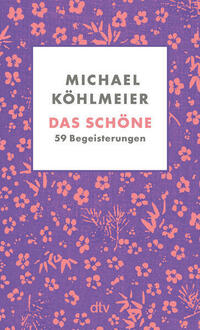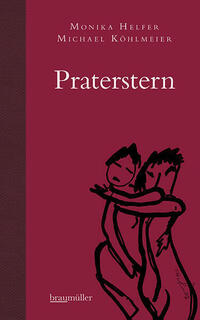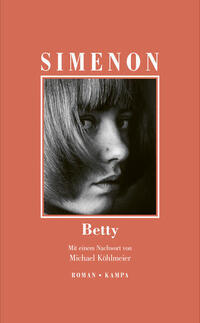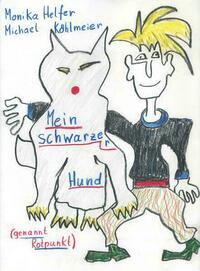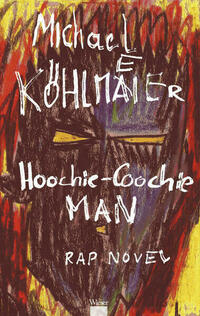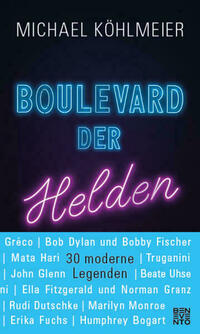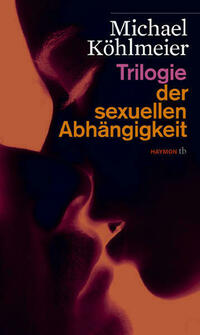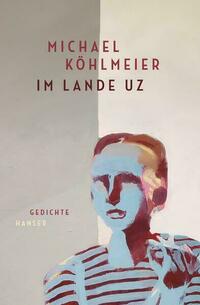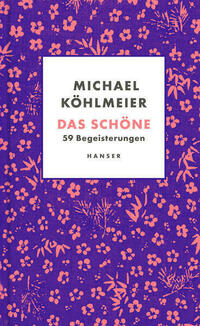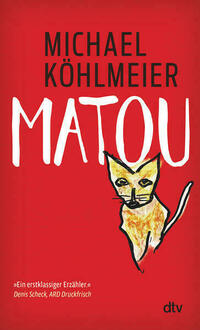Als das Wünschen auch nicht mehr half
Peter Strasser in FALTER 33/2017 vom 16.08.2017 (S. 25)
Neues aus der österreichischen Literatur: Michael Köhlmeiers stimmige Novelle über das Sterben des Heiligen Antonius
Um mit dem Offensichtlichen zu beginnen: Michael Köhlmeier gehört zu den bedeutenden lebenden Autoren deutscher Sprache. Er hat einen eigenen Schreibstil entwickelt, weil er, der begnadete Erzähler, es zuwege brachte, seine Leserschaft mit einem unverwechselbaren Ton leichthin zu belehren und zu faszinieren.
Tatsächlich ist ein wesentliches Charakteristikum der Erzählkunst Köhlmeiers das Unterhaltsame. In ihm zeigt sich, der dürren, sperrigen, verquälten deutschen Literaturgegenwart zum Trotz, ein großes Können, für das Köhlmeiers Leser – ungeachtet manch naserümpfender Kritik aus dem Feuilleton – dankbar sind. Und nun hat Köhlmeier den Heiligen Antonius, der mit seinen großartigen Predigten selbst ein genialer Erzähler Gottes war, zum Gegenstand einer Novelle gemacht.
Den meisten Kunstliebhabern ist Antonius als jener Heilige bekannt, den die Maler mit dem Jesuskind auf dem Arm darstellen. Das reale Vorbild – Franziskaner, zeitweilig Einsiedler bei Assisi, posthum zum Kirchenlehrer ernannt – wurde angeblich 1195 in Lissabon geboren und starb 1231 in Arcella bei Padua. Köhlmeier schildert das Sterben des Antonius, nachdem dieser vor dreitausend herbeigeeilten Gläubigen seine letzte Predigt halten wollte: gleichsam eine geistliche Speisung der Dreitausend. Doch wenn man als Heiliger stirbt und Köhlmeier zu seinem Chronisten hat, dann wird aus dem irdischen Ende der erinnerte Lebenskosmos eines schlichten, zweifelsinnigen, liebenswerten Diener Gottes.
In diesem Kosmos spielt das theologische Ringen um eine Antwort auf die letzten metaphysischen Fragen eine leitende Rolle. Es ist der grüblerische, durch spekulative Höhenflüge und skeptische Anfechtungen geadelte Geist des Antonius, kraft dessen den oftmals banalen, ja hässlichen Alltagsepisoden, ob profan, ob klösterlich, eine besondere Dignität zuwächst.
Wie Köhlmeier die Reflexionen des Antonius über das Böse, das Nichts und die Liebe Gottes in den Erzählfluss einflicht – das ergibt ein erstaunlich „stimmiges“ Szenario, als ob das Weltliche und das Sakrale, das Natürliche und das Übernatürliche gewaltlos auseinander hervor- und ineinander übergingen. Dabei spielt die sanfte Ironie des Misslingens, durch die der Autor das Tragische ersetzt oder abmildert, eine atmosphärisch entscheidende Rolle.
Auch Parodien symbolistischen Denkens finden sich, beispielsweise in der gelehrten Abhandlung der Frage, ob, wenn dem lichtlosen Nichts, dem Urbösen, die Farbe Schwarz zugeordnet sei, dann nicht doch eher von einem Grünschwarz die Rede sein müsste – man ist als Leser geneigt, hinzuzufügen: Weiß der Teufel, warum (und des Teufels Farbe war grün, nämlich „mohammedanisch“).
Müsste man eine Passage nennen, der die zentrale Botschaft der Novelle innewohnt, würde sich der Bericht des franziskanischen Klosterpriors anbieten, der vom todkranken Antonius Überraschendes erfahren hat.
Dieser Bericht enthält im Grunde Häretisches und wird im Tone größter Verehrung vor der Sacra Congregatio Pro Causis Sanctorum abgegeben. Ob das als Fingerzeig Köhlmeiers auf das „Überzeitliche“ seiner Geschichte zu verstehen ist? Die Heiligsprechungskommission wurde jedenfalls erst im späten 16. Jahrhundert durch Papst Sixtus V. etabliert, damals noch als Heilige Ritenkongregation:
„Was er wünsche, habe er Antonius gefragt. Er wünsche nichts, habe dieser ihm geantwortet. Sein ganzes Leben habe er gewünscht und gewünscht und gewünscht. Als wäre nicht genug, was ist. Ihm bange davor, dass wir Gott missverstanden haben. Was, wenn das Leben alles war, was er uns zu bieten hatte? Hätten wir das von Anfang an gewusst, wir wären anders damit umgegangen.“
Und dann der Satz, der auf die kardinalen Dinge – das Leben und den Tod – ein Licht wirft, das Köhlmeiers Liebe zur außerchristlichen Antike im Raum der Novelle aufblitzen lässt: „Gott ist der Gott der Gegenwart.“