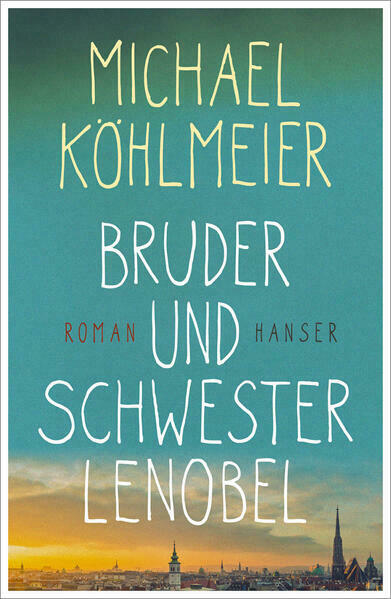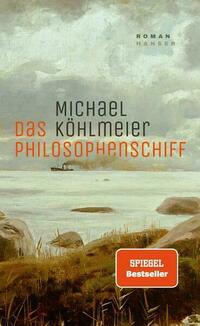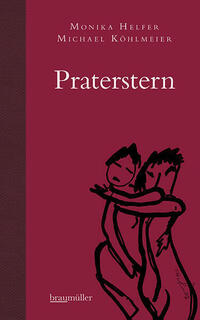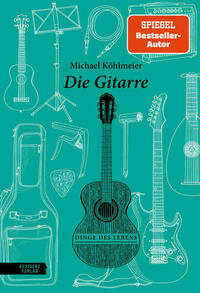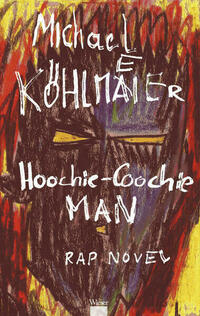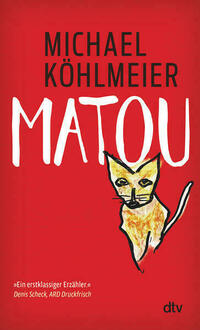Von gehäuteten Flöhen und tätowierten Schlüsseln
Stefanie Panzenböck in FALTER 34/2018 vom 22.08.2018 (S. 27)
Sein grandioses Familienepos „Bruder und Schwester Lenobel“ hat Michael Köhlmeier als verwirrendes Labyrinth angelegt
Es war einmal: Am Anfang von Michael Köhlmeiers neuem Roman steht ein Märchen. Ein König fing einen Floh und fütterte ihn, bis er riesengroß war. Dann schlachtete er ihn und hängte das Fell an das Stadttor. Wer erkennen sollte, um wessen Fell es sich handelte, würde seine Tochter zur Frau bekommen. Schließlich war es der Teufel selbst, der das Rätsel löste.
Dann beginnt die Geschichte der titelgebenden Geschwister Jetti und Robert Lenobel, von Roberts Frau Hanna und den Kindern des Paars. Der Freund der Familie, der Schriftsteller Sebastian Lukasser, ist Köhlmeier-Lesern schon länger bekannt, unter anderem als Erzähler des Opus magnum „Abendland“ (2008).
Köhlmeiers jüngster Roman dreht sich um eine Leerstelle. Der bekannte und angesehene Psychoanalytiker Robert Lenobel ist verschwunden. Er sei verrückt geworden, schreibt seine Frau ihrer Schwägerin in Dublin. Die nimmt das nächste Flugzeug nach Wien. Doch nach Aufgabe einer Vermisstenanzeige kümmert sich niemand mehr so recht um den Abgängigen.
Stattdessen liefert Roberts Abwesenheit den beiden Frauen den Anlass, alte Verletzungen, Verschmähungen, Sehnsüchte und Lieben an die Oberfläche zu holen und so das fragile Familienkonstrukt aus dem Gleichgewicht zu bringen. Bald meldet sich Robert bei Jetti: „Ich bin in Israel, dem Land der Väter. Aber an die Väter denke ich nicht.“
Hierauf folgt wieder ein Märchen, wie zu Beginn eines jeden der 13 Kapitel. Es sind brutale Geschichten von Eltern, die ihre Kinder schlachten wollen, oder einer Moorfrau, die sich ein Kännchen Blut wünscht, um ihre Haare zu färben.
Auf diesen beiden Ebenen erzählt Köhlmeier von Gott und dem Teufel, von Liebe und Hass, von der Familie und dem Wunsch, allein zu sein. Er führt seine Figuren in ein Labyrinth, ohne ihnen den Ausgang zu zeigen. Viele Fährten führen in Sackgassen, viele Konflikte bleiben ungelöst, viele der aufgeworfenen Fragen unbeantwortet. Aber in der kunstvoll aufbereiteten Unklarheit entfaltet sich Köhlmeiers unvergleichliche Fähigkeit zu erzählen. Vermeintlich Bedeutungslosem folgt man bereitwillig, um etwa dabei zu sein, als eine Frau aus dem fahrenden Volk der Pavee Jetti von einem tätowierten Schlüssel erzählt. Wie ist man hierhergekommen? Man weiß es nicht.
Die Geschichte von Robert und Jettis Familie ist einzigartig und doch eine Geschichte unserer Zeit. Die Großeltern mütterlicherseits wurden im Konzentrationslager von den Nazis ermordet, jene väterlicherseits töteten sich 1967 in Israel selbst. Die Mutter überlebte den Krieg in England, gründete in Wien eine Familie. Ihr Mann verließ sie, sie versank bald in einer Depression, die Geschwister waren früh auf sich allein gestellt. Robert heiratete Hanna, die er nicht liebt, Jetti hat Affäre um Affäre, immer mit der Hoffnung, dass etwas Besseres oder gar der Richtige nachkommen würde.
Immer wieder gelingt es dem Autor, mit wenigen Sätzen eine ganze Welt aufzuspannen: „Er verging vor ihr. Fragte, warum sie ihn so lange hingehalten habe. Ob sie ehrlich sein dürfe, fragte sie zurück. Sie habe erst noch seine Hilfe gebraucht beim Verkauf der Bilder. Das kam ihm so ungeheuerlich vor, dass er sich das Leben nehme wollte. Sie sagte, sie glaube ihm nicht. Sie hatte recht. Er kehrte zu seiner Frau zurück. Wenn die Magie nicht mehr funktioniert, bleibt von einem Mann nicht viel.“
Oder wenn Sebastian Lukasser über die Langeweile spricht: „Hinter diesem Allerweltswort lauert der Weltuntergang.“ Oder wenn Robert Lenobel in der Badewanne seinen Gedanken nachhängt: „Wer bin ich? Wenn sich ein Psychoanalytiker diese Frage stellt, müsste sein nächster Weg zu einem Waffenhändler sein …“
Michael Köhlmeier hat mit „Bruder und Schwester Lenobel“ erneut ein grandioses Familienepos geschaffen. Es ist ein Labyrinth des Lebens geworden. Jeder Umweg, jede neue Figur lädt zum Verweilen ein. Dass es möglicherweise einen Ausgang gibt, hat man bald vergessen. Man will bleiben, so lange wie möglich.