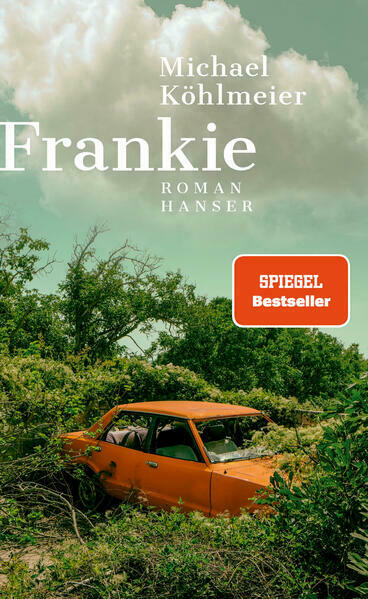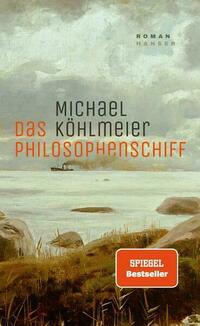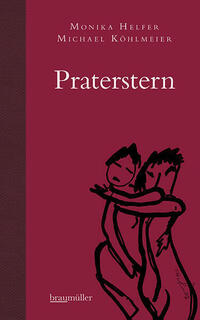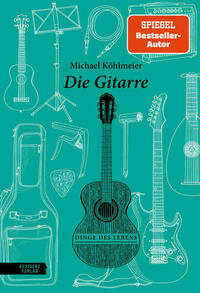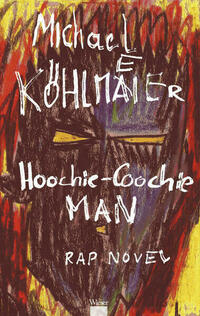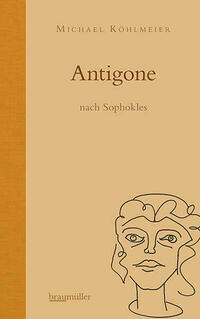Mein Opa, das Arschloch
Klaus Nüchtern in FALTER 5/2023 vom 01.02.2023 (S. 35)
Früher haben sich Menschen, die angeblich selbst einmal jung waren, das Maul über "die Jugend von heute" zerrissen. Mittlerweile gibt sich das Geraune über die Generation X, Y, Z oder Alpha einen soziologischen Anstrich und unerschütterlich informiert: Die schauen nicht mehr fern, lieben polyamorös, ernähren sich vegan und habe keine Ahnung von Beistrichsetzung. Letzteres stimmt auf jeden Fall.
Der Titelheld von Michael Köhlmeiers jüngstem Roman "Frankie" dürfte der Generation Alpha angehören. Er ist 14 Jahre alt und ein bisschen verhaltensauffällig: Echte Freunde scheint er keine zu haben, dafür schaut er gerne mit der Mama "Tatort" (vorzugsweise München) und kocht mit Fleisch (Erdäpfelgulasch mit Debrezinern und Frankfurtern). Außerdem sagt er nicht etwa "cooler Wagen", sondern "lässiges Auto". Hinsichtlich seiner Interpunktionskompetenz ist nichts bekannt.
Überhaupt fällt auf, wie wenig der Autor über seine Protagonisten preisgibt -neben Frankie und dessen alleinerziehender Mutter wären da noch deren neuer Freund, Frankies leiblicher Vater und vor allem der soeben aus dem Knast entlassene Opa. Warum der 18 Jahre lang gesessen hat, erfährt man nicht, und der Sohn, aus dessen Perspektive der Roman erzählt wird, behauptet zumindest, es gar nicht wissen zu wollen. Aber der hat ja -so unglaubwürdig das auch sein mag -sogar den Vornamen seines Vaters vergessen.
Der Großvater, so viel kriegt selbst der nicht eben von Neugier gepeinigte Enkel mit, heißt Ferdinand und wird einmal allen Ernstes "Nandi" genannt. Ansonsten ist er offensichtlich ein manipulatives Arschloch, das seinen Enkel "Fränki" nennt (was dieser hasst), ihn triezt und ihm brutal eine scheuert, als dieser ihm einmal blöd kommt.
Warum der toxische Opi d ennoch eine große Anziehungskraft auf Frankie ausübt, kann bündig mit "darum" beantwortet werden. Das dem Roman grundgelegte und vom Protagonisten formulierte Basistheorem lautet nämlich: "Wir tun etwas. Fertig." Die Gründe, die wir unserem Handeln unterstellen, sind bloß Fiktionen, die das ernüchternde Faktum verschleiern sollen, dass wir gar keine Motive haben.
An dieser These ist was dran, unbefriedigend bleibt sie nichtsdestotrotz, zumal sie ihrerseits als Begründung dafür herhalten muss, dermaßen viel nicht zu erzählen. In der Literaturwissenschaft galten sogenannte "Leerstellen" vor einem halben Jahrhundert einmal als der heißeste Scheiß. Den Leserinnen und Lesern, so die entsprechende Theorie, würden keine Botschaften vermittelt, sondern Informationslücken angeboten, welche diese produktiv aufzufüllen hätten.
An solchen "Leerstellen", man könnte auch sagen: an all jenen Dingen, die der notorische "gewöhnliche Leser" eigentlich sehr gerne erfahren würde, herrscht in "Frankie" wahrlich kein Mangel.
Was hat der Opa denn nun tatsächlich ausgefressen? Warum ist der Papa einst abgehauen und wieso taucht der plötzlich aus dem Nichts wieder auf? Wie weit ist es mit der vielbeschworenen Innigkeit zwischen der Mama und ihrem Buben her, wenn dieser den reuig tuenden Familienflüchtling derart haltlos für dessen ultrahotte Freundin und deren schnittigen Sportwagen bewundert?
Und kann es original wahr sein, dass die Pistole, die der Opa dem Enkerl aufgedrängt hat -es ist übrigens eine Miss Raven MP 25 Mouse Gun Saturday Night Special -, bereits auf Seite 130 losgeht?
Fragen über Fragen, aber keine Antworten. Stattdessen werden belanglose Vorgänge und Details breit ausgeschildert und Frankie denkt viel darüber nach, worüber er als 14-Jähriger eigentlich nachzudenken hätte. Es sieht fast so aus, als habe Köhlmeier, dieser natural born narrator, diesmal aufs Erzählen vergessen.