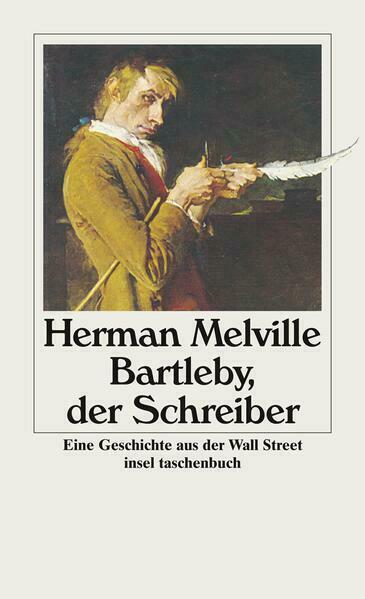Mann im Schlafrock
Klaus Nüchtern in FALTER 13/2020 vom 25.03.2020 (S. 45)
Quarantäne kennt keine Krawatte, das Home-Office keinen Dresscode. Eine kleine Phänomenologie stilvoller Selbstverwahrlosung
Du läufst im Morgenrock herum, ziehst dich zum Essen nicht mal um, dein Haar, da baumeln kreuz und quer die Lockenwickler hin und her …“. Charles Aznavours Desillusionschanson „Du lässt dich geh’n“ richtet sich an eine Frau, aber die beschriebenen Symptome schleichender Selbstverwahrlosung sind kein weibliches Privileg, eher im Gegenteil.
„Hod dea ka Oide, de wos auf eam schaud?“, lautet der Wienerische Mustersatz, der den Anblick meist schon etwas älterer Herren begleitet, die es mit der Körperpflege nicht mehr so genau nehmen und die Flecken auf Hemd und Hose – im schlimmsten Falle: vorsätzlich – ignorieren.
In Zeiten, in denen es keine Businessmeetings mehr gibt, liegen die Verlockungen vorsätzlicher vestimentärer Verwahrlosung im Home-Office nahe: Für die Videokonferenz mag man schnell in ein Hemd schlüpfen, die Pyjamahose aber behält man an, sieht ja keiner.
Selbstverwahrlosung ist kein Privileg des Alters. Die literarische Blaupause aller Männer, die sich gehen lassen, ist ein junger Herr, „ein Mann von zweiunddreißig, dreiunddreißig Jahren, mittelgroß und von angenehmem Äußeren“, wohnhaft in der Gorochowaja uliza, einer der belebtesten Hauptstraßen von Sankt Petersburg.
Die Rede ist von Ilja Iljitsch Oblomow, dem Protagonisten von Iwan Gontscharows 1859 erschienenem Roman gleichen Namens, der einer ganzen Lebensweise den Namen gab: der „Oblomowerei“.
Von Formen vorsätzlicher Faulenzerei unterscheidet sich diese durch den Umstand, dass sie alternativlos ist: „Das Liegen war für Ilja Iljitsch keine Notwendigkeit wie für einen Kranken oder wie für jemanden, der schlafen möchte, es war auch keine Zufälligkeit, wie für einen, der erschöpft ist, und kein Genuss wie für einen Faulpelz: Es war sein Normalzustand.“
60 Seiten braucht Oblomow, um aus dem Bett zu kommen – und damit ist aller Aufwand, zu dem er fähig ist, auch schon geleistet. Das wichtigste Accessoire dieser Existenzweise ist ein ursprünglich prächtiger, bestens mit Oblomows sanften Zügen und verzärteltem Körper harmonierender, im Verlauf der Jahre aber immer fadenscheiniger werdender Hausrock: „Er trug einen Chalat aus persischem Stoff, einen echt orientalischen Chalat, ohne das geringste Zugeständnis an Europa, ohne Troddeln, ohne Samt, ohne Taille, der so geräumig war, dass sich selbst Oblomow zweimal in ihn einwickeln konnte.“
Unter den Anti-Helden der Antriebslosigkeit findet sich auf der anderen Seite des Atlantiks Oblomows um sechs Jahre älterer Bruder im Geiste. Herman Melvilles „Bartleby, der Schreiber“ versieht seine Kopistendienste in einer Anwaltskanzlei an der Wall Street und wehrt mit „sanftmütige[r] Unverschämtheit“ alle darüber hinausgehenden Tätigkeiten mit der sturheil wiederholten Phrase „I would prefer not to“ ab.
Der Erzähler, Bartlebys ehemaliger Chef, der diesen als „farblos ordentlich, mitleiderregend anständig, rettungslos verlassen“ beschreibt, schildert eine Zufallsbegegnung mit seinem Angestellten, als er vor dem sonntäglichen Kirchgang in die Kanzlei schauen will und dort zu seiner Bestürzung durch den Türspalt den „Geist Bartlebys“ gewahrt – „in Hemdsärmeln und sonst in einem merkwürdig zerlumpten Morgenrock“.
Während Oblomow in den eigenen vier Wänden versumpft, zieht Bartleby ins Büro seines Brötchengebers, der es nicht übers Herz bringt, ihn vor die Tür zu setzen. Was dann dessen Nachfolger besorgt; worauf Bartleby, der nun auch die Nahrungsaufnahme verweigert, in kurzer Zeit im Gefängnis zugrunde geht. In beiden Fällen veranschaulicht der traurige Zustand des Rocks auch den Verfall seines Trägers.
Retrospektiv lässt sich sagen, dass sowohl der Stubenhocker aus Sankt Petersburg als auch sein transatlantisches Pendant gegenüber allen kapitalistischen oder kollektivistischen Aufforderungen, die noch folgen sollten, resistent geblieben wäre. Als Heroen subversiver Verweigerung aber taugen beide nicht.
Oblomow würde heute schlicht als „depressiv“ diagnostiziert werden, und Bartleby ist weniger ein psychologisch definierter Charakter als eine Chiffre des Aus-dem-Leben-gefallen-Seins.
Er ist als Referenzfigur für „den lebenslangen Generalstreik“ denkbar ungeeignet – auch wenn genau diesen einige Künstler und Intellektuelle unter dem Kollektiv-Namen „Haus Bartleby“ vor einigen Jahren in einer Flugschrift gegen einen „kapitalistischen Wachstums- und Karrierefetisch“ ausriefen.
Wie sieht es eineinhalb Jahrhunderte später aus? Um die letzte Jahrtausendwende hatte der Mann im Schlafrock wieder Saison. In den Filmen „The Big Lebowski“ (1998) und „Wonder Boys“ (2000) indiziert dieses Kleidungsstück aber tatsächlich eine Form subversiven Trotzes, quasi: Verwahrlosung als Selbstermächtigung.
In der Eröffnungssequenz von „The Big Lebowski“ wird der Protagonist vom Erzähler als „Mann der Stunde“ – „he’s the man for his time and place, he fits right in there“ – eingeführt, während die Kamera auf ihn zoomt. Auf dem menschenleeren Gang eines Supermarkts steht der von Jeff Bridges verkörperte Titelheld vor dem Regal: Sonnenbrille, Bademantel, Schlabbershorts und Schlapfen. Das soeben von ihm geöffnete und beschnüffelte Tetra Pak enthält eine Mischung aus Milch und Schlagobers (Half & Half), unabkömmliche Ingredienz für die Herstellung jener Cocktails, die Jeffrey Lebowski, genannt „The Dude“, rund um die Uhr in sich und seinen Hotzenplotzbart gießt. Zu den anderen Teilen bestehen White Russians aus Wodka und mexikanischem Kaffeelikör (Kahlúa) und weisen exakt denselben schmutzigen Beige-Ton auf, in dem auch der Bademantel und die XXXL-Strickjacke gehalten sind, die The Dude die meiste Zeit über trägt.
Als „wahrscheinlich faulster Mann von Los Angeles County“ wird The Dude durch die Verwechslung mit einem Milliardär gleichen Namens als Philip Marlowe des Slackertums, der eigentlich nur eine ruhige Bowlingkugel schieben will, in einen grotesken Noir-Plot samt Porno-Produzent, feministischer Aktionskunst und einem Häuflein doofer Nazis verwickelt und erweist sich in seinen Very Baggy Pants als Pionier des Manspreading avant le lettre.
Mit „The Big Lebowski“ teilt „Wonder Boys“ (nach dem gleichnamigen, 1995 erschienenen Roman von Michael Chabon) leitmotivisch eingesetzte Bob-Dylan-Songs und den exzessiven Drogenkonsum des Protagonisten.
Darüber hinaus hat Grady Tripp (Michael Douglas) so viele Probleme am Hals, dass diese hier nur ansatzweise aufgezählt werden können: Der Creative-Writing-Professor ist seit geraumer Zeit den Nachfolger zu seinem Erfolgsroman „The Arsonist’s Daughter“ schuldig und hat ein Verhältnis mit Sara (Frances McDormand!), der Frau seines Uni-Rektors. Im Kofferraum seines Wagens befinden sich darüber hinaus des gehörnten Gatten Marilyn-Monroe-Memorabilia sowie dessen toter Hund, der von Tripps Lieblingsstudenten James (Toby McGuire) erschossen wurde.
Als sich die Ereignisse überstürzen und Tripp eines verregneten Morgens vor die Tür seines Hauses tritt, um Sara (Frances McDormand!!) gegenüberzutreten, tut er dies im rosafarbenen und reich ornamentierten Frotteebademantel seiner Ex.
Befänden wir uns in einer Screwball Comedy mit Cary Grant („Bringing Up Baby“), würden aus dieser Szene Funken des Drag-Humors geschlagen (entsprechende Neigungen Grants sind verbürgt).
Michael Douglas aber trotzt seinem Auftritt eine paradoxe Würde ab: Tripp verkörpert die Grandezza eines Mannes, der Haltung gerade dadurch gewinnt, dass er auf deren Zurschaustellung verzichtet – und den Zuseherinnen und Zusehern eine der kürzesten, aber schönsten Liebesszenen der jüngeren Filmgeschichte beschert (Frances McDormand!!!).
Wie die angeführten Beispiele belegen, kann es allerlei bedeuten, wenn Männer in Morgenmäntel schlüpfen. Und die Geschichte der maskulinen Aneignung dieses Kleidungsstückes ist ereignisoffen. In Zeiten von Home-Office und Quarantäne ist fix damit zu rechnen, dass uns The Dude und Professor Tripp demnächst auch bei Billa und Hofer begegnen.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen:
„Du bist nicht deines eigenen Glückes Schmied“
Gerlinde Pölsler in FALTER 43/2015 vom 21.10.2015 (S. 52)
Das Berliner Haus Bartleby kommt zum Elevate-Festival nach Graz. Ein Gespräch über ihr „Zentrum für Karriereverweigerung“ und das Kapitalismustribunal, das sie im Frühjahr in Wien abhalten
Eine Akademie der eleganten Faulheit, ein Ort der Verschwörung gegen die Düsternis unserer Zeit“: So beschreibt sich das „Haus Bartleby“. Gegründet haben es die Freunde Alix Faßmann, Jörg Petzold und Anselm Lenz im Berliner Bezirk Neukölln. Faßmann hatte früher, was man eine „Topkarriere“ nennt: Das einstige Arbeiterkind hatte gut bezahlte Anstellungen als Tageszeitungsjournalistin und zuletzt als Redakteurin für die SPD. Doch sie schmiss alles hin, tuckerte mit dem Wohnmobil durch Italien. Beim Job in einem Olivenhain lernte sie Anselm Lenz kennen, der als Theaterdramaturg genauso mit der Arbeitswelt haderte. Schließlich kam der Schauspieler Jörg Petzold dazu.
Der Name, Haus Bartleby, spielt auf die Erzählung „Bartleby, der Schreiber“ von Herman Melville (1853) an. Der Held verweigert irgendwann die Arbeit und sagt nur noch: „I would prefer not to“ („Ich möchte lieber nicht“). Von einem kleinen Hinterhof aus sowie über ihre unterhaltsame Homepage versammeln die Bartleby-Jünger nun Schriftsteller und Arbeiter, Erwerbslose und Ökonominnen um sich – und kiefeln an der Frage, was statt des Neoliberalismus kommen könnte. Im Frühjahr halten sie in Wien, unterstützt vom Club of Rome, das „Kapitalismustribunal“ ab. Schon diese Woche beehren sie Graz – beim Elevate-Festival (So, 18 Uhr, Dom im Berg).
Falter: Sie sagen, Arbeit, wie wir sie definieren, ist eine Krankheit. Warum das?
Haus Bartleby: Die alten Versprechen von Wohlstand und Unabhängigkeit durch Arbeit lösen sich nicht mehr ein. Wie jeder Mensch sehen und erleben kann, ist die Arbeit viel zu schlecht verteilt, zu unterschiedlich bezahlt und basiert auf vorsintflutlichen Abhängigkeitsverhältnissen. Immer weniger Menschen können sich die Frage zufriedenstellend beantworten, warum und für wen sie diese Arbeit machen, ob sie den Eigentümer überhaupt mögen oder welches Produkt sie da verkaufen sollen. Und vor allem: warum sie sich selbst verkaufen, sich selbst zu Ware machen müssen, damit sie die Miete bezahlen können. Das heißt aber nicht, dass wir die schwere Arbeit verachten, die viele Menschen jeden Tag ausüben. Einige von uns kennen solche Arbeiten sehr gut oder führen sie auch noch aus.
Ist es denn immer so krass? Gibt es nicht auch sinnvolle Lohnarbeit, die Spaß macht?
Haus Bartleby: Es gibt sinnvolle Arbeit. Doch viel zu häufig wird sie gar nicht bezahlt. Den Kapitalismus kann es ja nur deshalb geben, weil so viele Menschen unbezahlt die Grundlagen dafür schaffen. Das bemerken viele gar nicht, so als wäre es gottgegeben. Dabei sind die Spielregeln der Ökonomie menschengemacht.
Sie alle waren in Ihren alten Jobs erfolgreich, haben gut verdient. Was war trotzdem so unerträglich daran?
Haus Bartleby: Grundsätzlich sind wir keine Misanthropen, wir haben nicht jeden Tag schlechte Laune, sind gern mit anderen Menschen zusammen und sind ja auch in dieser Sekunde tätig. Trotzdem stellt sich die Frage, in welcher Systematik man sich wiederfindet, wem man dient, und ob man das möchte. Wir haben erlebt, dass Arbeit sinnlos wurde, haltlos, inhaltlich daneben oder auch bedrückend. Dabei geht es um Fakten: Das einzelne Auto ist ja eine tolle Erfindung. Aber soll ich wirklich ein solches Produkt verkaufen, das in der Masse den Planeten ruiniert? Soll ich ein Buch schreiben, das kein Mensch braucht? Dann die Politik. Wenn im Apparat einer Partei alles schiefliegt, was schiefliegen kann! In einem Kulturbetrieb wie einem großen Staatstheater wiederum stellt sich die Frage, warum auf Staatskosten ein dysfunktionales Großbürgertum bespaßt werden soll mit Inhalten, die in den seltensten Fällen ästhetisch oder künstlerisch noch zu ertragen sind. Da schreibt sich einfach in allen Fällen eine kapitalistische Nomenklatura die Geschichte ihres eigenen Versagens schön.
Aber was sollen all jene tun, die ohnehin keine Karriere haben, aber halt einfach weiterhackeln müssen, weil sie spätestens im übernächsten Monat die Miete nicht mehr zahlen könnten?
Haus Bartleby: Die Lösung fällt nicht vom Himmel, damit haben wir genauso zu tun. Zu kündigen ist sicher nicht für jeden Menschen gangbar. Dennoch ist es wert, dem wachsenden Unbehagen nachzugehen, Bestehendes zu hinterfragen. Verweigerung ist aber nur der Anfang. Es geht darum, sich mit anderen Menschen zu verbinden und dann wirksam zu werden.
Und Sie, wovon leben Sie jetzt?
Haus Bartleby: Wir arbeiten weiter als Journalisten, wo es halbwegs Sinn ergibt, jobben und machen ein paar Sachen, die wir nicht alle sagen müssen. Letztlich geht es nur noch darum, die wichtige Arbeit machen zu können. Das ist meistens allerdings absolut am prekären Limit. Also keine Sorge, wir machen keine Karriere mit Karriereverweigerung. Das meiste geschieht ehrenamtlich, und Haus Bartleby ist ein gemeinnütziger Verein. Trotzdem ist diese Arbeit die lukrativste, die wir derzeit machen möchten – in inhaltlicher, gesellschaftlicher und in gewisser Weise auch künstlerischer Hinsicht.
Frau Faßmann, als Sie ausgestiegen sind …
Haus Bartleby: Wir definieren uns nicht als Aussteigerinnen! Wir hauen nicht ab, sondern bleiben weiter mittendrin – in der Stadt. In den Städten entscheidet sich das Schicksal der Menschheit.
Gut, also: Als Sie durch Italien getuckert sind, nachdem Sie gekündigt hatten, hat die Angst Sie immer wieder eingeholt: „Ist das hier der Beginn eines verfehlten Lebens?“ Kommt die Angst immer noch vorbei?
Haus Bartleby: Die Angst ist kein Menetekel, die ist ganz normal und eine Triebfeder des Kapitalismus. Wahrscheinlich sogar die entscheidende. Insofern ist es nicht schön, dass so viele Menschen jetzt Angst vor vielen neuen Mitmenschen haben, denn das ist in einem erlernten Konkurrenzsystem ja die logische Folge. Die Antwort kann aber nicht allein Mitgefühl sein. Wir müssen jetzt beginnen, die Systematik des Kapitalismus zu erfassen. Wir leben nicht mehr in Demokratie und Freiheit, sondern unter Zwängen. Der Selbstbetrug, bis vor kurzem in der sogenannten Generation Y sehr verbreitet, muss ein Ende haben: Du bist nicht „deines eigenen Glückes Schmied“.
Und das bedingungslose Grundeinkommen, wäre das eine Lösung?
Haus Bartleby: Es wäre einerseits eine erhebliche Verbesserung für die armen Leute, andererseits ein Almosen für die Abgeschafften, das die Leute mit etwas mehr Waren ausrüstet, aber substanziell nichts ändert. Also im Zweifelsfall dafür! Aber es wäre nur der Anfang. Diese Ökonomie ist am Ende, so oder so. Der Kapitalismus ist pleite.
Sie versprechen: „Am Ende einer peinlichen Epoche werden wir ein neues Bauwerk errichten.“ Aber wie soll das ausschauen?
Haus Bartleby: Wenn Sie uns so salopp fragen, dann … antworten wir einfach mal so: das eine hiervon, das andere davon! Beim Eigentumsproblem hatten die Marxisten schon immer recht: Es kann nicht sein, dass wenigen so viel gehört, den anderen gar nichts – das erzeugt Abhängigkeit und verschärft die undemokratischen Zustände immer weiter. Bei der Unabhängigkeit der Justiz haben sich die Liberalen als überlegen erwiesen – faire Verfahren mit einer unideologischen Abwägung der Argumente. Ökologische Analysen finden sich eher in der „grünen Wissenschaft“, auch wenn sie keine Lösungen bereithalten. Und die Sozialdemokratie hatte es schon immer drauf, zwischen Menschen verbindlich zu wirken. Das Talent sollte eingesetzt werden in der Errichtung gemeinschaftlich genutzter Orte, Seniorentreffs und Klohäuschen, aber nicht in der Exekutive. Und schließlich: Der freie Markt ist ungeheuer kreativ, das ist ein anarchistisches Moment. Aber eben im kleinen Maßstab, im Handwerk, in der Kunst, in kleinen Herstellungsbetrieben. Im großen Maßstab ist der freie Markt tödlich – und das massenhaft.
Sie sagen, die Leute wollten von Ihnen eine Anleitung: „Was muss ich jetzt machen?“
Haus Bartleby: Eine vollständige „Anleitung zur Karriereverweigerung“ kann es nicht geben. Aber es ergibt Sinn, sich überhaupt erstmal auszutauschen. Viele verschweigen ja ihr Unbehagen oder glauben, alles sei ein psychologisches Problem, sie seien schuld an ihrer Armut. An ökonomischer wie geistiger, der Fantasielosigkeit, die sich in abhängiger Beschäftigung ja wahnsinnig schnell einstellt. Sind sie nicht. Sprecht darüber, sprecht über Geld und Abhängigkeiten! Gründet Gewerkschaften und Betriebsräte im Internet, als Facebook-Gruppen und abends an der Bar. Das ist ein erster Schritt!
Auf capitalismtribunal.org kann jeder Mensch ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen des Kapitalismus aufzeigen und Anklage erheben. Im Frühling wird in Wien ein Tribunal darüber abgehalten. Wie wird das ablaufen?
Haus Bartleby: Das Kapitalismustribunal ist ein zivilgesellschaftlicher Gerichtshof. Wir arbeiten dafür von Anfang an zusammen mit dem Club of Rome. Inzwischen sind auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Heinrich-Böll-Stiftung und viele andere große und kleine Partner dabei. Die Ausgangsfrage lautet: Ist der Kapitalismus ein Verbrechen? Der freie Gerichtshof wird in einem fairen Verfahren die Argumente mit Rede, Gegenrede, Zeugen und Beweisen einer Beurteilung zuführen.
Sie veröffentlichen alle Anklagen außer etwa rassistische oder sexistische, so das Statut. In einigen findet sich aber sehr wohl Fremdenfeindliches, etwa: „Überfremdung steigt.“ Jemand anderer wünscht die „Bundesregierung geschlossen in Untersuchungshaft“, weil Deutschland eine „Diktatur“ sei. Manches könnte von Pegida kommen. Bringt uns das wirklich weiter?
Haus Bartleby: Abgelehnt werden können Klagen eben nur, wenn sie explizit die Statuten verletzen. Die Klagen werden dann systematisiert, das Kapitalismustribunal ist also auch eine Art Pädagogium. Und nicht jede Anklage muss zutreffend sein, sonst wäre es ja kein faires Verfahren!
Und was soll am Ende rauskommen?
Haus Bartleby: Zu ermitteln, was in einer künftigen Ökonomie nie wieder geschehen darf. Die Grundsatzurteile finden dann Eingang in die „Wiener Deklaration – Neue Erklärung der Menschen- und Zukunftsrechte“, von deren unmittelbarer Gültigkeit wir ausgehen. Das Kapitalismustribunal ist ein großes Thema, und für viele Menschen in der Postmoderne ist ja schwerlich zu erfassen, dass Menschen überhaupt einmal etwas ernst meinen. Und es auch mit so vielen anderen zusammen durchziehen.
Aber auch wenn Sie es ernst meinen: Ihre „Verurteilten“ gehen trotzdem straffrei aus …
Haus Bartleby: Die Todesstrafe bleibt abgeschafft! In einem fairen, zivilgesellschaftlichen Verfahren geht es eben genau darum, Galgen und Guillotinen in der Garage zu lassen. Wir können die Antworten auf die Frage, wie eine künftige ökonomische Vereinbarung gültig wird, einfach nicht mehr der europäischen Berufspolitik und Konzernlobbyisten überlassen. Alex Stefes vom Club of Rome sagte in seiner Rede bei der zweiten Vorverhandlung: „Dies wird die friedlichste Revolution aller Zeiten!“
Mit Ihrem Namenspatron, Mister Bartleby, hat es kein gutes Ende genommen: Er ist im Kerker verhungert. Keine Angst, dass das ein schlechtes Omen sein könnte?
Haus Bartleby: Nein, die wunderbare Geschichte ist ja fiktiv. Und so viel Vertrauen haben wir schon, zu glauben, dass man gesellschaftlich bemerkt, was wir hier leisten. Am Bartleby in Melvilles Erzählung interessiert uns die Kraft der Verweigerung gegenüber der Sinnlosigkeit. Und die analytische Kraft, mit der Melville den industrialisierten und bürokratisierend-verschleierten Kapitalismus sichtbar macht, dessen Wirkung ja bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wahrnehmbar wurde. Außerdem wollen wir Melvilles Geschichte in gewisser Weise fortschreiben. Was wäre, wenn man Bartlebys Gründe genau gekannt und er sich mit vielen anderen verbündet hätte?
Warum heißt Ihr Hund Anwalt? Brauchen Sie einen?
Haus Bartleby: Er hatte den Namen schon im Tierheim. Anwalt ist ein wohlwollender und gemütlicher Charakter. Er geht gern spazieren, ansonsten döst er ausgiebig. Mit dem kann wirklich jeder gut auskommen.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: