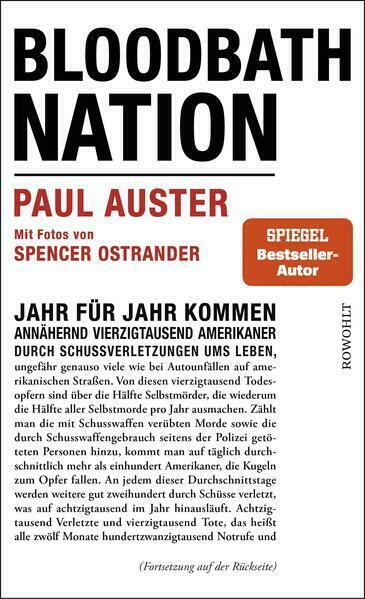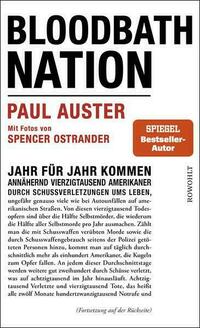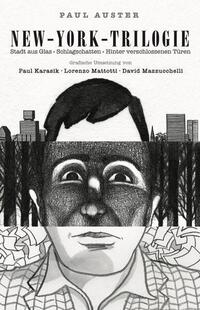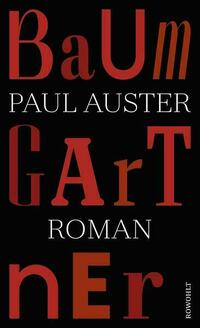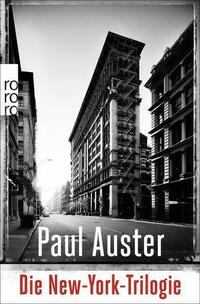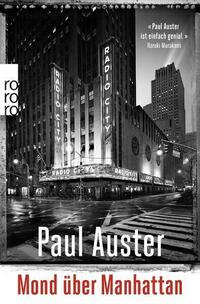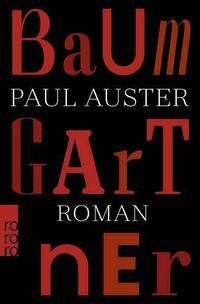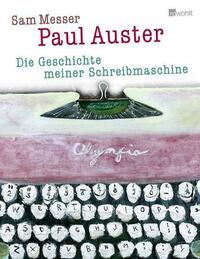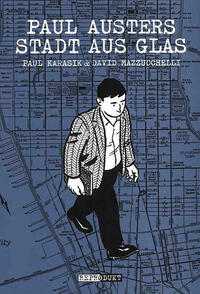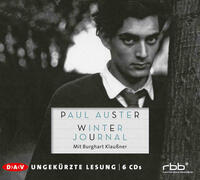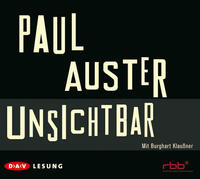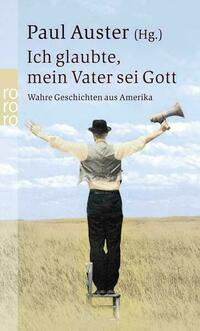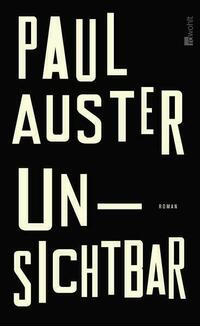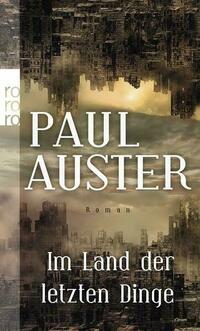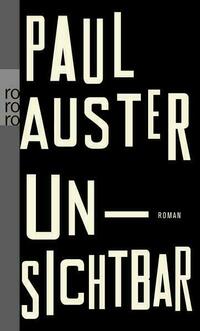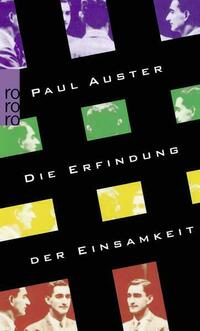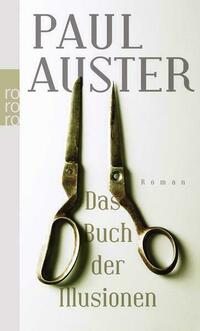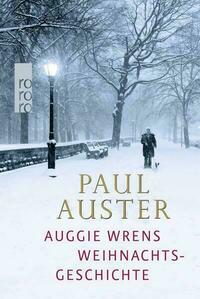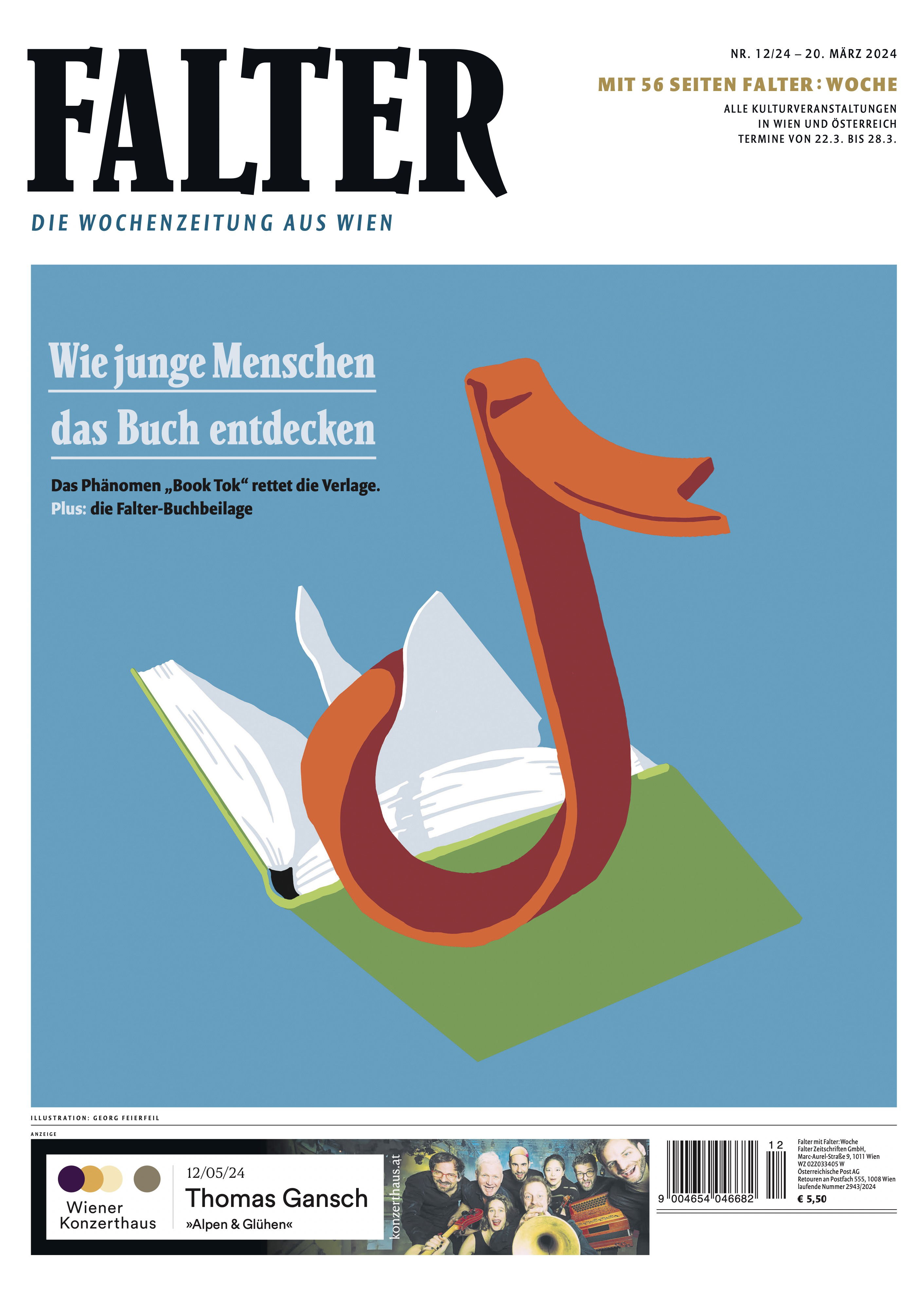
Das waffengewaltigste Land des Westens
Andreas Kremla in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 31)
Das Bild des Grauens zeigt eine Wiese in Oregon mit drei Bäumen. Das Umpqua Community College, das darauf stand, wurde abgerissen, nachdem ein Student zehn Menschen erschossen hatte. Bilder der Leere wechseln mit Texten über Kugeln und deren blutige Folgen. Paul Auster, einer der größten Gegenwartsautoren der USA, schreibt über den Schusswaffengebrauch der Amerikaner. Spencer Ostrander hat die Orte fotografiert, an denen diese Blutbäder angerichtet haben – nachdem alle Spuren beseitigt sind. Der junge Fotograf scheint die Vorliebe des alten Autors für einfache, eindringliche Bilder zu teilen. Einen ganzen Bildband hat er über den Times Square im Regen fotografiert. Auch mit Auster selbst hat er schon zuvor gearbeitet („Long Live King Kobe: Following the Murder of Tyler Kobe Nichols“ über einen jungen Mann, der an einem Heiligen Abend auf der Straße niedergestochen wurde).
Über nordamerikanische Sitten und Gebräuche hat Auster in seinen Romanen schon oft geschrieben. Deren Leser finden hier erstaunlich viel autobiografischen Hintergrund zu wiederkehrenden Themen wie Baseball, Basketball und anwesend-abwesenden Vätern. Über Waffen äußerte er sich in seinem belletristischen Werk bisher selten. Nun betrachtet er das heiße Thema essayistisch von allen Seiten. Er erinnert sich an ein Erlebnis in seiner Jugend beim Tontaubenschießen und an nahezu euphorische Emotionen: „Dieses Gefühl, mit etwas oder jemand weit Entferntem verbunden zu sein, einen Ball werfen oder eine Kugel abfeuern und ins Schwarze treffen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen […]“.
Dysphorisch stimmen die Zahlen und Fakten, die er gesammelt hat: Das Risiko eines US-Amerikaners, angeschossen zu werden, liege 25-mal höher als in anderen „hoch entwickelt genannten“ Ländern. Über 100 Menschen werden in diesem Land, das über mehr Schusswaffen als Einwohner:innen verfügt, an einem durchschnittlichen Tag erschossen. Das sind in etwa gleich viele, wie durch Autounfälle ums Leben kommen, laut Auster kein zufälliger Zusammenhang: „Autos und Schusswaffen sind die zwei tragenden Säulen unseres nationalen Mythos, denn Auto und Schusswaffe stehen für Freiheit und individuelle Selbstermächtigung.“
In diesem großen Essay stellt Paul Auster nicht nur die gegenwärtige Realität in den USA dar, sondern auch deren Entwicklung zum „gewalttätigsten Land der westlichen Welt“: von der Selbstverteidigung der ersten Siedler über die Gemetzel an der indigenen Bevölkerung und die mit vielen Waffen erkämpfte Unabhängigkeit bis zum Höhenflug der NRA, der National Rifle Association. Bei dieser Erklärung des „Woher?“ erstaunt er mit historischen Querverbindungen: So seien die amerikanischen Polizeieinheiten aus den „Sklavenstreifen“, die entflohene Leibeigene brutal zurückholten, entstanden. Die in manchen Bundesstaaten mit wehenden Konföderiertenflaggen gepflegte Südstaatenglorifizierung vergleicht Auster mit offen zur Schau getragener Nazi-Nostalgie.
Noch überraschender wird es beim „Wohin?“: Die Sammlung schockierender statistischer Superlative; die herzzerreißenden Einzelschicksale wie jenes der Überlebenden eines Massakers in Las Vegas, die im Jahr darauf gezielt vom nächsten Amokläufer niedergemetzelt wurden; die höchst kritischen Betrachtungen über seine Landsleute – all das scheint darauf hinzusteuern, dass Auster ein Schusswaffenverbot fordert. Doch dann plädiert er für wenig restriktive Regulative, um nicht den historischen Fehler der Prohibition zu wiederholen und das Verbotene noch attraktiver zu machen. Der Schlüssel zu einer friedlicheren Zukunft sei die Auseinandersetzung der US-Amerikaner mit ihrer Geschichte, also der Bewältigung einer gewalttätigen Vergangenheit.
Und dazwischen schweigen immer wieder seitenlang Ostranders Schwarzweißbilder leerer Plätze, an denen Menschen mit Schüssen mitten aus dem Leben gerissen wurden.
Durch all die harten Fakten schimmert die vielleicht größte Stärke des gelassen mit ruhiger Hand schreibenden Autors: sein Einfühlungsvermögen. Stets versucht er zu verstehen. Zu erklären. Zu belegen, was hier im Inneren geschehen sein könnte, bevor die Katastrophe im Außen geschah – etwa mit Zitaten aus den Briefen des Mörders am Umpqua College. In einer Zusammenschau schockierender Zahlen, großer historischer Zusammenhänge, kleiner eigener Erlebnisse und berührender Bilder gelingt es Auster und Ostrander, ein überwältigendes Thema mental handhabbar zu machen