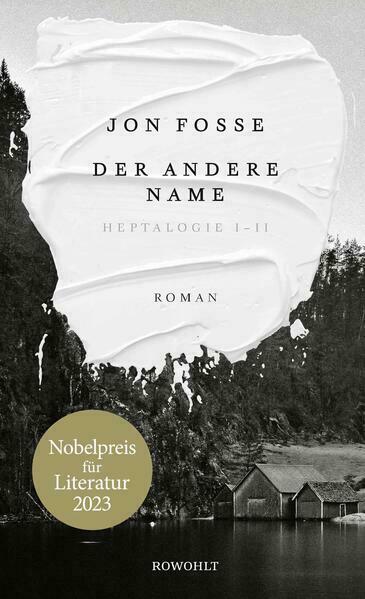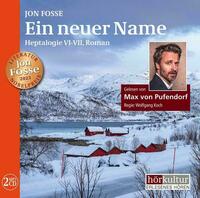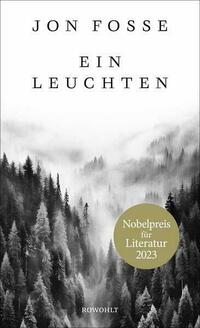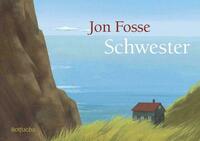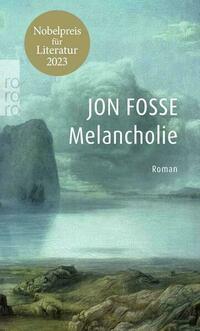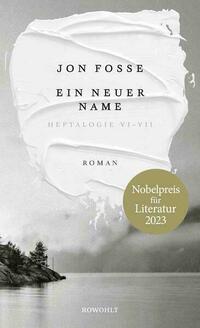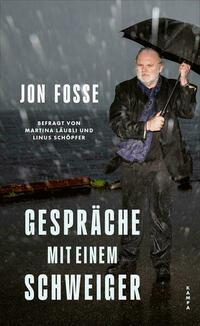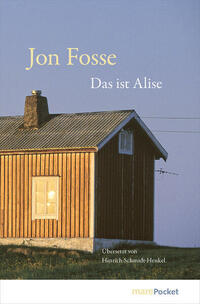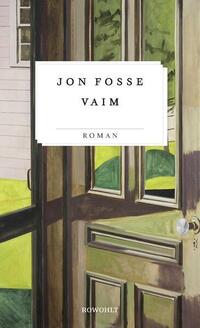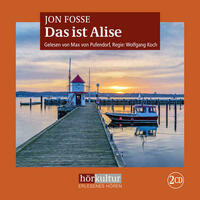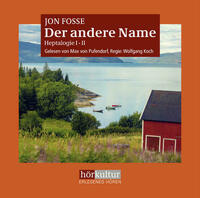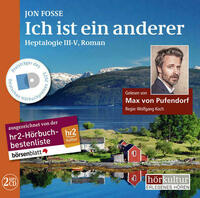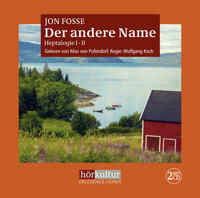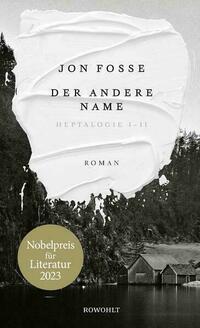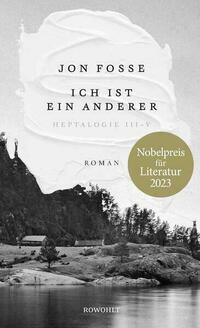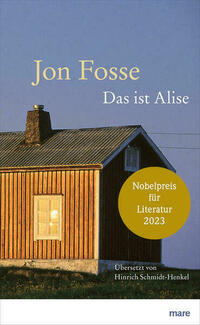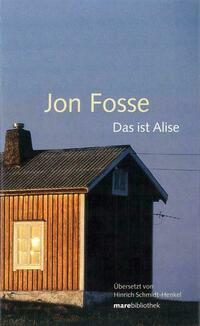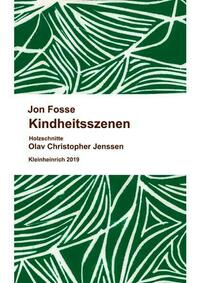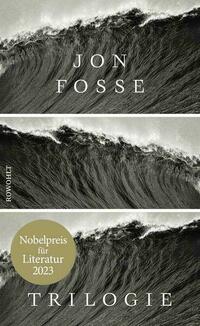Religion und Kunst fallen in eins
Florian Baranyi in FALTER 41/2019 vom 09.10.2019 (S. 21)
Jon Fosse legt mit dem Auftakt zu einer Heptalogie einen existenziell erschütternden Künstlerroman vor
Jon Fosse ist ein vielseitiger Autor. Nach einer ersten Schaffensperiode als Autor von Romanen und Novellen ab seinem Debüt „Rot, schwarz“ (1983) bis zu seinem ersten großen, zweibändigen Roman „Melancholie“ (1995/96, dt. 2001), wandte er sich der Dramatik zu, mit der er international reüssierte. Stücke wie „Der Name“ oder „Das Kind“, die um Familienprobleme, Paarbeziehungen und Schwangerschaften kreisen, eroberten um die Jahrtausendwende die deutschsprachigen Bühnen von den Salzburger Festspielen bis zum Schauspielhaus Zürich.
Weitere wiederkehrende Themen im Fosse’schen Textuniversum sind Einsamkeit, Sprachlosigkeit, Tod und Scheitern, nicht von ungefähr gilt er als ein Autor des Existenziellen in der direkten Nachfolge von Samuel Beckett. Als Übersetzer überträgt er neben ebendiesem Beckett Kafka, Joyce und auch Georg Trakl in seine Literatursprache Nynorsk („Neunorwegisch“), die weniger verbreitete Standardvariante des Norwegischen, die nur zwischen zehn und 15 Prozent der Muttersprachler bevorzugen.
Genauso plötzlich, wie der Umschwung zum Drama kam, fand der an sich selbst „Schreibzwang“ diagnostizierende Fosse wieder zurück zur Prosa. 2008 erschien die Erzählung „Schlaflos“ die sich bis 2015 zur Trilogie auswuchs (dt. 2016). Dafür erhielt Jon Fosse den Literaturpreis des Nordischen Rates, die wichtigste Auszeichnung für skandinavische Literatur, und gilt spätestens seitdem als heißer Kandidat für den Literaturnobelpreis.
Die ersten beiden Teile seiner auf rund 1500 Seiten angelegten „Heptalogie“ erscheinen unter dem Titel „Der andere Name“ und erweisen Fosse einmal mehr als Meister der Wiederholung. Auf den rund 500 Seiten, die um den Maler Asle kreisen, ereignet sich wenig, es finden sich aber deutliche Bezüge zu früheren Werken. So ging es beispielsweise in „Melancholie“ um den geistig umnachteten Maler Lars Hertevig. Und eine Figur namens Asle war auch schon Protagonist in der Trilogie. Bei diesem Asle handelt es sich um einen Maler, der sich um einen Freund sorgt, der ebenfalls Asle heißt und ebenfalls Maler ist. Der wesentliche Unterschied scheint zu sein: Der Protagonist hat dank seiner verstorbenen Frau Ales seine Alkoholkrankheit besiegt, während sein Freund gleichen Namens zwei Ehen mit insgesamt drei Kindern in den Sand gesetzt hat und jetzt zwischen Veisalgia (vulgo: Kater), durch stundenweise Abstinenz bedingtem Zittern und Vollsuff dahinvegetiert.
Das Ganze geht gut, bis der trockene Asle den saufenden Asle irgendwo gegen Mitte des Buches ins Krankenhaus begleiten muss. Ob die beiden Asles und eventuell auch die verstorbene Ehefrau nicht eher nur verschiedene Wahrnehmungsebenen, Erinnerungsschichten oder Dissoziationen des Protagonisten und Erzählers sind, wird sich wohl erst bei der Lektüre der kommenden fünf Bände des Romanzyklus erhellen.
„Der andere Name“ bildet sich jedenfalls aus einem Bewusstseinsstrom Asles, der immer wieder durch die Formeln „denkt Asle“ und „denke ich“ unterbrochen wird. Gerade mithilfe dieser technischen Finesse schafft Fosse Unklarheit über die Einheit der beiden Maler. Der mäandernde Bewusstseinsstrom hat im ersten Teil, neben Kommentaren zur spärlichen Handlung, hauptsächlich Reflexionen über die Malerei Asles und die Religion zum Inhalt.
Ein typischer Ausschnitt aus dem Textblock liest sich so: „ob man jetzt das Wort Gott verwendet oder vielleicht so klug oder scheu ist angesichts der unbekannten Gottheit, dass man es nicht tut, alles führt zu Gott, so gesehen sind alle Religionen eine, denke ich, und so gesehen fallen auch Religion und Kunst in eins, auch weil sowohl Bibel als auch Liturgie Fiktionen sind und Poesie und Bilder“. Einen abschließenden Punkt wird diese Form wohl in allen sieben Bänden nicht benötigen.
Stilistisch steht „Der andere Name“ damit Thomas Bernhards „Alte Meister“ nahe, wobei Fosse mit Bernhard die musikalisch variierten ständigen Wiederholungen teilt, aber mit der grotesken Übersteigerungswut Bernhards nichts gemein hat. Im zweiten Teil werden Kindheitserinnerungen Asles erzählt, wobei die Figur etwas mehr an Kontur gewinnt und deutlich wird, dass man es hier mit einem Beschädigten zu tun hat, der an dem Verlust seiner Schwester, einem Übergriff im Kindesalter sowie dem Tod seiner Frau schwer zu tragen hat.
So etwas wie Erlösung findet Asle in seiner gegenstandslosen Malerei und im Gebet. So sehr die litaneiartige Langatmigkeit, die Desorientiertheit im erzählten Raum und die unerhörte Langsamkeit dieser Prosa zu Beginn auch abschrecken mögen, es ist ein literarisches Projekt, das in seiner Konsequenz und Qualität an weltliterarischen Maßstäben gemessen werden muss.
Dass Bezwingende an Fosses Roman ist, wie es diesem gelingt, Stimmungen mithilfe der musikalischen und zerfließenden Textoberfläche zu erzeugen. Im ersten Teil überwiegt ein Gefühl von lähmender Trauer, im zweiten eines voller diffuser Bedrohung.
In seiner Sprödheit und Dunkelheit ist „Der andere Name“ eine in jeder Hinsicht fordernde Lektüre. Der Roman fordert Zeit und Konzentration, die er mit formaler Schönheit und existenzieller Erschütterung belohnt. Für alle Leser, die bereit sind, diesen Tauschhandel einzugehen, markiert „Der andere Name“ den Auftakt zu einem literarischen Großprojekt, das schon jetzt Einzigartigkeit in der zeitgenössischen Literatur verspricht.