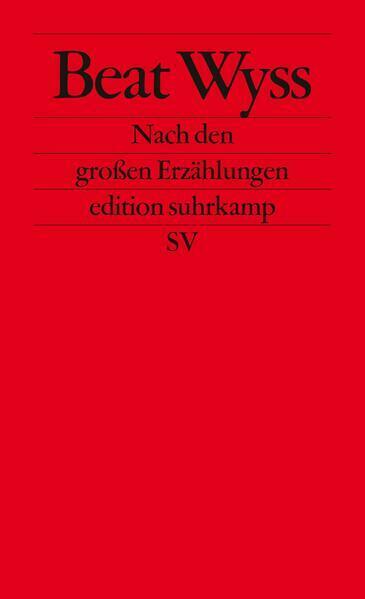Sprache, Geschlecht und Feminismus: die Buchtipps unserer Autoren
Matthias Dusini in FALTER 30/2014 vom 23.07.2014 (S. 11)
Matthias Dusini empfiehlt:
Die Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch veröffentlichte 1984 den Sammelband "Das Deutsche als Männersprache". Darin schildert sie die "Instandbesetzung" der deutschen Sprache. "Die Regeln der Grammatik werden feminisiert und dadurch humanisiert." Ein Dokument, das das Engagement der Sprachbesetzerszene anschaulich macht. Um die andere Seite zu verstehen, hilft "Nach den großen Erzählungen" von Beat Wyss. Der Kunsthistoriker rechnet darin mit 1968 und dem Feminismus ab.
Sibylle Hamann empfiehlt:
"Wie bleibe ich FeministIn": Die Frage aus dem Untertitel des Essaybands "Das wird mir alles nicht passieren
" handelt Streeruwitz in elf Biografien ab. Geschlechterrollen spielen in ihren Settings eine Rolle – ob man sich ihnen fügt oder widersetzt, sie sind immer da. Die Gehaltsschere, die Verteilung von unbezahlter Arbeit: Das sind keine voneinander unabhängigen Themen. Im Sammelband "Absolute Feminismus" sucht und findet die Kunsthistorikerin Gudrun Ankele die großen Linien des Feminismus.
Armin Thurnher empfiehlt:
Niemand wird aus einem Buchtipp sprachkundig, sprachaffin oder gar sprachsensibel. Aber manche Bücher können einen der Sprache näherbringen. Etwa die Aufsatzsammlung "Die Sprache" von Karl Kraus. Oder das wunderbare Buch "Als Freud das Meer sah" des deutsch-französischen Autors Georges-Arthur Goldschmidt, der deutsche und französische Wörter untersucht und beschreibt, wie Hölderlins Sprache knechtisch werden konnte und "zum kriminellen Idiom par excellence", zur Sprache der Nazischergen.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen:
Frontschweine des zynischen Machtwissens
Matthias Dusini in FALTER 10/2010 vom 10.03.2010 (S. 40)
Beat Wyss rechnet mit den Theoretikern
der Postmoderne und den Alt-68ern ab
Der Schweizer Kunsthistoriker Beat Wyss kehrt an jenen Wendepunkt der Geisteswissenschaften zurück, an dem französische Philosophen wie Jean-Francois Lyotard oder André Glucksmann sich von einigen Dogmen ihres Fachs verabschiedeten. Der Fortschritt der Geschichte durch Aufklärung und Vernunft habe sich angesichts von Auschwitz und Gulag als schrecklicher Irrtum erwiesen. Es gelte daher, sich von den "großen Erzählungen" der Meisterdenker zu verabschieden. Wyss versucht darzustellen, dass die Kritik an den Philosophen der Moderne neue, postmoderne Meisterdenker produziert habe, was in seinen Augen keinen wirklichen Fortschritt darstellt.
Das rhetorische Fundament von Wyss' Argumentation ist eine Polemik gegen die 68er, die mit den großen Erzählungen auch das geistige Bezugssystem des Bildungsbürgertums entsorgt hätten. Micky Maus statt Thomas Mann auf die Leselisten der Schulen setzend "operierten sie, wider Willen, als Frontschweine des zynischen Machtwissens". Wyss beschreibt auch den eigenen biografischen Hintergrund: Als Schweizer Kunstgeschichtestudent wurde er durch marxistische Lesezirkel aus der bildungsbürgerlichen Idylle eines Ministranten gerissen, weitere Akte der "Kolonisierung" durch die herrschende Diskurspraxis – genannt wird etwa der Psychoanalytiker Jacques Lacan – sollten folgen.
Statt eines Verstummens von Metaerzählungen sieht der Autor das positive Wissen von Fachdisziplinen schwinden. "Ob Germanist, Philosoph oder Kunsthistoriker – Hauptsache, man hat seinen Lacan gelesen." Leicht ins Englische übersetzbar – im Fall von Lacan darf dies wohl bezweifelt werden –, würde die postmoderne Monokultur zum Leitbild einer global vernetzten Diskursgemeinde, die "aus den Geisteswissenschaften das alteuropäische Erbe herausbleicht".
In Form ideengeschichtlicher Skizzen klopft Wyss einige populäre Begriffe und Leitfiguren der neuen Zeit auf ihre Tauglichkeit hin ab. Er legt die kantianische Wurzel des Begriffs des Erhabenen frei, den der Maler Barnett Newman (1905–70) als uramerikanisch propagierte. Das Erbe Nietzsches sieht er in Susan Sontags Manifest gegen Kunstkritiker "Against Interpretation" (1961) fortwirken. Er verteidigt die Autonomieästhetik Theodor W. Adornos gegen den Vorwurf der ideologiekritischen Linken, die diesem mangelndes Engagement vorwarfen.
Wyss reiht sich damit ein in die Front jener 68er-Kritiker, die im Rückblick auf die eigene intellektuelle Biografie die blinden Flecken ihrer Generation entdecken. Ein wiederkehrender "Komplex" ist der rüpelhafte Umgang mit den Opfern des NS-Regimes, die wie Adorno nach 1945 nach Deutschland zurückkamen. Der große Sündenfall ist auch bei Wyss der "neostalinistische" Terror der Roten Armee Fraktion. Interessanter sind jene Passagen, in denen Wyss klischeehaft überlieferte 68er-Helden mit scheinbar weitentfernter Theorie konfrontiert. So interpretiert er etwa das öffentliche Auftreten von Joseph Beuys mithilfe der Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu als Mischung aus (marginalisiertem) Zauberer und (professoralem) Priester. Die künstlerische Symbolik des "ewigen Hitlerjungen", die dunklen Farben und germanischen Kreuze werden aus Beuys' Sozialisation in den 30er-Jahren heraus gedeutet.
Nicht immer vermag Wyss mit seinen Querlektüren zu brillieren. Er beschreibt etwa, wie Umberto Eco Themen der Zeichentheorie in seinen Roman "Der Name der Rose" (1980) einfließen ließ. Und dass der Roman eine Parabel auf die italienische Politik nach 1968 sei. Dem linken Fundamentalismus der Brigate Rosse setze Eco, ohne dies offen auszusprechen, eine auf Verhandlung und Kommunikation beruhende Zeichentheorie entgegen. Was Wyss nicht dazusagt, ist, dass Eco von der italienischen Regierung beauftragt war, die Botschaften der Terroristen zu dechiffrieren. Spätestens an diesem Punkt hat man das ursprüngliche Thema, die Theorie der Postmoderne, etwas aus den Augen verloren.
So hinterlässt die Lektüre dieses zwischen Theorie und Anekdote springenden Buches einen zwiespältigen Eindruck. Zwar folgt man gespannt den geistreichen Kombinationen des Autors, das Objekt seiner Kritik lässt einen aber meist kalt. Zu wenig attraktiv erscheint die alte Welt der Ministranten und Bildungsbürger. Für eine jüngere Generation ist mitunter schwer nachzuvollziehen, mit welcher Obsession die Apo-Opis aus einer privilegierten, universitären Position heraus ihre Jugendsünden aufarbeiten.