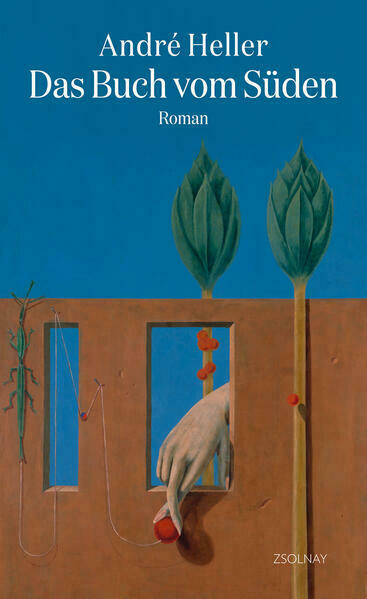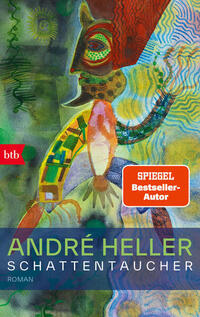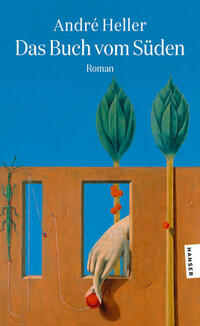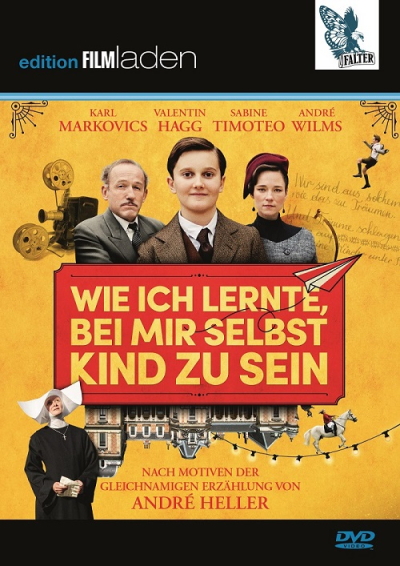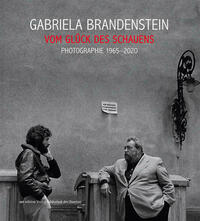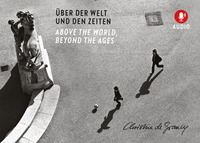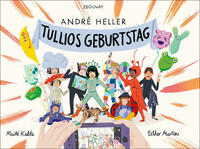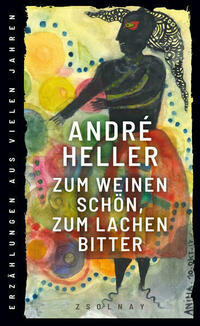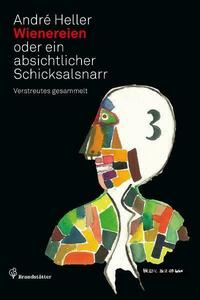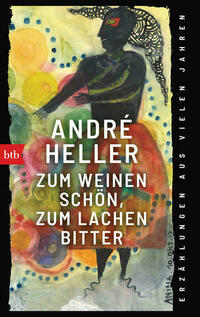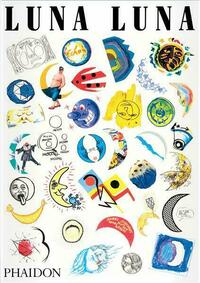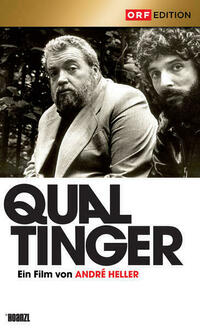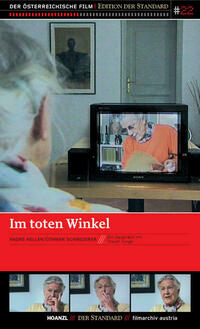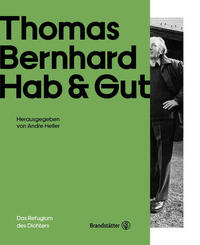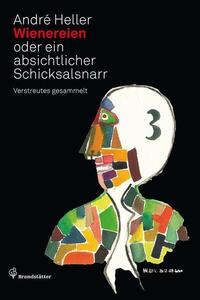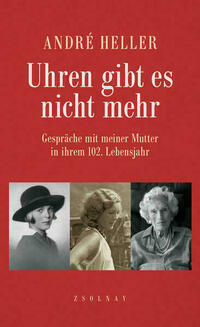Es werde Licht – es werde Heller!
Klaus Nüchtern in FALTER 18/2016 vom 04.05.2016 (S. 32)
„Das Buch vom Süden“ belegt die stupende Wandlungsfähigkeit des Ausnahmekünstlers André Heller
Von seinem Protegé Alfred Gusenbauer hat André Heller einmal erzählt, dass dieser ein ausländisches Staatsoberhaupt mitunter schon zehn Minuten warten lasse, wenn er noch ein Gedicht im spanischen Original zu Ende lesen müsse. Ein solches Verhalten galt Heller naturgemäß nicht als die unprofessionelle Taktlosigkeit, die sie ist, sondern als Beleg einer höheren Gesinnung, die dem seinerzeitigen Kanzler die Zugangsberechtigung verschaffte zu jenem Paradies der Kultiviertheit, dem Heller selbst als Parkwächter und Oberförster vorsteht.
Man muss sich Hellerland ein bisschen so vorstellen wie Pepperland, das submarine Elysium aus dem Beatles-Animationsfilm „Yellow Submarine“: Zwischen den Korallen des „Octopus’s Garden“ singen und tanzen, tändeln und frohlocken glückliche Buben und Mädchen, während da draußen in den blauen Bergen die Blaumiesen auf nichts anderes sinnen als auf Dissonanz und Destruktion, Zwietracht und Zerstörung.
Von Hellerland, dessen Einwohnern und dessen Feinden erzählt auch „Das große Buch vom Süden“, das der vor kurzem zum 69 Jahre alten Kind herangereifte Poet sich und der Welt geschenkt hat. Es liegt nicht unter, immerhin aber am Meer, denn ein meteorologisch so biestiges Binnenland wie jenes, zu dem Österreich 1918 nach dem Verlust seiner triestinischen Zypressen verkommen ist, kann keine Heimat mehr sein für Gottfried Passauer, den Vizedirektor des Wiener Naturhistorischen Museums.
Und auch dessen Sohn Julian, Protagonist des Romans und Alter Ego des Autors, erfasst eine unbändige Wut, wenn in seinem Garten am Gardasee Schnee fällt: „,Hau ab, Österreich!‘, rief er. ,Lasst mich in Ruhe, Adalbert Stifter und Peter Rosegger, Alfons Walde und Toni Sailer! Zur Hölle mit euch! Belästigt mich nicht in meinem Ausland!‘“
So stark ist die Empörung, dass Julian seine Kinderstube vergisst und dem Pöbel hinterherkeift. Adalbert Stifter ginge ja noch an, aber Rosegger, Walde, Sailer – seriously?!!! Das ist doch keine Gesellschaft für einen, der imaginären Umgang mit Joseph Roth und Peter Altenberg, Picasso und Botticelli pflegt.
Wie alle großen Geister zieht es Julian ins Land, wo die Zitronen blühn. Nach seiner Wiener Kindheit, wo er standesgemäß in Schönbrunn und unter der Obhut ganz formidabel kultivierter und liebevoller Eltern aufwächst, wird Julian zur Matura „eine langsame, afrikaumrundende Schiffsreise mit dem zypriotischen Frachtdampfer Tukan II.“ spendiert, die Julian menschlich, empfindungs- und erkenntnismäßig echt total weiterbringt, „denn außer den gehörten und gerochenen Ereignissen hatte er auch noch mehr an Küstenlinien und Luftspiegelungen, landschaftlicher und menschlicher Zartheit und Grobheit, Schrecken und Wohlbehagen, Regen, Staub, Stürmen und erstickender Hitze sowie Wellenmuster und andere Launen der See erlebt, als er jemals würde erzählen können.“
Das glaubt man gern, denn erzählen kann André Heller tatsächlich nicht. „Das Buch vom Süden“ ist weniger Roman als die Behauptung eines solchen. Die Entpuppung des ohnedies schon ziemlich fantastischen Julian zum Super-Julian mit supergeilem Garten, supergeilen Weibern und supergeilen Einsichten wird eben nicht erzählt, sondern mit einem einfallslosen Satz resümiert: „Am Ende dieser Reise war Julian in gewissem Sinne ein reifer Mann.“
Das Interessanteste an diesem autobiografischen Roman ist die Wiener Kindheit und Jugendzeit des Protagonisten, aber auch diese wirkt seltsam unplausibel und ungreifbar. Im Stenogrammstil werden Ereignisse und Eindrücke aufgelistet: das „erste Läuten der im Krieg zerstörten und nun neugegossenen Riesenglocke Pummerin am 26. April 1952; der gewaltige, wie berstende Baumstämme krachende Eisstoß unter den Wiener Donaubrücken des Winters 1953; der Zauberer Kalanag im Varieté Ronacher (…); die Laufmaschen der Nylonstrümpfe von Frau Wiesenthal aus der Zuckerbäckerei in der Zenogasse“.
Der semantischen Vielschichtigkeit des Begriffs „Schas“ widmet Heller einen kleinen Exkurs, dem zu entnehmen ist, zu welcher Gedankentiefe das Wienerische noch in den schlichtesten Unmutsäußerungen imstande ist: „,Die ganze Welt is a Schas‘ fasst in einem Satz zusammen, was hunderte pessimistische Philosophen auf tausenden Buchseiten zu ergründen versuchten. (…) Und hätte etwa Ludwig Wittgenstein gegenüber einem als Kellner oder Chauffeur arbeitenden Landsmann seinen berühmten Gedanken ,Die Welt ist alles, was der Fall ist‘ zum Ausdruck gebracht, wäre ihm mit einiger Wahrscheinlichkeit die Antwort erteilt worden: ,Eh klar, a Schas.‘“
Der Roman ist von skurrilen Gestalten bevölkert und lässt kaum ein gängiges Wien-Klischee aus. Wobei die Allianz der Außergewöhnlichen, in der allein einer wie Julian gedeihen kann, vor allem aus den Eltern und dem Grafen Eltz besteht, einem „ehemaligen Weltklasseschwimmer, dessen ererbter Wohlstand und ganz aus eigener Kraft geschaffene exzentrische Originalität ihm eine Nonchalance und Grandezza verliehen, dass er unter Durchschnittsmenschen wie ein unvermittelt aus der Ebene aufragender, wolkenumströmter Kilimandscharo wirkte“.
Seine nonchalante Originalität bringt Eltz zum Ausdruck, indem er sich beim Anblick des ÖGB-Generalsekretärs über dessen unelegante Körperhaltung und unzulängliche Manieren echauffiert, indem er „durch ein elfenbeingefasstes Opernglas die üppige Stuckdecke seines Salons betrachtet“ oder indem er ein paar manierierte Wortspenden zur Ideologie des Ausnahmemenschen beiträgt, die in dem Roman wortreich ausgebreitet wird.
Als „Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Crispiniano de la Santisima Trinidad Ruiz Picasso“ (den Namen kann der Eltz, der eine Tuschzeichnung des Genannten im Salon hängen hat, auswendig) im Bubenalter schwört, nie wieder einen Pinsel zur Hand zu nehmen, wenn seine Lieblingsschwester die Diphtherie überlebt, interveniert ein Schutzengel der Malerei. In den Worten des Grafen Eltz: „So ein gefiederter Zampano hat dafür gesorgt, dass die kleine Conchita (…) bald nach Pablos Versprechen gestorben ist und sich dadurch das ewige Mysterium Pablo Picasso erfüllen konnte.“
Aber nicht nur der Eltz – eher ein Graf Bobby als ein Hofmannsthal’scher Kari Bühl – redet so geschwollen daher, allen wird dieses Konditorei-Demel-Deutsch in den Mund gelegt. Wenn Papa Passauer von der Gattin gedrängt wird, dem Buben endlich „von den Lagern“ zu erzählen, dann fällt ihm das nicht etwa schwer, es ist ihm „ein Torment“. Julian selbst ist nicht etwa traurig oder depressiv, sondern „geriet in Traurigkeiten“, und wenn vom Anblick der Frau Pribil „unsichtbare Fäden in einen Teil von Julians Innenleben zu reichen schienen“, dann hat der Bub einen Steifen.
Apropos scheinen. Besagte Pribil, die Frau des Obergärtners, „schien duftmäßig an Wunderbarem zu halten, was er sich versprochen hatte“. Das Ansinnen Julians, gegen Bezahlung an ihr schnuppern zu dürfen, wird mit den Worten „Bist deppert, Klaner?“ abschlägig beschieden.
Wie es überhaupt die Frauen sind, die mit diesem „Equilibristen des Alltäglichen“ und „Parteigänger der Zwischentöne und Verästelungen“ hin und wieder auch einmal Klartext reden: „Sie sind ziemlich anstrengend“, flüstert ihm Aimée bei ihrem ersten Rendezvous zu. Aimée ist übrigens die mit „den ausgeprägten Backenknochen und der gewiss nicht korrigierten Nase, den sehr großen smaragdgrünen Augen, dem tiefschwarzen Haar mit dem Bubikopf-Schnitt, der geschickt die hohe Stirn (…)“ – und so weiter und so fort.
Vorsätzliche Desavouierung seiner selbst betreibt André Heller, wenn er einmal einen echten Dichter zitiert: „War net Wien, wann net durt, wo ka Gfrett is, ans wurdt.“ Und als würde der Unterschied zwischen dem lakonischen Witz von Josef Weinhebers (metrisch durchaus nicht astreinem) Bonmot und dem aufgemascherlten Geschwurbel dieses Romans nicht jedem sofort schlagend evident, wird der Vers auch noch kommentiert: „Dieses scheinbar grundlose, plötzlich in Fallgruben und Trübungen Stürzen oder ins Unheil Verwickeltsein war auch eine Konstante seines Lebens.“
Für den Hermann Hesse von Hietzing hat es bei Heller nicht gereicht, der Paulo Coelho vom Gardasee wäre sich eventuell noch ausgegangen, hätte der Lektor oder die Lektorin nicht spätestens auf Seite 185 von insgesamt 335 zähen Romanseiten w.o. gegeben. Man kann es verstehen. Sie oder er hat sich unser aller Mitgefühl redlich verdient.