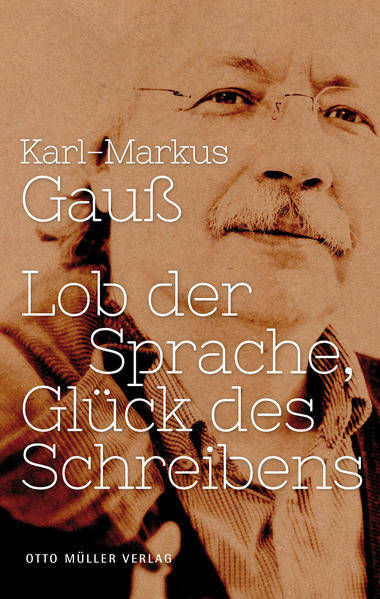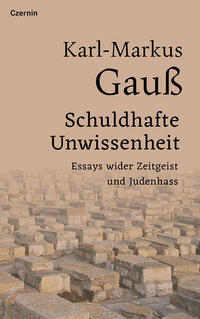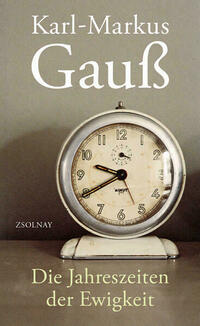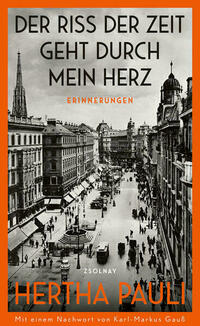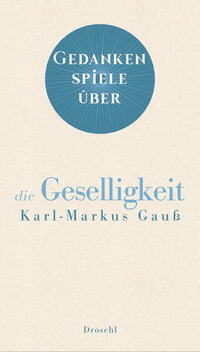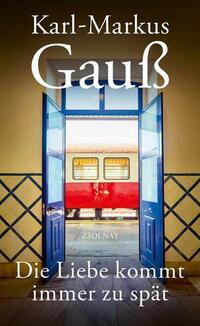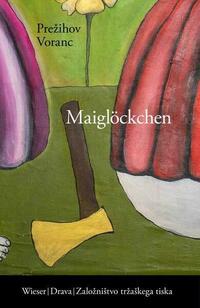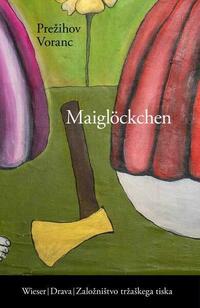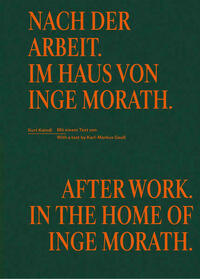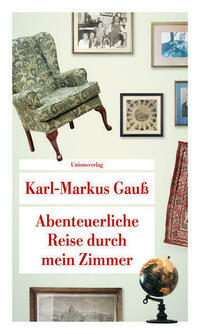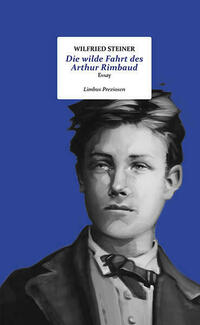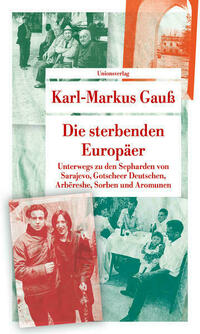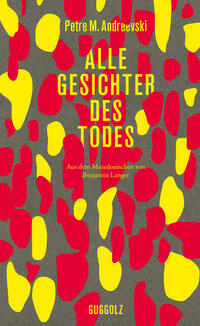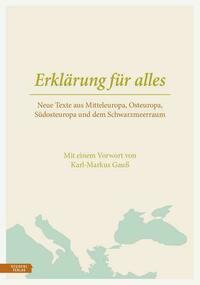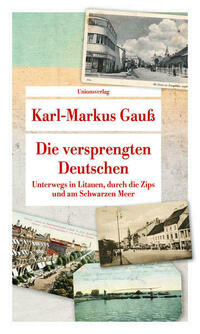Die Welthaltigkeit von Alltagsbegebenheiten
Julia Kospach in FALTER 11/2014 vom 12.03.2014 (S. 46)
Essay: Der große Salzburger Stilist Karl-Markus Gauß legt versammelte Feuilletons, Glossen und Reden vor
Es ist ein schmales Büchlein und gehört in eine Kategorie, die zumeist schmählich vernachlässigt wird. Denn in "Lob der Sprache, Glück des Schreibens" sind vermischte Schriften von Karl-Markus Gauß versammelt, die dieser in den letzten 20 Jahren geschrieben hat – Glossen und Feuilletons, Nachrufe und Reden, Beiträge für Sammelbände, Feuilletons und Kurzprosa.
Der Buchhandel sieht das Vermischte in Buchform ungern, weil er es nicht unter einem griffigen Schlagwort anpreisen kann, und der Leser muss schon wirklich Glück haben, damit ihm ein solches Buch rein zufällig unterkommt. Dabei kann es sich gerade bei einem Sammelband dieser Art um eine ganz besonders lohnende Lektüre handeln. Dann nämlich, wenn das Geschriebene aus der Feder eines großen Stilisten und akribischen Alltagsbeobachters wie Karl-Markus Gauß stammt. In seiner Gesamtheit ähnelt "Lob der Sprache, Glück des Schreibens" den großen, viel gelobten Essay- und Journalbänden.
Im Detail funktioniert es wie eine Sammelmappe, die man aufschlägt, um darin zu blättern und ein ums andere Mal beim Anblick der nächsten fein gezeichneten Szene hängenzubleiben. Karl-Markus Gauß hat viel Sinn für die Welthaltigkeit von Alltagsbegebenheiten, und er weiß sie aufs Wunderbarste zu beschreiben. Nehmen wir nur die grandiose Miniatur "Mein Kasache".
Da beschreibt Karl-Markus Gauß, wie er sich im Zug angesichts eines tätowierten, kahl rasierten, lederbejackten und biertrinkenden Gegenübers wider Willen selbst bei "rassekundlichen Einschätzungen" erwischt, sich für seine Ressentiments sofort mit schlechtem Gewissen geißelt und am Ende – nach einem aufschlussreichen Zwischenfall mit der österreichischen Polizei – mit seinen widersprüchlichen Empfindungen doch noch zu einer zufriedenstellenden Gefühlslage findet.
Bewundernswert daran ist, wie Gauß' Text in einer zufällig beobachteten, winzigen Begebenheit die gesamte Debatte um Ausländerfeindlichkeit, Vorurteile und beamtete Willkür findet, ausbreitet und dabei gleichzeitig im leichten, eleganten Ton der Anekdote hält.
Zum selben Themengebiet liefert er nur einige wenige Seiten danach auch den herrlichen Merksatz: "Ausländer ist, wer weniger Geld hat als man selbst und daher im begründeten Verdacht steht, es einem aus der Tasche ziehen zu wollen."
So viel dazu, dass es in unserer Wahrnehmung immer die guten und die bösen Ausländer gibt. Für Gauß ist es ein Leichtes, diese Gemengelage aus Berechnung, Verlustangst und zweierlei Maßstäben in einen kurzen, ironischen Satz zu gießen.
Es ist immer erhellend, Gauß' Texte zu lesen. Ganz gleich, ob er seine Liebe zur Lektüre von Tagebüchern erklärt, ob er übers Erröten räsoniert oder über den konsumaffinen "Humanismus der Charity-Gesellschaft", ob er die Folgen der sexuellen Revolution am Beispiel von Sexualberatungsstellen im Internet beschreibt oder sich über "das herrlich Umständliche, grandios Zeitaufwändige" der japanischen Kultur wundert.
Einige der wiederkehrenden großen Themen des Salzburgers spielen auch hier eine wichtige Rolle, vor allem Grenzen – die der Scham und der Peinlichkeit ebenso wie die in den Köpfen, die schmerzlich vorhandenen oder die leider verschwundenen.
Gauß' fast schon sehnsüchtiger Abgesang auf den italienisch-österreichischen Grenzort Tarvisio – der unter den Vorzeichen des europäischen Freihandels heute menschenleer, schäbig und verlassen darniederliegt – wird niemanden kaltlassen, der auch nur einmal dort eine Stange Zigaretten gekauft und klopfenden Herzens am Zoll vorbei nach Österreich geschafft hat.
Geradezu berauschend ist Gauß' leidenschaftliches Plädoyer für den Schutz von Minderheitensprachen – kein Wunder bei einem Autor, der, beginnend mit "Die sterbenden Europäer. Unterwegs zu den Sepharden von Sarajevo, Gottscheer Deutschen, Arbëreshe, Sorben und Aromunen" (2001), zahlreiche Bände zu bedrohten Völkern und Sprachen in Südosteuropa vorgelegt hat.
Warum es dabei nicht um einen "Artenschutz für Völker und Nationalitäten" geht, sondern darum, welche Lektionen die kleinen Völker den großen zu erteilen haben, weil sie genau jene Fähigkeiten schon längst besitzen, die ein ideales Europa sich von seinen Bewohnern wünscht, ist wohl noch nirgendwo so überzeugend dargestellt worden wie hier.
Es geht um "die Fähigkeit, nicht bloß an einer einzigen Kultur teilzuhaben". Davon versteht Gauß, der große Alltagsflaneur der deutschsprachigen Essayistik, jede Menge.