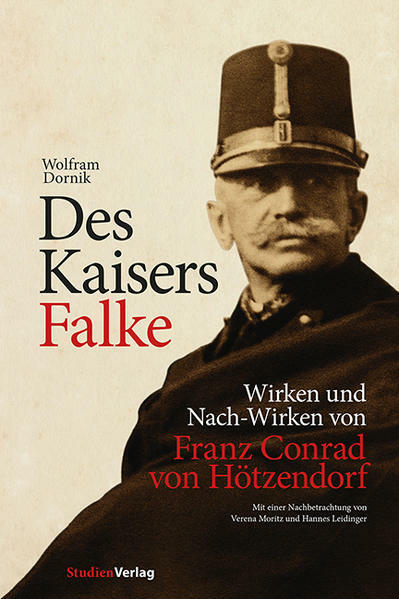Ging der Erste Weltkrieg von Wien aus?
Alfred Pfoser in FALTER 41/2013 vom 09.10.2013 (S. 45)
Geschichte: Fünf neue Bücher zeichnen ein komplexes Bild der Rolle Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg
Es kommt nicht oft vor, dass zeitgeschichtliche Bücher österreichischer Historiker aus jüngster Zeit hoch begehrt sind und beste Preise in den Antiquariaten erzielen. Trotzdem ist das mit Manfried Rauchensteiners Buch "Der Tod des Doppeladlers. Österreich-Ungarn und der Erste Weltkrieg" lange Zeit passiert.
1993 bei Styria erstmals erschienen, war es jahrelang vergriffen. Das Werk des früheren Direktors des Heeresgeschichtlichen Museums war das Ergebnis einer jahrzehntelangen Beschäftigung und ein gut lesbares Standardwerk mit anregenden Details; Militär-, Politik- und Gesellschaftsgeschichte in einer kompakten Komposition.
Von Hader zu Hass
Jetzt gibt es bei Böhlau eine gründlich revidierte und erweiterte Neuauflage. Eigentlich ein mutiges Unterfangen, denn 20 Jahre Forschung haben neue Themen in den Vordergrund gerückt und andere Bewertungen produziert. Rauchensteiner hat das Dilemma in "Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie 1914–1918" so gelöst, dass er lange Strecken fast unverändert übernommen, Fehler beseitigt und neue Kapitel und Textteile eingeschoben hat. Das Ergebnis: Bei diesem Überblick ist man noch immer sehr gut aufgehoben.
Wer kürzere, theoretische oder weniger detailreiche Schneisen durch das komplexe Geschehen erwartet, muss sich aber auf andere Autoren stützen. Wer eine radikalere Sicht auf die "Blutpumpe" des von Wien angezettelten Krieges haben möchte, für den ist eine Erstauskunft bei Karl Kraus darüber, wie dieser Krieg abgelaufen und was von ihm zu halten ist, noch immer unübertroffen – nachzulesen etwa in der gelungenen Kombination von Kraus-Texten und Fotos in dem von Anton Holzer herausgegebenen Bildband "Die letzten Tage der Menschheit".
Zu Recht betont Rauchensteiner, dass die nostalgische Memorierung der Habsburgermonarchie als Vorläufer der Europäischen Union ziemlich falsch liegt. Denn bei Ersterer ist der Auflösungsprozess unübersehbar. Der Weltkrieg, von dem sich Kaiser und Regierung eine Beseitigung nationaler Probleme erwarteten, erwies sich als deren fataler Beschleuniger.
Vor dem Krieg artikulierten sich im österreichischen Parlament unter den Volksvertretern Befremden, Misstrauen und Obstruktion. Während des Krieges entwickelte sich der Hader zu veritablem Hass, zuerst gegen die Serben, Italiener und Ruthenen als "innere Feinde", später dann gegen die Juden als "Kriegsgewinnler", gegen die Tschechen als "Hochverräter", gegen die Ungarn als egoistische "Schweinemagnaten" usw.
Den Völkern des Habsburgerreichs blieben nach dem Ausgleich mit Ungarn 1867 ohnehin nicht viele Gemeinsamkeiten. Eine solche Klammer, sicherlich die wichtigste, war die k.u.k. Armee. Rauchensteiner skizziert plastisch die inneren Spannungszustände und Auflösungserscheinungen der Armee mit mehr als acht Millionen Soldaten.
Kriegszitterer und Medaillen
Nach den herben Verlusten im Herbst 1914 gab es bei den Generälen massenweise Absetzungen, Rücktritte und Selbstmorde, über die nicht geredet werden durfte. Eine Million Soldaten kamen um, fast zwei Millionen kehrten verwundet heim, mussten vielfach als Invalide ein kärgliches Leben fristen, ihre Leiden wurden missachtet und kleingeredet, "Kriegszitterer" galten als Tachinierer.
Mit Dekorationen ging dagegen der Kaiser großzügig um, vier Millionen Tapferkeitsmedaillen wurden verliehen. Seit den Karpatenschlachten 1914/15 war der nationalistische Bazillus des Misstrauens auch ins Heer eingedrungen, Stand- und Feldgerichte wüteten gegen Desertionen und Selbstbeschädigungen, bis im Sommer 1918 der zuerst schleichende Erosionsprozess zu einem offenen wurde.
Rauchensteiner diskutiert unter diesem Vorzeichen die hohe Zahl der über zwei Millionen Soldaten, die in vor allem russische Kriegsgefangenschaft gerieten. Bei der deutschen Armee gab es sowohl an der Ost- wie an der Westfront weit weniger Verluste.
Ein düsteres Kapitel ist das Schicksal der Internierten, die auf Verdacht als "unzuverlässige Elemente" behandelt und in Internierungslagern und Konfinierungsstationen festgesetzt wurden. Hinzu kamen die insgesamt 550.000 meist mittellosen Flüchtlinge und "Zwangsevakuierten" aus den Frontgebieten, die in dem vom Krieg verschonten deutschsprachigen Zentralraum oft als lästige Esser, störende Fremdlinge oder "potenzielle Seuchenherde" behandelt wurden. Von einer solidarischen Völkerfamilie spürten diese Vertriebenen jedenfalls wenig.
Neu im Buch ist auch ein Kapitel über Kriegsgefangene in Österreich, die hungerten, in Erdlöchern wohnten, in Lager gepfercht wurden, an Krankheiten laborierten, an Seuchen starben, Bauern zugeteilt oder zu Bauprojekten herangezogen wurden – sowie eine ausführliche Betrachtung der Rolle von Kaiser Franz Joseph I.
Der greise Monarch wollte von Anfang an diesen Krieg, Zögern und Bedächtigkeit gab es nicht. Die Regie sorgte dafür, dass keine friedlichen Lösungen in Betracht kamen, diplomatische Interventionen unterbunden wurden. Franz Joseph administrierte die Kriegserklärung wie andere Schreibstücke.
Andere Neuerscheinungen befassen sich mit der Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges, vor allem dem verhängnisvollen Jahr 1914.
Der ermordete Thronfolger
In Wolfram Dorniks "Des Kaisers Falke. Wirken und Nach-Wirken von Franz Conrad von Hötzendorf" gerät der Chef des Generalstabs der k.u.k. Armee ins Visier der Aufmerksamkeit (siehe Rezension in Falter 37/2013). Der ermordete Thronfolger Franz Ferdinand bekommt gleich mehrere Biografien. In "Franz Ferdinand. Der eigensinnige Thronfolger" porträtiert der französische Historiker Jean-Paul Bled den in seinem Charakter bisweilen bizarren "verhinderten Herrscher". Wäre Franz Ferdinand wirklich der Monarch gewesen, der dem Vielvölkerreich eine zeitgemäßere Fassung hätte geben können? Bled zweifelt daran. Der Schock, den sein Tod auslöste, war jedenfalls enden wollend.
Ganz nahe an der Chronik dieser Tage erzählt Edgard Haiders "Wien 1914. Alltag am Rande des Abgrunds" von frohen Festen und sauren Tagen, von technischen Neuheiten und dem Wandel im Stadtbild, dem Großstadtübel Müllabfuhr und der Obstruktion im Parlament, vom monströsen, luxuriösen Wirbel um die Uraufführung des "Parsifal" und vom alten, kranken Kaiser in Schönbrunn, um dessen Leben man bangt. Kurzweilig, anschaulich, in übersichtlichen kurzen Feuilletons führt uns Haider durch die 2-Millionen-Metropole, bevor er einschwenkt auf Julikrise und Kriegsausbruch.
Haider beginnt sein Buch mit dem Jahreswechsel 1913/14. Wiens bessere Gesellschaft champagnisiert in den Nachtlokalen, fährt auf den Semmering zum Skilaufen, vergnügt sich in den Theatern und Kabaretts und wünscht sich mit Gedichten, Glückwunschkarten und bei den üblichen Nachbarschafts- und Verwandtschaftsbesuchen ein gutes neues Jahr. Der Brauch, dass die Pummerin läutet, hat sich damals noch nicht eingebürgert, aber dennoch ergibt sich zu Mitternacht auf dem Stephansplatz ein so gewaltiges Gedränge, dass die Polizei einschreiten muss.
Die große Sensation des Tages ist Wiens erstes Kinetophon in den Tuchlauben-Lichtspielen; diese weitere Edison-Erfindung macht es möglich, ohne Klavier und Pianisten zum Film eine Tonbegleitung zu produzieren. Die Arbeiter-Zeitung erinnert daran, dass in den Vorstädten Elend und hohe Arbeitslosigkeit grassieren und die Teuerung den Leuten zusetzt.
Die Probleme des Balkans sind weit weg. An die Möglichkeit eines großen Krieges denken wohl nur ganz wenige an diesem Jahreswechsel. Im Juli ist es dann so weit.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen:
Das intrigante Ekel von Wien
Norbert Mappes-Niediek in FALTER 37/2013 vom 11.09.2013 (S. 19)
Eine neue Biografie über Franz Conrad von Hötzendorf zeigt den k.u.k. Generalstabschef als skurrilen, Serbien hassenden Kriegstreiber
Paul von Hindenburg, Chef der deutschen Obersten Heeresleitung im Ersten Weltkrieg, verliert in seinem Heimatland nach und nach die Straßen, die nach ihm benannt wurden.
Franz Conrad von Hötzendorf, seinem österreichischen Pendant, ist das bisher erspart geblieben: Noch um die 40 Straßen und Plätze im Land sind nach ihm benannt, darunter sinnigerweise in Graz die große Ausfallstraße nach Südosten. Das könnte sich jetzt ändern. Pünktlich zum großen Gedenken an den Ersten Weltkrieg im nächsten Jahr hat der Grazer Historiker Wolfram Dornik eine kritische Biografie des glücklosen Feldherrn vorgelegt.
Conrad – nicht sein Vorname, sondern Teil seines Nachnamens – war von 1906 bis 1917 mit einer Unterbrechung Chef des Generalstabs und damit oberster Kriegsstratege der Monarchie. Vor dem Krieg profilierte sich der Protégé von Erzherzog Franz Ferdinand als Anführer der "Kriegspartei" und forderte bei jeder Gelegenheit den Präventivschlag gegen Serbien.
Als der Thronfolger am 28. Juni 1914 in Sarajevo erschossen wurde, schlug endlich Conrads Stunde. Es war zugleich das letzte Stündlein der Monarchie. Der Feldzug gegen Serbien, das eigentlich blitzartig hätte besiegt werden sollen, scheiterte schmählich. Intrigen, Schlendrian und nicht zuletzt ständige Reibereien mit den Verbündeten in Berlin sicherten ihm trotzdem seine Position, bis der junge Kaiser Karl den glücklosen Feldherrn schließlich ablöste.
Schwülstige Liebesbriefe
Nicht leicht zu beschreiben ist, was den körperlich kleinen, misanthropischen und rechthaberischen Mann antrieb. Für einen reinen Karrieristen legte er sich mit zu vielen an, die ihm hätten nützlich sein können. Von persönlicher Hingabe zu Thron und Altar konnte keine Rede sein; beiden Kaisern, die er erlebte, fühlte der ehrpusselige Kleinadlige mit dem gewaltigen Schnurrbart sich überlegen, und mit der Kirche hatte er schon gar nichts im Sinn.
Auch ein Ideologe war Conrad wohl nicht. Was Dornik als seinen "Sozialdarwinismus" beschreibt, war einfach die zeittypische Art, im Offizierskasino seine Arroganz zu rechtfertigen. Ohne aus allem eine ausdrückliche Bilanz zu ziehen, lässt Dornik aus den vier Kapiteln zu Herkunft, Werdegang, Wirken und Nachwirkung des Conrad von Hötzendorf doch ein schlüssiges Bild entstehen.
Als emblematische Geschichte für seinen Charakter nimmt Dornik Conrads Werben um seine zweite Frau Gina. Weil seine Angebetete schon verheiratet war, musste (und durfte) der streitlustige General, um Gina zu gewinnen, seine ganze Beharrlichkeit und sein ganzes intrigantes Potenzial einsetzen, mit pompöser Rührseligkeit auftrumpfen, hochgestellte Persönlichkeiten bis hin zum Kaiser für sich instrumentalisieren – ein Fall ganz nach Conrads
Geschmack. Was der kleine Feldherr für seine Gina an kitschigen Liebesschwüren auf Lager hatte, liest sich wie ein Generalswitz; Tucholsky oder George Grosz hätten ihre Freude an ihm gehabt.
Aber auch politisch wird Conrad in der Biografie eine plausible Figur. Mit den Deutschen hatte er seine liebe Not. Vertieft in Dorniks Buch, kann man sich lebhaft vorstellen, was die blasierten Monokelträger in Berlin von dem zänkischen Gnom hielten, der nie richtig auf den Punkt kam und Wiederholungen liebte.
Trotzdem wurde er nach seinem Tod 1925 zur Ikone des Bündnisses zwischen Christsozialen und Deutschnationalen. Möglicherweise, so Dornik, repräsentierte die Person Conrad einen gemeinsamen Unterstrom, der beide Lager verband, das schwarze und das blaue: die Großmannssucht, den kolonialen Gestus, den Glauben an die Überlegenheit der deutschen Kultur und Österreichs "hohe Sendung", den Steppenvölkern des Ostens das Essen mit Messer und Gabel beizubringen.
Wo man sich auf den nationalen Dünkel einigen konnte, wurden Staatsidee oder klerikale Gesinnung zweitrangig. Conrads politische Vision war nicht der deutsche Nationalstaat, sondern das autoritär geführte Großreich, in dem das deutsche Kulturvolk den Hegemon spielen sollte.
Hübsch dazupassende Zitate findet Dornik von Conrads italienischer Reise, wo er vor der erhabenen Antike in die Knie ging und im Vatikan die "geistlosen Madonnen" monierte – ganz nach dem, was man im Kasino für den Geist Goethes hielt.
Vor allem aber hatte Conrad den Kaisertreuen wie den Deutschnationalen eine Erklärung für den verlorenen Krieg zu bieten: Man hätte Serbien schon viel eher "niederringen" und sich "einverleiben" sollen. Es hatte eben nur keiner auf ihn gehört. Auch darauf konnten Schwarze und Blaue der Ersten Republik sich einigen.
Lernte Hitler nicht mehr kennen
Dass Conrad seine Straßen bis heute behalten durfte, verdankt er wohl auch der Gnade des frühen Todes. Anders als Hindenburg war es ihm nicht vergönnt, zu Lebzeiten einem "Führer" den Steigbügel zu halten.
Dorniks Buch ist leicht lesbar, unprätentiös und klar, aber leider voller sinnloser Satzzeichen und falscher Konjunktive, Satz- und Rechtschreibfehler, auch einige peinliche und einige sachliche Fehler sind darunter. Dem Autor ist das zuletzt anzulasten: Für ein komplexes Werk muss man so vieles auf einmal im Kopf behalten, dass es fehlerfrei nun einmal nicht abgeht. Ordentliche Verlage wissen das und unterhalten deshalb ein Lektorat.
Es muss nicht unbedingt ein wissenschaftliches sein, aber auch ein Sachbuch-Lektor würde leicht ergoogeln, dass "Rafael" in Wirklichkeit Raffael hieß und nicht aus Urbio, sondern aus Urbino kam und dass Österreich-Ungarn Bosnien-Herzegowina bei der Annexion 1908 schon seit 30 und nicht erst seit 20 Jahren besetzt gehalten hatte.