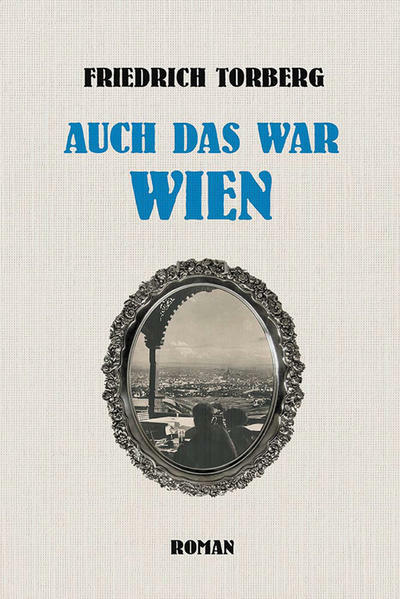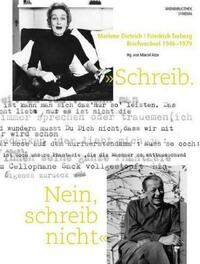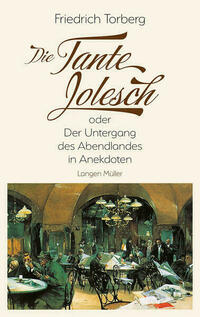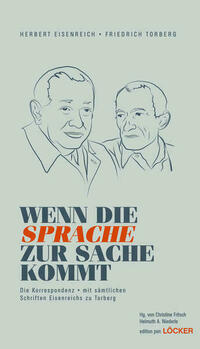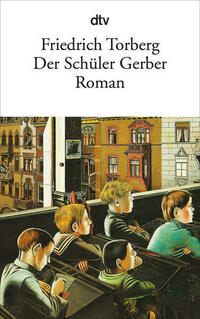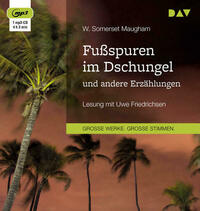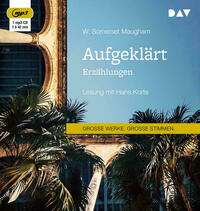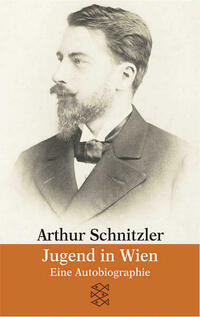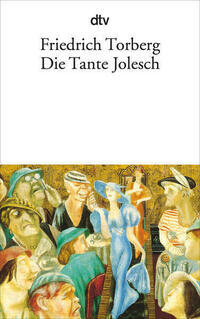„Tot oder lebendig: Alles war anders“
Michael Omasta in FALTER 10/2018 vom 07.03.2018 (S. 31)
Regisseur Wolfgang Glück war im März 1938 acht Jahre alt. Später arbeitete er im Film „38 – Auch das war Wien“ die Zeit auf
Der 11. März vor 80 Jahren fiel auf einen Freitag. Kurz vor 20 Uhr hielt Kurt Schuschnigg, hörbar um Fassung ringend, im Bundeskanzleramt seine knapp dreiminütige Abschiedsrede, die mit dem berühmt gewordenen Wunsch endete: „Gott schütze Österreich!“ Am nächsten Morgen überquerten deutsche Truppen – ohne auch nur auf den geringsten Widerstand zu stoßen – die österreichische Grenze. Damit war der „Anschluss“ de facto vollzogen.
„Alles war anders. Tot oder lebendig: alles war anders“, zeichnete der jüdische Schriftsteller Friedrich Torberg, der in diesen Tagen in Prag weilte, in seinem Roman „Auch das war Wien“ die veränderte Situation auf den Straßen und in den Herzen nach. „Die Stadt war eine andre Stadt, die Menschen waren andre Menschen – und was diese andern Menschen in dieser andern Stadt vollführten, hatte mit Stadt und Menschen nichts mehr gemein. Der große Höllenreigen war losgebrochen. (...) Hei was für Lärm wir machen, hei, heißah, heil, Siegheil, Heil Hitler, ein Volk ein Reich ein Führer, wir danken unserm Führer, Heil Hitler, heißah, hei.“
Wirklich die Märztage in Wien miterlebt hat Wolfgang Glück, damals gerade acht Jahre alt. „Wir hatten kein Radio“, schildert der bekannte Film- und Fernsehregisseur eine seiner frühesten Erinnerungen, „aber meine Großmama, im selben Haus oben, die hatte eines. Ich erinnere mich, dass mich meine Eltern früher als sonst, gleich nach dem Abendessen, ins Bett geschickt haben. Sie haben gesagt, sie gehen hinauf, um die Rede des Bundeskanzlers zu hören. Ein paar Minuten später bin ich aus dem Bett gehüpft und ihnen nachgelaufen: ‚Ich will bei euch sein!‘ – und dann hab ich behauptet: ‚Ich weiß doch sowieso, was los ist.‘“
Darauf, wie viel er, der kleine Wolferl, damals tatsächlich gewusst hat, will sich der heute 88-jährige Glück lieber nicht festlegen. Gefühlt, dass etwas passiert, hat er zweifellos. Dass es plötzlich Leute gab, die etwas gegen ihn und seine Familie hatten, weil der Großvater jüdisch war. „Ich besuchte den evangelischen Religionsunterricht, und das gar nicht ungern, muss ich sagen. Umso merkwürdiger war es für mich als Kind zu erfahren, dass ich von beiden Seiten der Familie her ‚jüdisch versippt‘ war und somit ein Mensch zweiten Ranges.“
Was in den Tagen und Wochen rund um den „Anschluss“ los war, davon erzählen Dutzende Sachbücher in allen Details. Auch literarische Dokumente existieren sonder Zahl. Unter ihnen kommt dem erwähnten Buch Torbergs insofern ein besonderer Stellenwert zu, als der Roman sehr zeitnah, auf der Flucht des Autors durch halb Europa entstand: Er begann im Mai 1938 in Prag mit der Niederschrift und setzte diese bis Juni 1939 in Zürich und in Paris fort. Erschienen ist er jedoch erst posthum, 1984. Zwei Jahre später wurde er von Glück unter dem Titel „38 – Auch das war Wien“ verfilmt und für den Oscar als bester nichtenglischsprachiger Film nominiert.
Für ihn, sagt der Regisseur, sei das ein ganz wesentlicher Abschnitt seines Lebens gewesen, deshalb habe er den Film über diese Zeit gemacht. Besonders schmerzhaft für den Buben war die Trennung vom Großvater, vormals Direktor des Kunsthistorischen Museums: „Ich hab ihn sehr geliebt und nie wiedergesehen. Er ist bald nach dem Krieg in Amerika gestorben. Er hatte überlebt, weil Paul Henreid, sein Schwiegersohn, damals schon ein recht bekannter Schauspieler in England war und sie herausholen konnte. So sind meine Großeltern im Sommer 1938 nach London gegangen und später weiter nach Kalifornien.“
Auch seine Eltern, erinnert sich Wolfgang Glück, wälzten Pläne und suchten einen Weg, das Land zu verlassen. Er selbst musste als Achtjähriger beginnen, Englisch zu lernen, doch weshalb, kam ihm komisch vor: Wollen wir denn nach England fahren? – Hoffentlich nicht. – Das lag so irgendwie in der Luft.
So sehr man sich zu Hause bemühte, ihm zu verheimlichen, wie schlecht es stand, so sehr hatte er Angst um seinen Vater. Als „Mischling ersten Grades“ durfte Franz Glück, der sich beim Verlag Anton Schroll & Co. bis an die Spitze hochgearbeitet hatte, keinen geistigen Beruf mehr ausüben.
Etwas anderes, Praktisches gar, hatte der Vater nie gelernt. Offiziell war er sieben Jahre lang arbeitslos, inoffiziell arbeitete er für den Kunstbuchverlag weiter, übersetzte aus dem Italienischen und wurde unter der Hand bezahlt. „Ich glaube, die Bücher waren der Grund, warum mein Vater letztlich gar nicht in die Emigration gehen wollte“, meint Wolfgang Glück. „Sie waren sein Schatz, sein innerer Schatz. Und das Gefühl, dass er durchkommen wird, hat ihn nie verlassen.“
Torbergs Roman erzählt eine Lovestory, im Hintergrund: die letzten Monate vor dem Untergang. Die Handlung setzt im Sommer 1937 in Salzburg ein. Der jüdische Autor Martin Hoffmann verliebt sich in die deutsche Schauspielerin Carola Hell. Nach lichtem Auftakt verdunkelt sich der Horizont. Cary, die an Politik „strahlend Desinteressierte“, gibt ein Gastspiel in Berlin und macht erstmals Bekanntschaft mit den Nazis. Martin in Wien kommt mit seinem neuen Stück für Carola nicht voran und tut sich auf Wunsch seines Verlegers mit zwei „auserlesenen Literatur-Briganten“ vom Café Herrenhof zusammen, um das Lustspiel „Die Träumerin“ zu vollenden. Zu der für Ende März angesetzten Premiere im Theater in der Josefstadt kommt es freilich trotzdem nicht mehr.
Unschwer lässt sich in Martin ein Alter Ego des Autors ausmachen, und in Cary das seiner damaligen Geliebten, der Schauspielerin Marion Wünsche. Interessanter als das Auf und Ab der Liebesgeschichte – Carola wird schwanger, das Paar bezieht in Döbling gemeinsames Quartier und trägt sich mit Heiratsgedanken – ist der Roman immer dann, wenn die Politik konkret ins Spiel kommt.
So etwa revanchiert sich Torberg, der als Drehbuchautor des „Pfarrers von Kirchfeld“ (1937) nur noch unter Pseudonym arbeiten konnte, bei den Wiener Filmgesellschaften, indem er Carola ein Engagement annehmen und Martin dieses wie folgt kommentieren lässt: „Kein ‚verhältnismäßig‘ milderte diese Groteske. Es war, trotz Wiener Produktion, trotz Wiener Atelier und Regisseur und Besetzung, trotz aller Hervorkehrung der ‚österreichischen Note‘ –: es war zum Schluss natürlich ein Nazi-Film, der da gedreht werden sollte, ein Film, der bis ins letzte Detail den Nazi-Vorschriften entsprechen musste, ein Film, der für Deutschland bestimmt war und daher von Deutschland bestimmt wurde.“
Abgesehen von dieser treffenden Analyse der österreichischen Filmproduktion, für die der „Arierparagraph“ auch vor 1938 schon Gültigkeit besaß, überzeugt der Roman generell mehr als Film noir denn als Melodram: Je weiter die Handlung voranschreitet, desto stärker spürbar wird das Bewusstsein dafür, was es bedeutet haben mag, quasi über Nacht zum Freiwild geworden zu sein. „Martin vermeint es spüren und greifen zu können, als er die Straße betritt. Andre, gefährlichere Blicke heften sich ihm entgegen aus andern, gefährlicheren Gesichtern. Tatsächlich: Es sind andre Gesichter. Tatsächlich: Es sind andre Menschen.“
Eben darauf, meint Wolfgang Glück, ziele der Titel des Romans ab. Es gab nicht nur das kitschige, das fortschrittliche, soziale und intellektuelle Wien sondern – „auch das war Wien“. Mit seinem Film „38“, heißt es in einem Statement des Regisseurs, habe er „die Beweggründe der handelnden Personen sichtbar machen“ wollen. Nicht verständlich, nur erkennbar. Die Widersprüche aufzeichnen.“
Ursprünglich nannte Torberg den Roman „Die versunkene Stadt“; unter diesem Arbeitstitel erschienen im Frühjahr 1939 ein paar Kapitel als Vorabdruck in einer österreichischen Exilzeitschrift. Doch sämtliche Bemühungen, einen Verlag für das Manuskript zu interessieren, schlugen fehl. Schließlich verkaufte Torberg die Rechte gegen einen kleinen Vorschuss an den nach New York emigrierten Wiener Verleger Otto Kallir.
Nur wenige Tage später brach mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg los. Torberg meldete sich zur tschechischen Exilarmee in Frankreich, wurde aber wegen Herzbeschwerden bald dienstfrei gestellt und gelangte im Herbst 1940 dank eines rettenden Emergency Visa in die USA. Eine Übersetzung des Romans („Last Love in Vienna“) kam nie zustande, erst nach dem Tod des Autors 1979 tauchte das Manuskript wieder auf.
Wolfgang wechselte 1939 von der Volksschule Strohgasse im Dritten ans Akademische Gymnasium. „Der erste Kriegstag, 1. September, war der erste Schultag. Der Direktor des Gymnasiums war ein SS-Mann, er trug schwarze Uniform. Auch in der Klasse haben wir Buben schnell heraus gehabt, wer Nazi ist und wer nicht: Man hat ja gewusst, ob einer beim Sportunterricht auf der Birkenwiese das Horst-Wessel-Lied begeistert mitsingt, oder ob jemandes Vater vorher Arzt oder Universitätsprofessor war, jetzt aber nicht mehr ...“
Manche der seinerzeit geschlossenen Freundschaften halten bis heute. Etwa die mit dem Sohn eines jüdischen Notars. Otto Schenk besuchte das Gymnasium auf der Stubenbastei – und den Eislaufverein. Dort lernten sich der spätere Schauspieler und der spätere Regisseur, die nach dem Krieg – oft auch gemeinsam – Fernsehgeschichte schreiben sollten, kennen. „Es gab so Gruppen, geheime Netzwerke unter Gleichaltrigen“, erinnert sich Glück. Dass er von einem Verwandten, der bei Siemens arbeitete, ein Detektor-Radio geschenkt bekommen hatte, vertraute er den Freunden allerdings nicht an. „Es hat jedesmal 20 Minuten gedauert, bis man einen Sender wiedergefunden hat, aber dann hörte ich: ‚BamBamBamBam – hier ist London mit seiner Sendung für Österreich‘. Zuerst wollte ich vor meinem Vater geheimhalten, dass ich BBC horche. Er hat’s natürlich eh gewusst. Manches hat er mir auch nicht geglaubt. Als ich zum ersten Mal von Konzentrationslagern gehört und es ihm erzählt hab, da hat er gemeint: ‚Komm, komm, das ist Propaganda.‘“
Friedrich Torberg kehrte 1951 als kalter Krieger nach Österreich zurück. Schon in Amerika hatte er sich dem OSS (der späteren CIA) angedient, Brecht und andere Exilanten als „kommunistische Schlieferl“ denunziert. Zu den bevorzugten Zielen seines Geiferns gehörte Berthold Viertel, der nach seiner Remigration am Burgtheater inszenierte und den jungen Wolfgang Glück dabei als Regieassistenten aufnahm.
„Torberg war unbremsbar“, sagt dieser heute, „anders als Hans Weigel, sein Mitstreiter, mit dem ich sehr gut war. Uns junge, den Otto Schenk oder mich, haben sie ja auch nicht als Feinde gesehen, aber meinen Eltern hat dieses rabiate Klima, die ständige Hetzjagd gewisser Zeitungen auf alles Linke zu schaffen gemacht: Mein Vater war Direktor des Museums der Stadt Wien, meine Mutter leitete den Österreichischen Friedensrat – sie waren beide sehr links.“
30 Jahre und viele Zufälle später sprang Glück bei „Der Schüler Gerber“ (1981) als Regisseur ein. Torberg, der noch selbst das Drehbuch geschrieben hatte, erlebte die Premiere nicht mehr. Doch der Erfolg dieses Kinofilms verlangte sozusagen nach einer Fortsetzung: „38“ mit Sunnyi Melles und Tobias Engel – dem Spross eines Mitglieds der A-cappella-Formation Comedian Harmonists – in den Hauptrollen.
Dass der Film ein internationaler Erfolg wurde, ist die eine Sache. Dass es kein richtig guter Film ist, die andere. Findet auch Wolfgang Glück, der für den Part des jüdischen Autors einen anderen, kurz vor Drehbeginn leider verunglückten Darsteller vorgesehen hatte: „Am Ende wird Martin Hoffmann auf der Straße von den Nazis verhaftet, aber so, wie er gespielt ist, liebt man ihn als Zuschauer einfach nicht.“
Letztlich erreicht der Höllenreigen des März 38 auf der Leinwand nie eine so finstere Dichte wie im Roman. – „Wie wenn ein Film im Ablauf jählings innehält, inmitten des bewegten Bilds – es ist noch alles da, was dazugehört, es ist noch alles so, als bewegte es sich – und bewegt sich doch nicht, sondern steht – und steht doch auch nicht, sondern ist nur in unterbrochener Bewegung, gespenstisch und grotesk und atemlos –: so stockte und gerann der große Höllenreigen.“