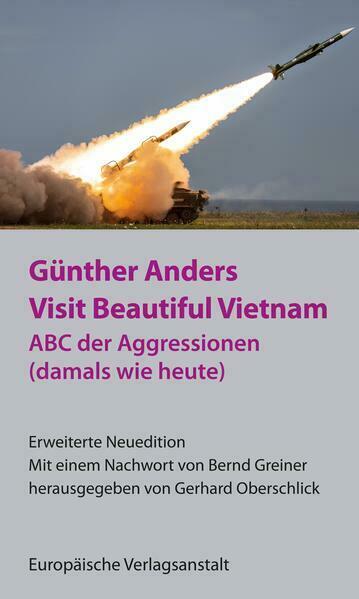Der Mensch im Zeitalter seiner technischen Auslöschbarkeit
Klaus Nüchtern in FALTER 26/2023 vom 28.06.2023 (S. 27)
"Es gibt nichts Erbärmlicheres als den Wunsch, moralisch sauber zu bleiben." Ein solcher Satz aus der Feder eines so rigorosen Moralisten wie Günter Anders mag aufs Erste verwundern. Er bezieht sich freilich auf die Kuratoren einer US-amerikanischen Privatuniversität, die ihren Forschungsauftrag zur biologischen Kriegsführung während des Vietnamkriegs an eine andere Institution weitergereicht hatten, um sich selbst nicht die Finger schmutzig zu machen. Die Kant'-sche Frage "Was ist der Mensch?" führte den Philosophen Anders, der bei Martin Heidegger und Edmund Husserl studiert hatte, nicht zur Postulierung einer überzeitlichen gedachten Menschennatur, sondern zu einer "negativen Anthropologie": Was uns als Menschen ausmacht, sind die historischen und technischen Gegebenheiten, unter denen wir zu leben haben. In seinem Hauptwerk "Die Antiquiertheit des Menschen", dessen zwei Bände 1956 und 1980 erschienen, reflektiert Anders über die Folgen der Technik - gedacht als ein Universum miteinander verbundener Geräte -für die Handlungsspielräume und das Imaginationsvermögen des Menschen.
Der Befund fällt ausgesprochen pessimistisch aus: Begriffe wie "Apokalypseblindheit" oder "prometheische Scham" verweisen darauf, dass die von ihm selbst geschaffenen Dinge dem Menschen haushoch überlegen und in ihren Folgen nicht mehr zu durchschauen, geschweige denn zu kontrollieren sind. Der Sohn eines deutschjüdischen Psychologenehepaars, der eigentlich Günter Siegmund Stern hieß, ein Cousin des deutschen Philosophen Walter Benjamin und in erster Ehe mit der Polittheoretikerin Hannah Arendt verheiratet war, erlag freilich nie den Verlockungen einer apart "post-humanistischen" Endzeitphilosophie. Er, der es als größtes Bedauern seines Lebens bezeichnete, Hitler nicht getötet zu haben, war als Vordenker und Aktivist der Anti-Atom-Bewegung stets auf die Erweiterung von Handlungsspielräumen und politische Intervention bedacht, was Formen des zivilen Ungehorsams und der Gegengewalt miteinschloss. In Zeiten der Klimakatastrophe und der Künstlichen Intelligenz bleibt sein Denken, das um die "Antiquiertheit des Menschen" kreiste, beklemmend aktuell.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: