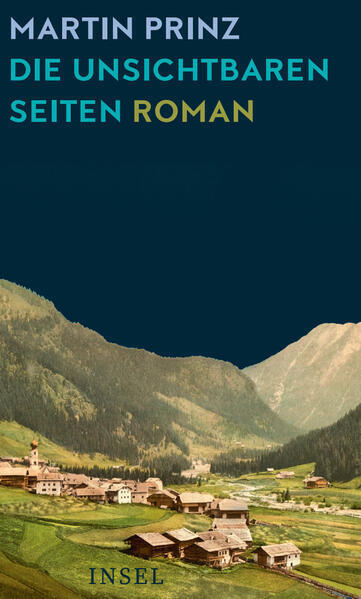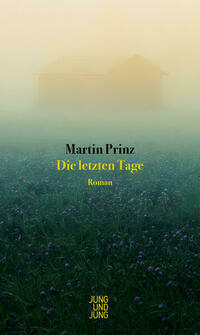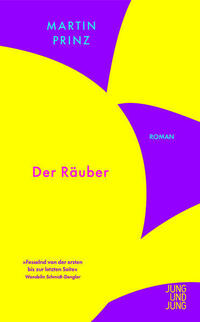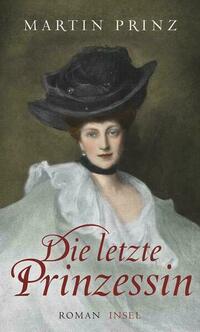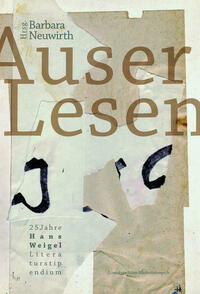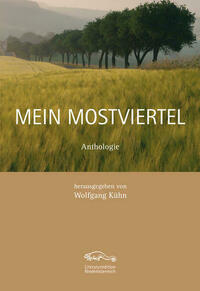Kaiser, König, Bürgermeister
Sebastian Fasthuber in FALTER 20/2018 vom 16.05.2018 (S. 33)
„Die unsichtbaren Seiten“ von Martin Prinz ist ein realistischer, also schonungsloser Heimatroman
Das niederösterreichische Lilienfeld ist mit 3000 Einwohnern ein Dorf. Wegen eines Stiftes und in Ermangelung anderer bedeutender Gemeinden im Umkreis ist es dennoch Bezirkshauptstadt und beheimatet ein Gymnasium.
In dieser Stadt spiegeln sich die heimischen Verhältnisse. An ihr lassen sich etwa Aufstieg und Krise des heimischen Nationalsports ablesen. Einst war es der Lilienfelder Mathias Zdarsky (1856–1940), der den modernen Skilauf mitbegründete. Knapp hundert Jahre später, in den 1990ern, war Lilienfeld wegen der schneearmen Winter dann Pioniergemeinde im Abschalten von Skiliften. Es hat etwas Nostalgisches, dass es bis heute eine Skimittelschule gibt. Namenspatronin ist die einstige Absolventin Michaela Dorfmeister.
Ein anderes Kind der niederösterreichischen Stadt ist Martin Prinz. Bekanntheit erlangte er gleich durch seinen ersten Roman „Der Räuber“. Die Geschichte des österreichischen Läufers und Bankräubers Johann Kastenberger wurde später auch verfilmt. Was als Karriere vielversprechend begann, geriet bald außer Tritt. Eines Tages stand Prinz ohne festen Verlag da, was ihn erst recht in eine Schreibkrise stürzte. Er überquerte zu Fuß die Alpen, verfasste ein Buch darüber.
Der 2016 veröffentlichte Roman „Die letzte Prinzessin“ leitete den Umschwung ein. Prinz fand bei Insel, dem Schwester-Verlag von Suhrkamp, eine neuen literarischen Hafen. Mit „Die unsichtbaren Seiten“ folgt nun das veritable Comeback. Im Mittelpunkt steht diesmal statt einer Prinzessin „der kleine Prinz“ von Lilienfeld. So wurde der Autor in der Unterstufe tituliert.
Stimmt das Bild von der Kleinstadt als Dorf, dann ist Martin Prinz als Enkel des Lilienfelder Dorfkaisers aufgewachsen. Der Großvater war über drei Jahrzehnte Bürgermeister und federführend an vielem beteiligt, was die Gemeinde bis heute prägt, etwa die Ansiedlung des Gymnasiums. Auf der Straße begegneten die Menschen dem Knirps folglich mit Bewunderung. Dass es oft vielleicht eine gespielte Form davon war, fällt einem in dem Alter nicht auf. Die Rolle des Kaisers war besetzt, als mächtiger Monarch empfand sich aber auch der junge Martin Prinz. Der Roman hebt an mit dem Bild des Kindes, das sich in der Pausenhalle im Kreis dreht, und sagt: „Ich bin der König.“ Rasant wechseln Vergangenheits- und Gegenwartsform, Nähe und Distanz. Prinz tut sich offenbar leicht, den kleinen Buben in sich wieder wachzurufen. Er betont aber auch, dass Erinnerung etwas Konstruiertes ist und gerade, was die ersten Lebensjahre betrifft, auf Erzählungen von Eltern und Großeltern beruht.
„Die unsichtbaren Seiten“ ist denn auch keine große Erzählung. In bruchstückhafter, nicht chronologischer Form leistet es jedoch eine Menge, ist Entwicklungsroman, Familiengeschichte und ein Buch über die Zweite Republik in einem. Zusammen ergibt das einen realistischen, also schonungslosen Heimatroman. Schonungslos nicht zuletzt sich selbst und den Eigenen gegenüber.
Das Material dafür musste Prinz nicht erfinden. Neben der bürgerlichen Seite der Familie gibt es auch eine Hälfte, die aus der proletarischen Nachbargemeinde Traisen stammt. Diese wird von einer Stahlfabrik und Schichtarbeit bestimmt und verbindet mit Lilienfeld eine alte Rivalität. Den Namen Prinz verdankt der Autor ausgerechnet dem aus Traisen stammenden Vater. Dessen Mutter wäscht nach dem Krieg die Wäsche ihrer späteren Schwiegertochter. Was die eine Seite nicht bieten kann, holt sich das Kind auf der anderen. Die Mutter kocht zu gesund? Es wünscht sich von der Oma väterlicherseits zum Geburtstag ein Kilo Extrawurst. Als jugendlicher Fehlstundenanhäufer und Autor in spe hätten die Sympathien erst recht Richtung Traisen tendieren müssen. Indes: „Als Lilienfelder Revoluzzer blieb ich (…) der querdenkerische Enkel des Altbürgermeisters, der sich im Zweifelsfall für den Traisner Teil seiner Familie sogar schämte.“
Wie schnell die ÖVP diesen Altbürgermeister vergaß, weil er sich am Ende seiner politischen Laufbahn gegen einen Wunsch der Partei stellte, ist ein eigenes Kapitel. Noch mehr erzählt das Buch aber davon, wie einer zum Autor wird. Den Weg dorthin weist ihm unbändiges Lesen. Schon als Volksschüler hat Prinz dunkle Augenringe, weil er heimlich die halbe Nacht liest. Er verschlingt alles, was ihm in die Finger kommt: „Nichts trauriger als eine ausgelesene Zeitung.“
Nicht alles an dem Roman ist gelungen. Manchmal, vorrangig am Ende von Kapiteln, schwingt sich Prinz, der den Ball stilistisch ansonsten flach hält, in lichte Höhen auf. Dann will er plötzlich doch große Bilder erzeugen, was nicht zu diesem angenehm kleinen Buch passen will, und verliert sich in verschachtelten Sätzen und unnötig umständlichen Formulierungen.
Viel zwingender sind die Passagen, in denen er die Dinge auf den Punkt bringt. Während der Traisner Opa mit dem Tod ringt, ist der Neunjährige völlig versunken in das Panini-Album zur Fußball-Weltmeisterschaft 1982: „Dass der Großvater im Sterben lag oder in den Augenblicken vielleicht bereits tot war, minderte meine Konzentration nicht.“