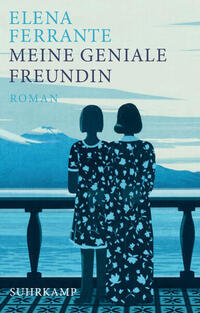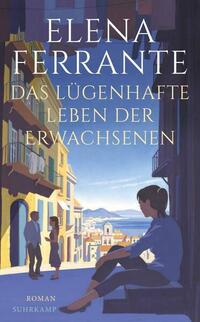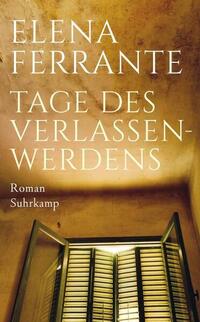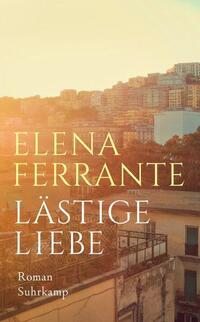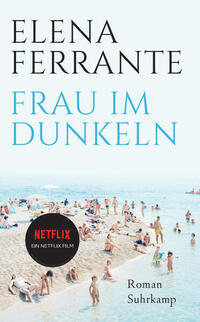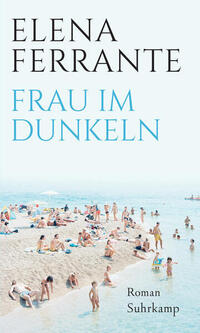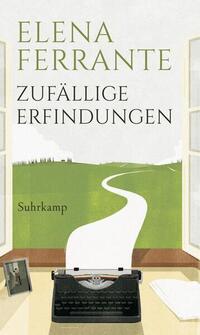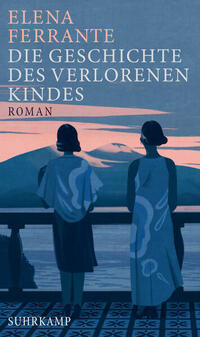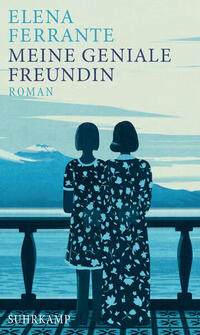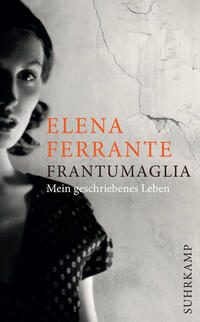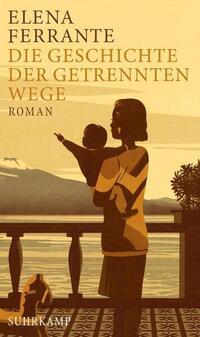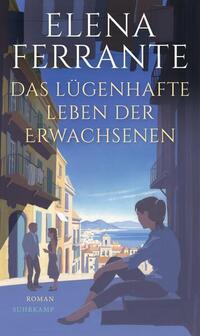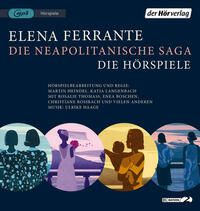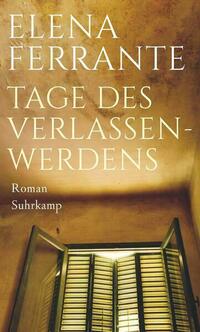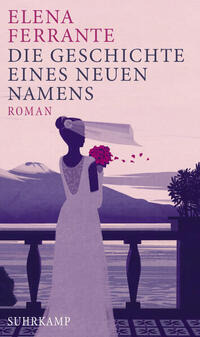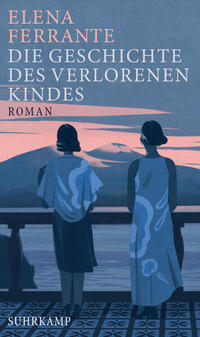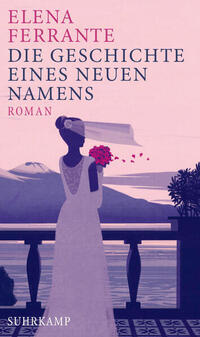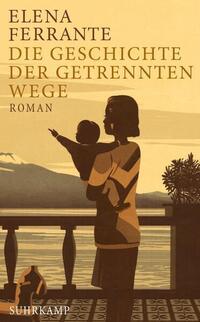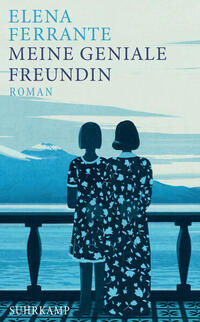Zwei Mädchen in den Straßen von Neapel
Matthias Dusini in FALTER 41/2016 vom 12.10.2016 (S. 26)
Teil eins der vielbejubelten Tetralogie „Meine geniale Freundin“ der mysteriösen Elena Ferrante liegt nun auch auf Deutsch vor
Der Roman sei das beste Porträt einer Frauenfreundschaft, das einem in der Literatur jemals begegnete, urteilte der Guardian, und die Zeit bezeichnete Elena Ferrantes „Meine geniale Freundin“ als „epochales literaturgeschichtliches Ereignis“. Auch die Position des Nörglers ist schon besetzt, etwa durch die SZ, die das sich an den Erzählrealismus des 19. Jahrhundert anlehnende Epos des Kitsches verdächtigte.
Begeisterung und Ablehnung – einen beschwingteren Einstand hätte die 2000 Seiten umfassende Tetralogie der italienischen Schriftstellerin nicht haben können. Ab 2011 im Italienischen erschienen, avancierte Ferrantes Tetralogie in den USA zum Bestseller und erscheint jetzt auf Deutsch im Suhrkamp Verlag. Die Anonymität der Autorin – Elena Ferrante ist ein Pseudonym – lieferte den Rezensenten einen zusätzlichen Anreiz, Partei zu ergreifen: Für die Fans ist die Verfasserin eine authentische Chronistin, für ihre Kritiker eine Kunsthandwerkerin, die Versatzstücke weiblicher Biografien zu einer Projektionsfläche für emanzipierte Leserinnen zusammenfügt.
Die Geschichte zweier Freundinnen spielt im Neapel der Nachkriegszeit, als der beginnende Konsumismus über eine vormoderne Gemeinschaft hereinbricht. Die geniale Freundin ist Raffaella Cerullo („Lila“), die wie die Ich-Erzählerin Elena Greco („Lenù“) im Subproletariat aufwächst. Bei einem neapoletanischen Rione, wie die Stadtviertel genannt werden, denkt man heute an die suburbanen Camorra-Berichte von Roberto Saviano. Ferrante hingegen schildert die Vorgeschichte der organisierten Kriminalität in den düsteren Rioni der Altstadt: die alltägliche Brutalität, die ökonomische Aussichtslosigkeit, die Abwesenheit staatlicher Ordnungskräfte.
Erzählerin ist die 64-jährige Lenù, die sich erinnert: „Ich sehne mich nicht nach unserer Kindheit zurück, sie war voller Gewalt.“ Einmal wirft Lilas Vater seine Tochter kurzerhand aus dem Fenster, was diese nur knapp überlebt.
Die Freundschaft zwischen der fleißigen Schülerin Lenù und der außergewöhnlich begabten, aber aufmüpfigen Lila entwickelt sich als Kontrapunkt zu den starren Riten in den Familien und auf der Straße. Der romantische Mythos der Männerfreundschaft wird hier am Beispiel zweier Mädchen durchgespielt: als ständiges Vergleichen, mit Neid, Bewunderung und Kampf um Anerkennung.
Das Geheimnis von Ferrantes Erfolg liegt in den Details. Das Buch schildert das Glück und die Enttäuschung zwischen besten Freundinnen, jenes Auf und Ab der Zurückweisung und der Versöhnung, das jeder Leser, jede Leserin aus eigener Erfahrung kennt. Mit leidenschaftlichem Interesse schildert die Erzählerin auch die Eltern und Geschwister, Freunde und Nachbarn der Protagonistinnen, die schielende, schlechtgelaunte Mutter Lenùs oder den fleißigen, aufmerksamen Sohn des Lebensmittelhändlers.
Wenn in der Fantasie eines Mädchens ein Kupfertopf zerspringt, um damit den Zustand permanenter Angst zum Ausdruck zu bringen, lässt sich darin eine Reminiszenz an den Magischen Realismus der Zwischenkriegszeit erkennen. Auch eine Nähe der Autorin zum Neorealismus der Nachkriegszeit ließe sich konstatieren; die Anonymität befeuert die Spekulationen über Ferrantes literarische Heimat.
Ein Hinweis auf das ästhetische Programm der Autorin findet sich in einem Urteil Lenùs über die Texte Lilas: „Die Künstlichkeit des geschriebenen Wortes war nicht zu spüren. Beim Lesen sah und hörte ich tatsächlich sie. Ihre schriftlich eingefasste Stimme packte mich, fesselte mich noch stärker, als unsere Gespräche von Angesicht zu Angesicht es taten.“ Der Versuch, ein Vorbild zu imitieren oder gar zu übertreffen, als Übung in literarischer Wahrhaftigkeit.
Der Anachronismus von „Meine geniale Freundin“ besteht darin, dass er das Lesen und Schreiben als Möglichkeit der Emanzipation feiert. Wo sollte ein solcher Bildungsroman anknüpfen, wenn nicht an den Genreglanzstücke des 19. Jahrhunderts? Das Buch ist weder Meisterwerk noch Trivialliteratur, sondern ein formal höchst reflektiertes Stück Unterhaltung.