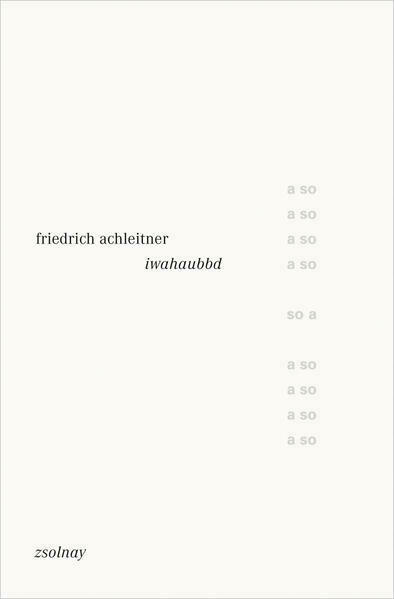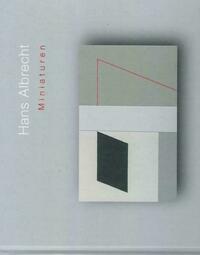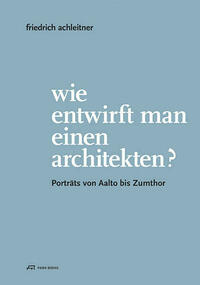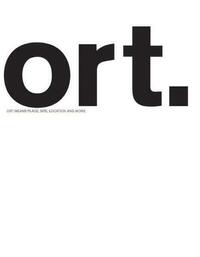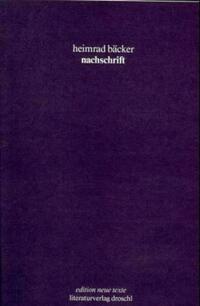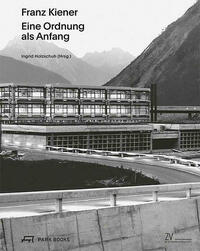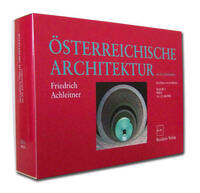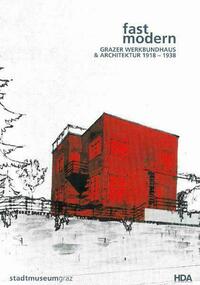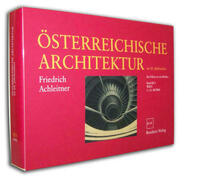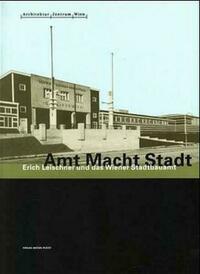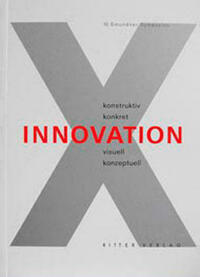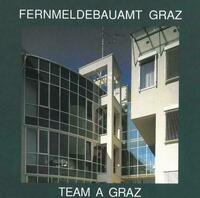Kleine Ekstasen in kargen Gefühlswelten
Erich Klein in FALTER 41/2011 vom 12.10.2011 (S. 9)
Lyrik aus Österreich I: Friedrich Achleitners
furiose Innviertler Dialektgedichte "iwahaubbd"
Zu einfach wäre es, Friedrich Achleitner mit seinen frühen Dialektdichtungen aus "hosn rosn baa" (1959), den experimentellen "konstellationen" und "montagen" aus den 1970er-Jahren, dem "quadratroman" (1973) und der Kurzprosa der letzten Jahre zum Klassiker der zeitgenössischen Literatur zu erklären.
Ungesagt bliebe dabei, dass Achleitner sich nicht nur auf die Tradition der klassischen Moderne bezog, sondern sie selbst auch fortsetzte. Ihn mit Adolf Loos und Ludwig Wittgenstein, Robert Musil oder Anton von Webern in einem Atemzug zu nennen, würde auch jenen gerecht. Kurz: Der Autor Friedrich Achleitner, das ist – non multa, sed multum! Ganz besonders trifft das auf ein ob seiner Popularität unterschätztes Genre zu, die Dialektgedichte.
Die in "iwahaubbd" versammelten, aus sechs Jahrzehnten stammenden Texte haben dabei mit Mundartdichtung nichts gemein. Achleitners Neuerfindung des Dialektgedichts, das immer auch einen Spiegel austriakischer Befindlichkeit darstellte, setzt, nach dem großen Zivilisationsbruch der Nazis, in den 1950er-Jahren ein, nach der Übersiedlung nach Wien. Die Rückübersetzung des Gedichts in die Muttersprache erfolgte wie alle wirkliche Veränderung von unten.
Das Ausgangsmaterial war denkbar roh. Der Innviertler Dialekt war nicht nur eine vor allem durch die Arbeitswelt geprägte Sprache, er verfügte kaum über Gefühlswelten. "Gesprochen wurde höchstens in Andeutungen mit einer Portion kultivierter Hinterfotzigkeit", so Achleitner. Im künstlerischen Biotop der Akademie am Schillerplatz, wo er studierte, und der rasch zueinanderfindenden Wiener Gruppe nahm der Dialekt die Form moderner experimenteller Literatur an.
Ein früher Achleitner-Text, der bis heute nichts an Lebendigkeit verloren hat, variiert sechs Mal drei Wörter: "wos / na / ge". Am Ende der Permutation war eine Welt wahrhaft umgestürzt, auch wenn sich kaum etwas geändert hatte: "na / ge / wos". Dabei war es auch möglich, Kindheitserinnerungen aus dem oberösterreichischen Schalchen nach Wien zu schmuggeln, die wie Surrealismus anmuteten: "um middanocht / auf da friedhofsmau / buddlnogad / woans koed is / und schnaibd / und da wind geht // bfui daifö".
Gelegentlich wurde gehörig kalauert, und die Worried Men Skiffle Group führte Achleitners "i bin a wunda" in die Höhen des Austropop. Doch was da abwechselnd als eher experimentelles Dialektgedicht, als "Schnodahibbfö" oder "Gschdanzl" entstand, war vor allem Literatur in Reinform – ohne alle politische Überhöhung und Ideologisierung. Achleitner betrieb sprachbewusste Textarbeit, die Sprache vor allem beim Wort nahm.
Bei all dem scheute er nie den ohnehin unvermeidbaren existenziellen Gestus. Mochte sich auch "wuazzlschdog" auf "minirog" reimen, es braucht einen sehr bewussten Umgang mit "Volksweisheiten", um Gedichte wie das titelgebende zu schreiben: "iwahaubbd iwahaubbd / hods den ins hian naigschdaubd / immahin immahin / is iazd wos drin". In der Spannung zwischen Aggression und Resignation triumphiert die Ironie. Mit dem über Jahre hinweg entstandenen Work in progress "innviaddla liddanai" hat Friedrich Achleitner das vermutlich längste, sicher aber ekstatischste Gedicht der österreichischen Literatur verfasst.
Manche der Wortspiele, die aufgrund ihrer Beschwörung einer mitunter längst verschwundenen Welt auch einen fast ethnografischen Charakter besitzen, lassen sich auch auf traditionelle Weise lesen. Etwa als Liebesgedichte: Dabei stand nicht Heine Pate, gewiss nicht Rilke, eher der rüde Bert Brecht als Minnesänger: "kuschschl dö / aina // und / ziag dei ruadalaiwö / aus // woass das ee".
Dasselbe geht am Land, wenn nötig, noch kürzer: "mari / do / wari". Hier ist alles ist klar, alles ist offen, alles ist ein Gedicht.