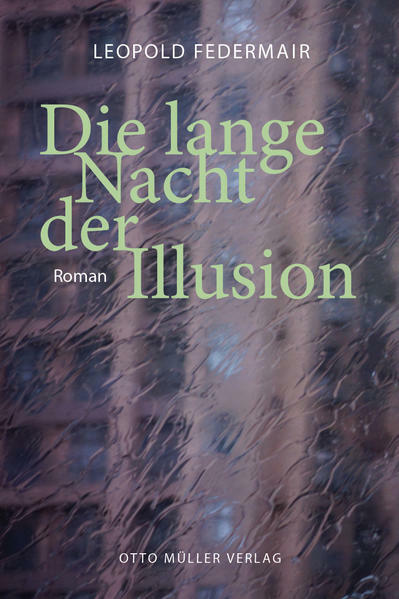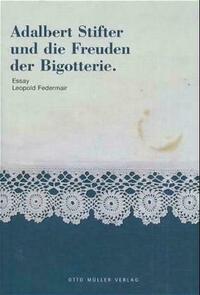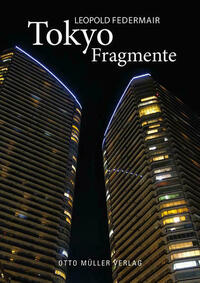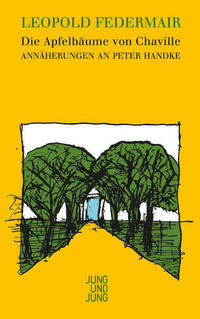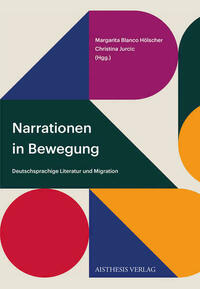Kommt uns alles sehr japanisch vor
Florian Baranyi in FALTER 11/2020 vom 11.03.2020 (S. 14)
Leopold Federmairs jüngster Romanheld ist so sprachkundig, belesen und gebildet wie sein Autor
Leopold Federmair, als Übersetzer unter anderem aus dem Französischen (Michel Houellebecq), Spanischen (Ricardo Piglia) und Italienischen (Leonardo Sciascia) eine fixe Größe in der Literaturvermittlung, konstruiert in „Die lange Nacht der Illusion“ eine Geschichte rund um den polyglotten Übersetzer Theo, dessen japanische Frau Yuuki und deren gemeinsame Tochter Yoko.
Theo, der mit dem Autor nicht nur den Beruf, sondern auch die familiäre Konstellation und den Lebensmittelpunkt Japan teilt, präsentiert sich im ersten Teil des Romans als Herausgeber eines Manuskripts seiner Frau, das den zweiten Teil des Romans bildet. Und bereits hier, auf den ersten Seiten, beginnen die Probleme des Romans. Theo erzählt vornehmlich von sich selbst. Von seiner weit zurückliegenden Dissertation ist die Rede, allgemeine Betrachtungen über seine Beziehungsbiografie werden aneinandergereiht, die Theo aber sofort wieder als Plattitüden entlarvt. Das Ganze ist von intellektuellen Bezügen überfrachtet, auf wenigen Seiten werden Umberto Eco, Michel de Montaigne, Rene Descartes und Jorge Luis Borges aufgerufen, ohne dass diese Ansammlung von Bildungsballast plausibel machen würde, wozu und wovon hier erzählt wird.
Auf ähnliche Weise geht es dann mit der Geschichte Yuukis weiter. Während Theo im ersten Teil als Ich-Erzähler auftritt, wird das angeblich von Theo gefundene Manuskript personal erzählt. Warum Yuuki, die sich aus Sprachen und Literatur wenig macht, die Geschichte ihres berufsbedingten Umzugs in den Süden Japans als literarische Erzählung in der dritten Person und nicht etwa als Tagebuch ausgestaltet, entfaltet innerhalb des Romans keine Logik.
Noch dazu sind ihre Erfahrungen im leistungsorientierten und patriarchal strukturierten japanischen Büroalltag von Reflexionen zu Übersetzungsproblemen durchsetzt, die Theo dann auch noch in Fußnoten kommentiert. Kurz: Alle Erzähler des Romans sprechen mit derselben Stimme. Noch dazu erinnert die Erzählstimme dermaßen an Federmair selbst, dass es hier eines spielerischen Umgangs mit den Parallelen zwischen Fakt und Fiktion bedurft hätte, um die literarische Konstruktion interessant zu gestalten.
Yuuki reflektiert ihr einsames Leben in einer Gated Community, in der die Nachbarn sich gegenseitig belauern und Konflikte über die Frage der korrekten Abfallentsorgung austragen. Ansonsten kreisen ihre Gedanken um das Älterwerdden, die unglückliche Ehe, den Schmerz darüber, dass die gemeinsame Tochter Yoko seit ihrem Umzug nichts von ihr wissen will.
Der dritte Teil des Romans hat wieder Theo zum Protagonisten. Auch hier wird plötzlich personal erzählt, obwohl Theo zunächst als Ich-Erzähler eingeführt wurde. Er fristet seine Tage damit, sich an einer Übersetzung von Yukio Mishimas Roman „Kinkakuji“ zu versuchen, scheitert aber daran, weil sein Japanisch den Anforderungen nicht genügt. Hier erfahren wir, dass auch Theo seine liebe Not im Umgang mit der Tochter hat. Ansonsten strotzt der Abschnitt vor Abschweifungen zu kleineren Übersetzungsproblemen aus dem Englischen, Französischen, Spanischen und Japanischen ins Deutsche sowie exzessivem Namedropping.
Ein Autor, der es dem desperaten Übersetzer besonders angetan zu haben scheint, ist Jorge Luis Borges, über dessen Geschichten „Das Aleph“ und „Pierre Menard, Autor des Quijote“ eifrig referiert wird.
In seinem Essay „Der argentinische Schriftsteller und die Tradition“ hat Borges sich entschieden gegen Lokalkolorit in der Literatur ausgesprochen – mit dem Argument, dass im Koran, dem „arabischsten“ aller Bücher, kein Kamel vorkomme. Die Befolgung dieses Rats in „Die lange Nacht der Illusion“ hätte Leopold Federmair gut getan. Allenthalben wird Japanisches aufgerufen, benannt, gegessen, übersetzt, ganz so, als müsste der Leser überzeugt werden, dass dieser Roman wirklich Japan zum Schauplatz hat.
Dominika Meindl in FALTER 9/2020 vom 26.02.2020 (S. 34)
Yuuki ist im Dienst ihrer Firma nach Kyushu, in den Süden Japans gezogen. Selten denkt die Einzelgängerin an ihre halbwüchsige Tochter Yoko und ihren Mann Theo, die sie ohne großen Schmerz verlassen hat. In Tokio kämpft der Österreicher Theo mit dem Japanischen im Allgemeinen und der Übersetzung von Yukio Mishimas „Tempelbrand“ im Besonderen. Ihm geht es wie den Gastarbeitern, die am Ende gar keine Sprache mehr richtig beherrschen. Er wird hier immer ein Fremder bleiben.
Leopold Federmair, dem die Figur Theos nahesteht, ist einer der Fleißigsten seiner Branche. Das erstaunt angesichts der Qualität und Vielfalt der Ergebnisse. Der gebürtige Welser, der Deutsch an der Uni in Hiroshima lehrt, hat sich auch als Vermittler zwischen Österreich und Japan einen Namen gemacht. Aus seinen Romanen erfährt man mehr über japanische Eigenheiten als aus jenen Haruki Murakamis