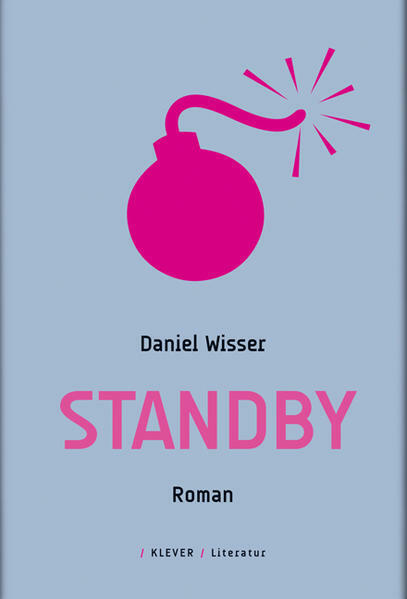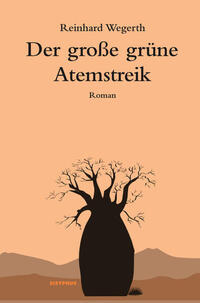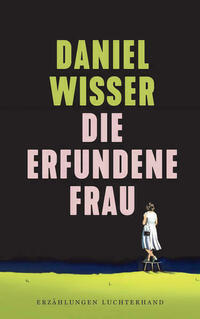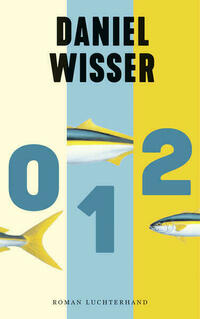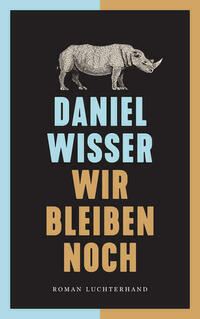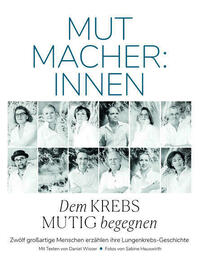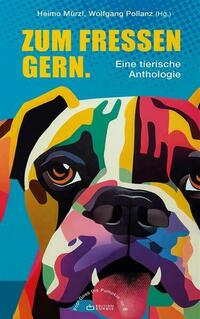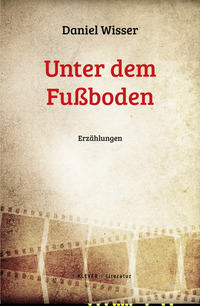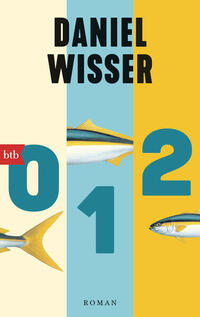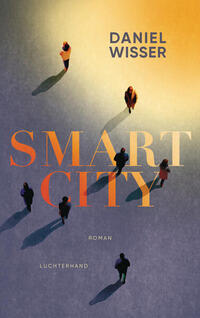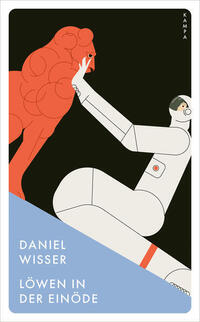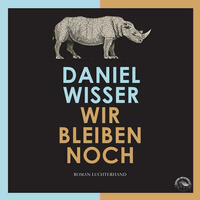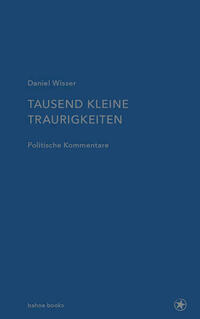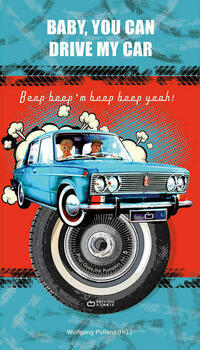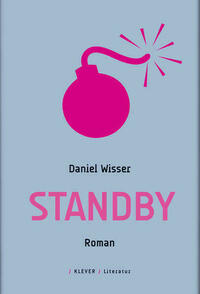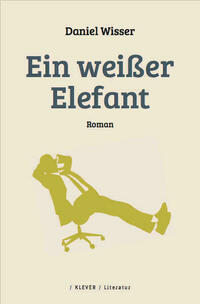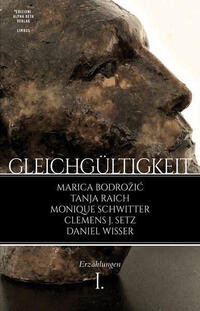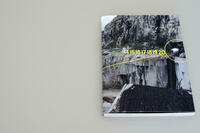Ein ganz normaler Neurotiker
Daniela Strigl in FALTER 41/2011 vom 12.10.2011 (S. 10)
Daniel Wisser hat mit "Standby" den etwas anderen und sehr passiven Büroroman geschrieben
Er weiß: Wer immer sagt, "das Schlimmste ist bereits überstanden", lügt. Die Banken werden zusammenbrechen, mit ihnen die Geldwirtschaft, den Kampf ums Überleben werden jene gewinnen, die beizeiten mit Vorratshaltung und landwirtschaftlicher Selbstversorgung begonnen haben. Er hätte das ja längst getan, würde seine Frau seine Bedenken nur ernst nehmen – und kämen ihm nicht dauernd allerlei Imponderabilien des Alltags dazwischen.
Der Held in Daniel Wissers neuem Roman leitet das Callcenter eines Unternehmens. Er leidet unter "Augenkopfschmerz", Schwindel, Schweißausbrüchen, seinem Körpergeruch und chronischem Martini-Missbrauch. Man kann freilich nicht sagen, dass es die Anforderungen des werktätigen Lebens sind, die ihm zu schaffen machen. Der Mann liebt den Werktag und hasst das Wochenende. Er ist ein Enthusiast der Erwerbstätigkeit, sofern sie seine sozialen Beziehungen auf die beruflich notwendige Interaktion beschränkt und unverbindliche sexuelle Abschweifungen erlaubt. Das Wochenende konfrontiert ihn mit den abgenutzten Riten seiner Ehe und mit gesellschaftlichen Verpflichtungen. Genau zwei Stunden hält er es auf Partys aus.
Freitag, Samstag, Sonntag, Montag: Die vier Kapitel des Romans sind nach den vier Tagen benannt, an denen er, mit etlichen Rückblenden, spielt. Die physische Existenz im Hier und Jetzt wird für den Protagonisten zur Belastungsprobe, die eigene Verdinglichung und Bedienbarkeit wird zum Wunschtraum.
"Standby" heißt der Bereitschaftsdienst im Callcenter, mit einer Standby-Taste würde der Mann sich am liebsten in den "Wochenend-Modus" umschalten – schlafen, bis es endlich Montag ist. Ansonsten setzt Wissers Held in "Standby" nicht auf Verdrängung des Unangenehmen, sondern auf Bereinigung durch Konzentration, auf seine Frau zum Beispiel, die er "die Frau" nennt: "Zuerst hat er ihren Geburtstag vergessen, dann ihren Namen. Jetzt erkennt er sie nur noch daran, dass sie in derselben Wohnung lebt wie er."
Die Beziehungen zu anderen Frauen gestalten sich kaum inniger. Seine junge Kollegin Eva wird zuerst umworben, dann, als sie an ihm vorbei Karriere macht, als multiple Gefahr auf Distanz gehalten. Die Mitarbeiterin Sabine wird in seinen Träumen zur idealen Mutterkuh für die herbeifantasierte postapokalyptische Ackerbaugesellschaft – allein, sie weiß nichts von ihrem Glück.
Wirklich originell ist dieser Sonderling nicht. Er erinnert an den von Wilhelm Genazino bevorzugten Typus des verstörten Angestellten ebenso wie an den körperkontaktscheuen Fernsehdetektiv Adrian Monk. In seiner Mischung aus Autismus und darwinistischer Brutalität erscheint Wissers Kontrollfreak aber eher monströs als liebenswert. Wer standby lebt, ergibt sich einerseits der Passivität, andererseits ist er jederzeit aktivierbar, ein "Schläfer", in dem es brodelt.
Scheinbar ungerührt und sehr genau gibt Wisser Einblick in ein unheimlich aufgeräumtes Inneres, er reflektiert Sprache und Jargon stets mit und hat der psychischen Struktur dieses ganz normalen Neurotikers mit einem Kunstgriff die ideale Form verliehen. Die forcierte Passivkonstruktion, die bei Wissers Auftritt beim Bachmann-Wettbewerb nicht adäquat gewürdigt wurde, hat einen eigenen Reiz und steht dem mit Tristesse gepaarten Lesevergnügen nicht im Wege: "Die auf der Couch schlafende Frau wird geweckt. Das wird durch starkes Klopfen mit der flachen Hand auf die Lehne der Couch erledigt, ohne dass die Frau dabei berührt werden muss."
Das Buch hat einige Glanzszenen – des Helden Begegnung mit der Geschäftsführerin, die Party bei der Freundin "der Frau" –, in denen Wissers Witz über das Deprimierende der Szenerie triumphiert. Denn was der missgünstige Beobachter an seinen Mitmenschen wahrnimmt, das haftet ihnen ja tatsächlich an. Ist er ein Deformierter des Systems? Sind es die anderen? Wisser legt sich nicht fest. Erschreckend ist nicht zuletzt, dass dieser von sich selbst ganz und gar Ausgefüllte in der von ihm gehassten Welt durchaus funktioniert.
Sieht man vom fahrlässigen Umgang mit dem Konjunktiv (II statt I) und vom allzu abrupten Ende der Geschichte ab, ist "Standby" ein Musterbeispiel des etwas anderen Büroromans.