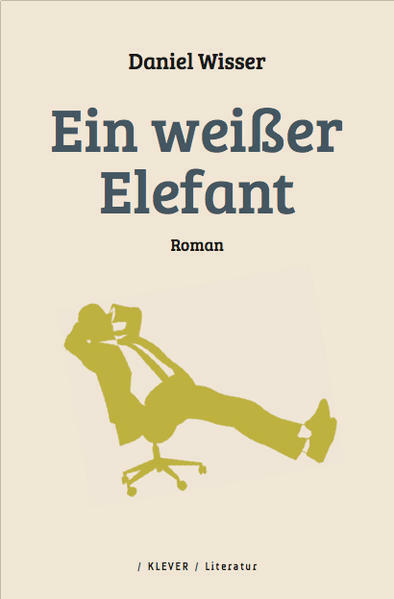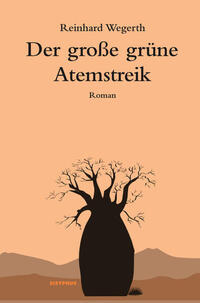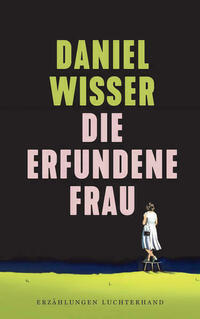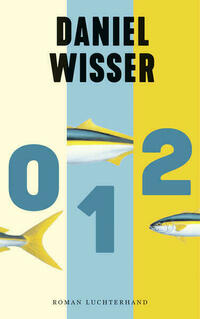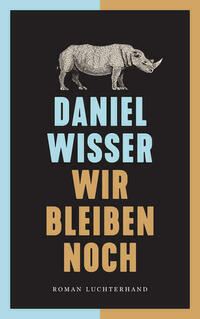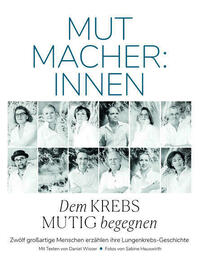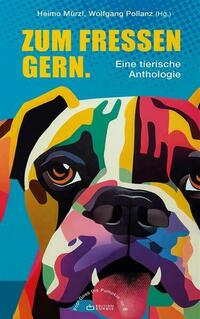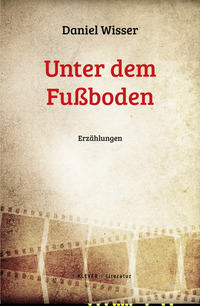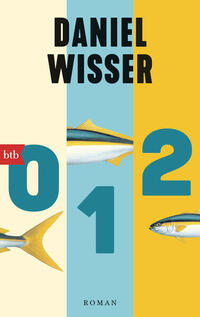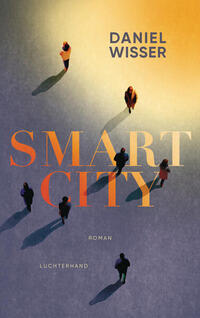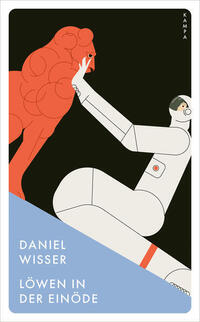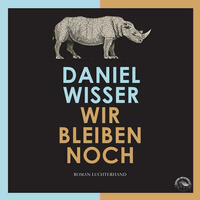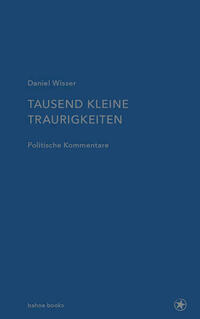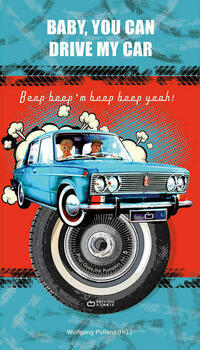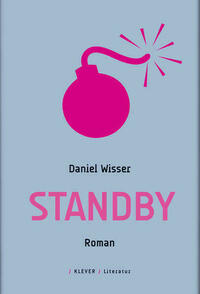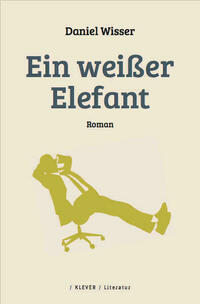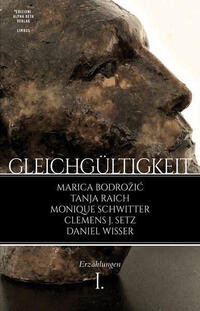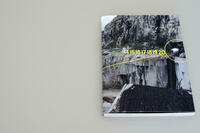Auswärts rumsitzen, daheim rumorgeln
Sebastian Fasthuber in FALTER 5/2014 vom 29.01.2014 (S. 29)
Daniel Wissers Roman "Ein weißer Elefant" handelt nicht vom Burn-, sondern vom Boreout
Man stelle sich vor: Jemand hat zwar einen Job, aber keine Arbeit. Die Firma zahlt weiter, allerdings nur fürs Absitzen der Zeit, weil sie zwar keine Verwendung mehr für eine Arbeitskraft hat, aber eine Entlassung zu teuer kommen würde. Faul rumsitzen im Büro? Auf Dauer auch nicht schön!
Burnout gilt als Modekrankheit unserer Zeit, aber es gibt auch das Gegenteil: Boreout. Der Begriff geht zurück auf eine 2007 erschienene Studie von Philippe Rothlin und Peter R. Werder: "Diagnose Boreout. Warum Unterforderung im Job krank macht".
Der Wiener Daniel Wisser, der schon in seinem Debütroman "Standby" (2011) die Absurditäten der ganz alltäglichen Arbeitswelt erkundet hat, legt mit seinem zweiten Roman ein Buch über zwei Männer vor, die unter Boreout leiden.
"Die Vorgangsweise, jemandem ein Büro zu geben und ihm gleichzeitig jede Aufgabe zu entziehen, hat mich in ihren Bann gezogen", erklärt Wisser. "Das Thema ist zum einen literarisch unbesetzt und trifft zum anderen den Kern vieler literarischer Figuren: Sie können oder dürfen das nicht tun, was sie tun müssten oder sollten."
Wissers trauriges Duo würde sich ja gerne nützlich machen. Von Montag bis Freitag haben die beiden den lieben langen Arbeitstag lang jedoch nichts zu tun, als die Zeit abzusitzen. So beobachten sie eben vom Fenster aus eine Ampel und führen penibel Buch darüber, wie viele Autos es pro Grünphase über die Kreuzung schaffen.
Einer der beiden monologisiert unermüdlich in fast schon bernhardesker Manier: "Ich habe bewiesen, ich habe allen meinen Mitarbeitern bewiesen, dass man in zwölf Minuten Mittagessen kann. Und zwar ein dreigängiges Menü. Samt dem Weg hin und zurück macht das ziemlich genau achtzehn Minuten. Wenn also wieder einer zu Mittag weggeht und nach einer Dreiviertelstunde zurückkommt, dann kann er mir nicht erzählen, dass er essen war."
Der da spricht, ist Anfang 50, war einmal in leitender Funktion in der IT-Abteilung tätig und ist es gewohnt, schnell zu essen und viel zu arbeiten – nicht zuletzt deswegen, weil er drei Kinder zu versorgen hat und jede der drei Mütter im Glauben lassen will, sie wäre die Einzige. Sein Gegenüber bleibt stumm, weswegen man sich im Laufe der Lektüre früher oder später fragt, ob es ihn überhaupt gibt – eine Frage, die offenbleibt.
"Ein weißer Elefant" will keine Fallstudie sein. Wisser beschäftigt sich auf literarische Weise mit den Auswüchsen der heutigen Arbeitswelt, mit "den Widersprüchen unserer Wirtschaft überhaupt", wie er sagt. Und er holt aus einer einfachen Grundsituation und einem minimalistischen Kammerspiel-Setting einiges raus.
"Ein weißer Elefant" könnte ein ziemlich trostloses Buch sein, wäre es sprachlich nicht so fesselnd und zeugte es darüber hinaus nicht von einem feinen Gespür für Dramaturgie.
Als Mitglied des Ersten Wiener Heimorgel Orchesters (EWHO), das seit 20 Jahren billige Keyboards auf fantasievolle Weise malträtiert und mit dem Lied "Vaduz" zumindest in Liechtenstein schon einen Superhit hatte, ist Daniel Wisser vielen vor allem als Musiker bekannt. Dabei ist er schon ebenso lang als Autor tätig, brauchte allerdings seine Zeit, bis er sich an publikumswirksame Genres heranwagte. "In meiner Jugend gab es für mich nur Gedichte", erinnert er sich. "Und zwar von der Barockzeit beginnend über Klassik und Romantik bis zur konkreten Poesie."
Als wesentliche Autoren für seine Entwicklung nennt er Andreas Okopenko, Peter Handke, Ror Wolf oder Ernst Jandl, von dem Wisser sein Faible für kurze Formen und Sprachspiele hat. Auf Twitter und Facebook haut der 42-Jährige regelmäßig kreative Wortverdrehungen raus. Ob diese spontan entstandenen Kürzesttexte auch in Buchform funktionieren würden? Wisser bezweifelt das: "Bei Twitter ist die Unmittelbarkeit von höchster Bedeutung, sonst hat man keine Leser. Sieht man von Zweizeilern ab, dann schreibe ich die einzigen Gedichte, die von mir veröffentlicht werden, mit dem EWHO."
Größere öffentliche Aufmerksamkeit als Autor erlangte Wisser, der nebenbei sehr sporadisch den Verlag Der Pudel betreibt, erst 2011 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Preis erhielt er keinen. "Das Klima ist steril und kühl, die Abläufe sind ganz aufs Fernsehen zugeschnitten", resümiert der Autor nüchtern, aber nicht enttäuscht. "Ich bin froh, dass es den Bewerb gibt."
Ach ja: Daniel Wisser ist Müßiggang eher fremd. Auf die Frage, ob er von der Kunst leben kann oder daneben noch arbeiten gehen muss, antwortet er etwas kryptisch, aber doch deutlich: "Der irische Autor Brendan Behan hat einmal gesagt: ,I am a drinker with a writing problem.' Insofern muss ich neben dem Job auch noch Kunst machen. Der freie Autor ist aber oft sehr unfrei – und der unfreie sehr frei."
Der Autor liest gemeinsam mit Rosemarie Pilz am 5.2., 19 Uhr, im Musa (1., Felderstraße 6–8)