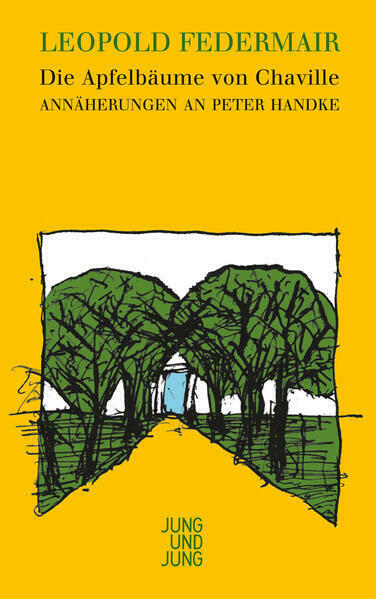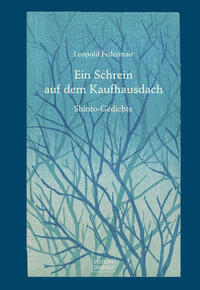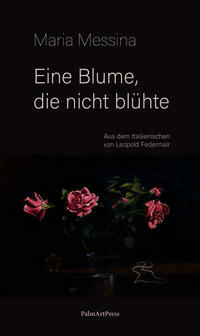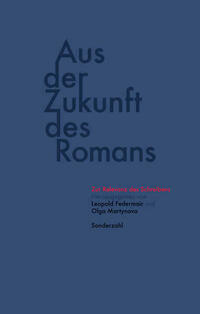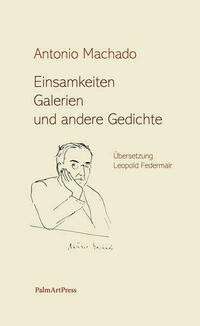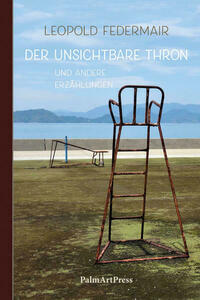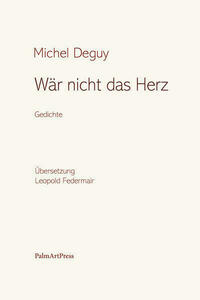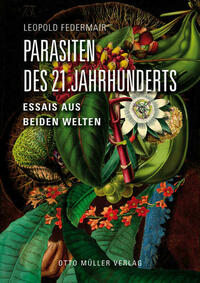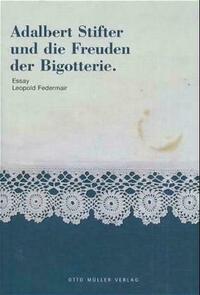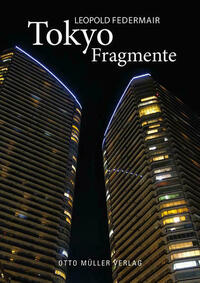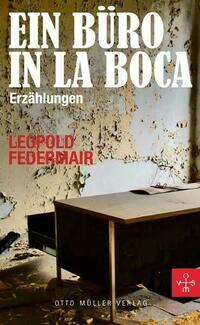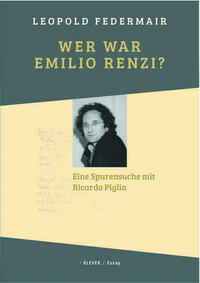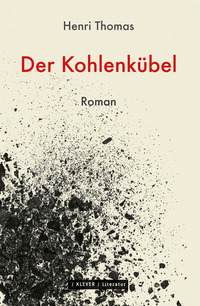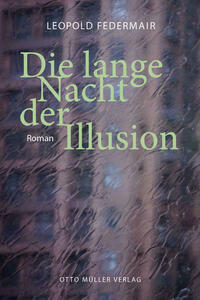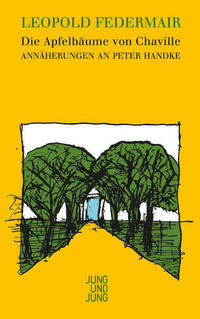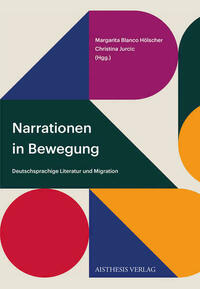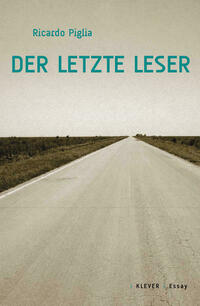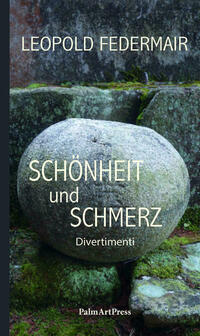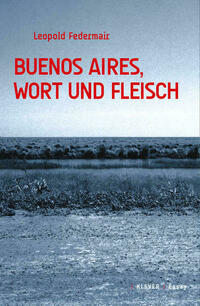Anspruch und Verwundbarkeit
Karl Wagner in FALTER 49/2012 vom 05.12.2012 (S. 30)
Lesenswert: Essays von Leopold Federmair und Handkes Briefwechsel mit seinem Verleger Siegfried Unseld
Zeremonien sind Peter Handke verhasst, übertroffen nur von Meinungen und den reflexartig abgewehrten Redensarten, Sprüchen und indiskreten Floskeln in Interviews, die gleichwohl immer gewährt werden, wie es scheint.
Handke hat wie kein anderer daran gearbeitet, Schreiben als Lebensform zu begründen: "Ich habe für mein Leben was vor, das ich mir selber vorgenommen habe, und das macht mich stark." Er weiß daher, dass Rituale, wenn sie nicht zu zeremoniös ausfallen, Menschenfreundlichkeit ermöglichen und erleichtern. Sie empfehlen sich insbesondere im Umgang mit Verlegern und sind unerlässlich in der Vorbereitungszeit auf das Schreiben.
Immer wieder hat Handke beispielsweise alte Paare auf die Bühne gebracht, die sich mit kargen, aber bestimmten Zeichen ihrer Zusammengehörigkeit versichern können. Handkes Aufmerksamkeit entgeht dabei keineswegs die Einsamkeit der Alten. Seine Kindheitslandschaft ist voll von Zeichen der Unbehaustheit der Einheimischen.
Im Gegenzug huldigt sein Werk seit seinem Debütroman "Die Hornissen" (1966) auch dem, der allein übers Land geht, beispielsweise an einem Sonntag in Oberösterreich, mit flatternden Hosen. Der Umriss, die Silhouette erwärmt das epische Gefühl. Abstand ohne Kälte ist möglich, allen "Kommunikationsveitstänzen" und "Raumverdrängern" der Gegenwart zum Trotz. Abstand halten ist eine zu übende Lebenskunst und daher auch ein Wiederholungsphänomen in seinem vielgestaltigen Werk.
Rituale braucht schließlich auch der Literaturbetrieb und so sind in diesem Jahr, durchaus anlassbezogen, einige wichtige Arbeiten von und über Peter Handke entstanden. Leopold Federmairs Essayband "Die Apfelbäume von Chaville" ist ein vielschichtiger Versuch, Handkes Werk auf wenig begangenen Pfaden zu durchqueren, ohne ins Abseits zu geraten. Dazu gehören auch die diskrete Beschreibung von Federmairs Begegnungen mit dem Autor, schließlich die Besuche im Haus des Dichters.
Getreu der Wittgenstein'schen Losung "Du hast Zeit" sind diese Texte nicht auf die schnelle Formel aus, sondern gewinnen, auch darin dem Vorbild ähnlich, Kontur durch Umschreibung und Digression. Das ist dem sperrigen und für viele immer noch (ver)störenden Roman "Langsame Heimkehr" (1979) höchst angemessen, der Handke in eine tiefe Schreibkrise und Depression getrieben hat, die er selbst mehrmals zu beschreiben versucht hat.
Federmair, der die begriffliche Fixierung scheut, greift bei der "Langsamen Heimkehr" zu Heidegger, der Handke lange Zeit beschäftigt und sein Schreiben beschädigt hat. Federmairs Explikation von Handkes "Heimkehr"-Tetralogie mit Hilfe von Heidegger gleicht einem Umfüllvorgang, den nur Anhänger des Philosophen goutieren werden.
Zum Glück hält sich der belesene Interpret ansonsten fern von solchen Verdoppelungen. Dafür gelingen ihm, insbesondere auf spanischen Spuren, eindrückliche Textbeschreibungen. Sie beanspruchen nicht das letzte Wort, sind aber anregender als die auf den Begriff fixierten Schnellschüsse und Verformelungen. Das gilt insbesondere für die geduldige Annäherung an Handkes komplexesten Roman "Der Bildverlust" (2002). Sein dieses Werk übergreifender Versuch über das Enklavenglück ist eine aufschlussreiche Rekonstruktion der Utopie bei Handke.
Federmairs Essays gehören zu den Geburtstagsgaben, die rechtzeitig eingetroffen sind. Hans Höllers Versuch über das Gesamtwerk, "Eine ungewöhnliche Klassik nach 1945", wird erst im Jänner nachgereicht und konnte nicht mehr berücksichtigt werden. Was es aber bereits gibt, ist eine von Amina Handke neu gestaltete Ausgabe von einigen Handke-Klassikern der Erzählung.
Der Briefwechsel mit Siegfried Unseld wird ebenfalls erst nach Handkes Geburtstag erscheinen. Er ist, zusammen mit Bernhards Verlagskorrespondenz, einer der wohl letzten (allerdings nicht vollständig erhaltenen) großen Briefwechsel zwischen Autor und Verleger, in dem mit solcher Ernsthaftigkeit, Vehemenz, Spielerlaune und auch Misstrauen für die Sache der Literatur gearbeitet, gepoltert und gekämpft wird, mitunter auch vor falschen Spiegeln.
Hinsichtlich der Dramaturgie des Schreibens ist Thomas Bernhards Briefwechsel mit Unseld nicht zu überbieten; durch den frühen Tod Bernhards wird das "Ich kann nicht mehr" des Verlegers zum absoluten Schlusspunkt (der es aber nicht war). Handkes letzter Brief vom 18. April 2002 ist Monate vor dem Tod Unselds im Oktober desselben Jahres geschrieben; er ist bezeichnend für eine Entspannungsphase in der Korrespondenz der beiden, die mehr als einmal vor dem absoluten Bruch stand.
Besonders kritisch war die Entstehungszeit der "Langsamen Heimkehr"-Tetralogie und die Arbeit an der "Niemandsbucht" (1994), wo die Schreib- und Lebenskrise der "Langsamen Heimkehr" als notwendige Verwandlung dargestellt wird. Handkes Empfindlichkeit erkennt jede Routine und Unaufmerksamkeit des Verlegers, und unerbittlich werden diesem unterlassene Zuwendung, unzulängliche Ablenkungsversuche, aber auch Mängel bei der Buchherstellung vorgehalten. Die vielen Druckfehler sind ein Dauerthema, vom Makulieren der "Elfenbeinturm"-Erstauflage (70 Druckfehler!) bis zur Errata-Liste, die der ersten Auflage der "Langsamen Heimkehr" beigefügt werden musste.
In dieser für Kränkungen besonders geeigneten Konstellation geht Handkes Infragestellen des eigenen Tuns (bei höchstem Anspruch) mit einer Verwundbarkeit einher, die aggressive Konfrontationen sucht. Sein beinahe unheimlicher Spürsinn für "Machenschaften" ist vom angegriffenen Verleger nicht immer von Paranoia zu unterscheiden.
Auch "die blöden Kritiker", allen voran das "übelste Monstrum, das die deutsche Literaturbetriebsgeschichte je durchkrochen hat", Marcel Reich-Ranicki, kehren naturgemäß immer wieder, ähnlich wie Honorare, Auflagen, Bestsellerlisten und andere Repertoirenummern des Betriebs.
Dass hier zwei am Werk sind, die dessen Spielregeln beherrschen, sie im Vollzug reflektieren, in entspannteren Zeiten auch über Drittes, ist offenkundig. Unselds Buch über Goethe und seine Verleger ist von Handke genau studiert und wie folgt gelobt worden: "Es ist fast ein Epos, was Du da zustandegebracht hast, wie von zwei verschiedenen Sprechern, der eine, der das Werk erzählt, der andre, der das Buchwerden der Werke vorträgt – beides zusammen ergibt ein seltsames, weiträumiges ,Antiphon'." Was für den Leser daraus zu lernen war – "hoffentlich braucht er's nie anzuwenden".
Handkes Traumstart bei Suhrkamp verfängt sich früh in die 68er-Kontroversen, dem "Aufstand" der Lektoren, deren Exodus und der Gründung des Verlags der Autoren. Handke möchte den Lektoren nicht in den Rücken fallen; insbesondere will er seinen ersten Suhrkamp-Lektor, Chris Bezzel, nicht verlieren. Dessen Verortung von Handkes Erstlingswerk "Die Hornissen" wird von Unseld übernommen, wenn er Handkes Debüt mit Peter Weiss ("Der Schatten des Körpers des Kutschers") und Ror Wolf ("Fortsetzung des Berichts") in Verbindung bringt.
Unseld ist als Verleger erfreut über Handkes Publicity nach dessen berüchtigtem Gruppe-47-Auftritt in Princeton und die Bühnenkraft seiner frühen Sprechstücke. Wie bei Bernhard ist Unseld auch in den Briefen an Handke bald mehrfach irritiert von dessen Publikationen im Residenz-Verlag, angefangen von "Die Begrüßung des Aufsichtsrats" (1967) bis zu den Journalen. Ohne Vergleich ist diese Korrespondenz jedoch darin, dass Handke nicht nur auf sein Werk schaut, sondern Fühler hat für das Schreiben anderer und auch als Übersetzer und neugieriger Leser das Programm seines Verlags bereichert.
Souverän nimmt Unseld die Interventionen seines berühmten Autors im Jugoslawienkrieg zur Kenntnis; er ist politisch nicht der Ansicht Handkes, aber es ist für ihn ganz selbstverständlich, dessen Ansichten zu publizieren. Auch wenn der Briefwechsel gegen Ende an Intensität verliert, so ist er ein erstaunliches und lesenswertes Dokument, unerlässlich als Quelle für das literarische Leben und als Auskunft über den Status von Literatur in der Gesellschaft des letzten halben Jahrhunderts. Gemessen wird nämlich mit diesem Anspruch und Zweifel Handkes: "Was für eine seltsame Position, heutzutage ein Schreiber zu sein; und doch möchte ich darauf bestehen, nur wie?"