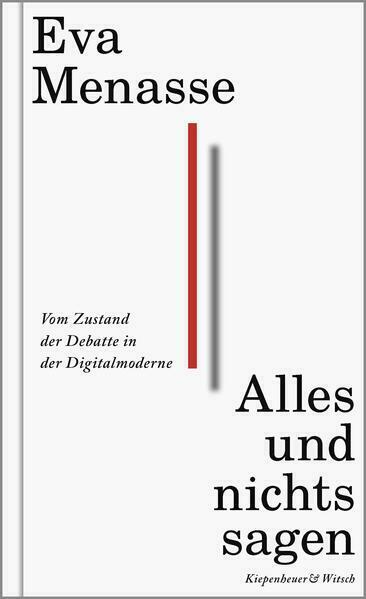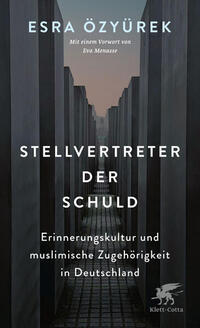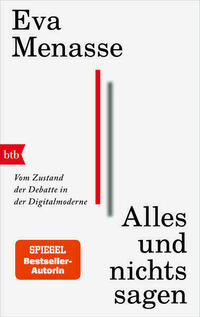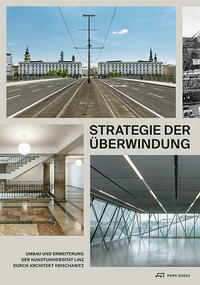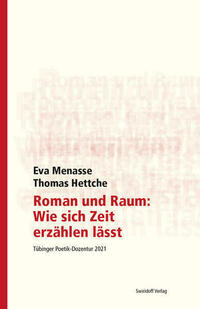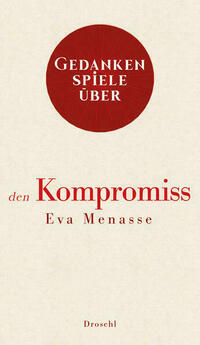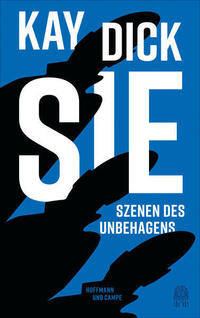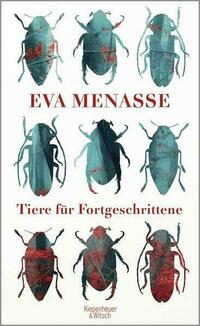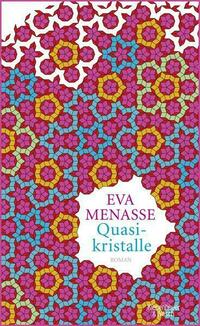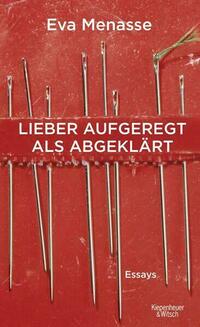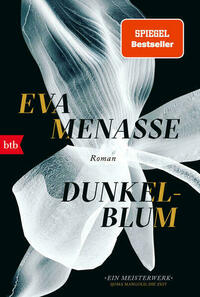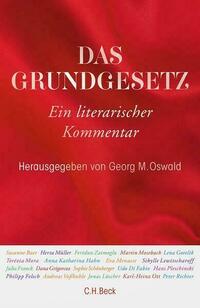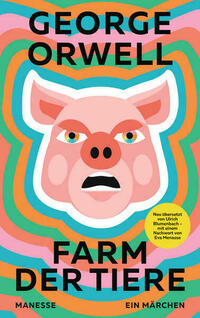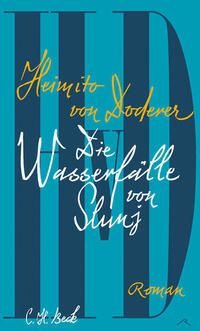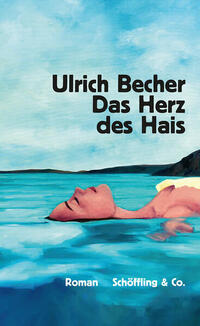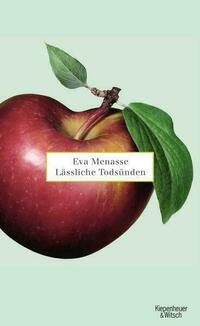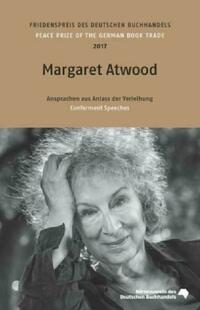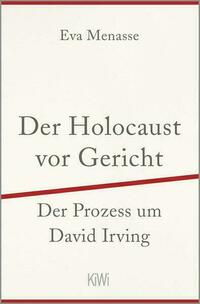"Diese Bekenntniswut hat es früher nicht gegeben"
Tessa Szyszkowitz in FALTER 46/2023 vom 15.11.2023 (S. 20)
Als sie 2021 die "Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus" neben der israelischen Soziologin Eva Illouz und dem deutschen Publizisten Micha Brumlik unterzeichnete, forderte Eva Menasse darin gemeinsam mit 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine zeitgemäße Definition des Antisemitismus: Es sei Diskriminierung, alle Juden kollektiv für das Verhalten Israels verantwortlich zu machen. Die in Berlin lebende österreichische Autorin spricht sich außerdem für eine differenzierte, solidarische Nahostdebatte hinsichtlich israelischer und palästinensischer Opfer aus.
Falter: Frau Menasse, der Nahostkrieg, der mit dem Massaker der Hamas an Israelis am 7. Oktober begann, hat einen neuen digitalen Tornado an Positionierung und Polarisierung ausgelöst. Können wir alle
nicht mehr diskutieren, ohne uns zu streiten? Eva Menasse: Die Debatte um Nahost ist ein gutes Beispiel für unsere Überflutung mit Informationen, Desinformationen, Handlungsanweisungen und Erwartungen - dem täglichen Druck, die Welt verändern zu müssen. Das ist psychisch schwer auszuhalten. Es kursieren offene Briefe, jeden Tag drei Stück, ist mein Gefühl, wo Dutzende berühmte Menschen unterschreiben. Es ist aber eine Illusion, zu glauben, mit offenen Briefen hätte man schon etwas gemacht.
Im Essay "Alles und nichts sagen" heißt es: "Die Weltformel der globalen Gesellschaft wird gebildet aus den heißen Drähten, an denen sie unentrinnbar hängt." Sind wir Geiseln unserer Smartphones?
Menasse: Die digitale Kommunikation findet in ungeheurer Geschwindigkeit statt. Man muss auch so schnell reagieren. Das nimmt uns die Zeit, über eine Antwort nachzudenken. Die Anonymität führt dazu, dass sich Menschen ganz anders benehmen. Nämlich viel schlechter. Wenn man zum Beispiel verfolgt, was honorige Feuilletonisten konservativer deutscher Tageszeitungen, also das Ehrwürdigste vom Ehrwürdigen der deutschen Publizistik, auf Twitter so treiben - das ist wie eine verbale Wirtshausschlägerei. Die beschimpfen einander so unflätig, wie sie das niemals schriftlich in ihrer Zeitung tun würden. Da schreibt einer einen FAZ-Leitartikel - um dann dazwischen, wenn er aufsteht und das Fenster öffnet, schnell auf Twitter abzurotzen. Da gehört eine gewisse kognitive Dissonanz dazu. Dadurch ist eine Aufgeregtheit und Aggressivität in die Kommunikation gekommen, die auch auf alle analogen politischen und intellektuellen Debatten übergegriffen hat.
Auf X - dem ehemaligen Twitter -denke ich mir oft: Jetzt legt doch einfach einmal eure Telefone beiseite. Können wir das nicht mehr?
Menasse: Wie das funktioniert, welche Gehirnareale bei uns Menschen angeregt werden -Dopamin-Ausschüttung, Suchtverhalten -, das ist alles längst untersucht. Die sozialen Medien sind so konzipiert, dass sie uns fesseln. Sie sind eben weit mehr als ein Werkzeug. Sie sind eine Droge, die dauernd etwas von uns will. Diesen allgemeinen Veränderungen kann niemand entkommen, sie ziehen auch jene mit rein, die wie ich noch nie ein Facebook-oder Twitter-Konto hatten. Ich glaube zwar, dass mir das einen Teil Gelassenheit bringt, aber auch meine Welt hat sich verändert. Ich schaue auf die Gegenwart des digitalen Zeitalters und es kommt mir alles so wie zu heiß gewaschen vor, wie verfilzt. Zu denken, zu schreiben, zu analysieren bedeutet, es wieder auseinanderzuziehen, zu entfalten, die Fäden wieder sichtbar zu machen.
Die Informationsexplosion hat aber doch auch Vorteile?
Menasse: Die Frage ist: Wer kuratiert die Nachrichten? Man braucht Expertise, die richtigen von den falschen Nachrichten unterscheiden zu können. Das war in der Corona-Pandemie zu besichtigen. Die Idee der Impfung hat der Menschheit unglaublichen medizinischen Fortschritt gebracht. Digitale Kommunikation aber bietet die Möglichkeit, diesen Fortschritt wieder zu kassieren, weil wir sehen, dass sich auch der Irrationalismus in dieser Pandemie verbreitet hat wie das Virus selbst. Die Verhaltensweisen, die wir uns im digitalen Raum angewöhnt haben, sind zurückgeschwappt in die analoge Welt.
Das können wir auf den Straßen Berlins, Wiens und Londons sehen. Warum ist es so schwierig für viele -wenn man doch sieht, dass Zivilisten und Zivilistinnen auf der israelischen und auf der palästinensischen Seite leiden -, zwei Positionen einzunehmen und mit beiden solidarisch zu sein?
Menasse: Ich muss ehrlich sagen, dass ich das auch nicht verstehe. Österreich hat ja auf den Nahostkonflikt seit Bruno Kreisky immer eine, wie mir schien, differenziertere Sicht gehabt. In Deutschland gibt es in den letzten Jahren ein erstaunliches Anwachsen kultureller Hysterie. Die mit Scheuklappen einfach immer nur "Pro Israel" brüllt. "Staatsräson" Deutschlands ist die Sicherheit Israels. Und schon, wenn man fragt: Welches Israel meint ihr? Die derzeitige Regierung oder das Land als solches? Den Zionismus? Meint ihr die israelische Zivilgesellschaft, die seit Monaten auf die Straße geht gegen ebendiese Regierung? Dann bekommt man keine Antwort, und es wird immer nur stur gesagt: Wir sind für Israel. Schwingen da Schuldgefühle mit?
Menasse: Um es polemisch zuzuspitzen: Die Enkel der SS-Männer sind psychologisch immer noch so unter Druck, für die Verbrechen ihrer Großeltern zu sühnen, dass sie beim Thema Israel überhaupt nicht differenzieren können. Und wenn man so wie ich und viele linke Juden in Deutschland um Empathie für die in Schutt und Asche gebombte Gaza-Zivilbevölkerung wirbt, dann ist man bereits auf der Seite der Israel-Feinde. Das ist ein unglaublicher intellektueller Kurzschluss: Bist du nicht für mich, bist du gegen mich.
Fehlt es auch an Wissen?
Menasse: Ja. Und gleichzeitig herrscht in Deutschland ein gigantisches Unwissen über die Details des Nahostkonflikts. Sie wissen nicht, was die israelischen Siedler in den palästinensischen Gebieten wirklich tun. All das, was Israel in den letzten Jahren an wirklich Kritikwürdigem getan hat, kommt in der deutschen Debatte kaum vor. Ich erlebe rundum eine mich wirklich verstörende Kriegshetze. Also dieses: "Na, dann muss man Gaza halt plattmachen, da kann Israel eben nicht anders."
Das Massaker der Hamas am 7. Oktober war aber auch eine Zäsur. Durch die Bodycams wurde das Live-Massaker direkt übertragen. Diese Mordlust hat uns nachhaltig entsetzt und verstört. Vielleicht ist es verständlich, dass die Leute jetzt denken, mit denen kann man ja sowieso nicht reden?
Menasse: Ich weiß es nicht. Ich habe ein Interview mit der Frau gehört, die in Gaza Umfragen macht, und die hat ihre letzte Umfrage am 6. Oktober abgeschlossen. Da war die Zustimmung zur Hamas weit unter 50 Prozent in der Zivilbevölkerung von Gaza. Aber man tut hier so, als wären alle in Gaza Hamas. Und deswegen haben sie es verdient, mitsamt ihren Frauen und Kindern weggebombt zu werden. Wer jetzt nicht versteht, dass das eine Gewaltspirale ist, der wird es, glaube ich, nie verstehen.
Gibt es einen Ausweg?
Menasse: Möglicherweise ist das die Zäsur, die am Ende dann wieder das Gute bringen wird. So wie es nach dem Jom-Kippur-Krieg zum Friedensschluss mit Ägypten kam. Das muss sich die Weltgemeinschaft schon vorwerfen lassen: wie sehr man die Regierung Netanjahu hat gewähren lassen mit allem, was sie allein im Westjordanland gemacht hat. Sie hat nämlich Schritt für Schritt und Tag für Tag die Zweistaatenlösung immer weiter verunmöglicht durch immer weitere Ansiedlung von Siedlern und Landraub.
Und der Hamas-Terror ist die logische Antwort?
Menasse: Nein. Wichtig ist aber auch zu sagen: Der Hamas-Terror steht damit nicht in einem direkten kausalen Zusammenhang. Das möchte die Hamas zwar gerne so darstellen, dass sie leider gar nicht anders konnte, als 1400 Israelis zu massakrieren, weil Israel die Palästinenser insgesamt schlecht behandelt. Aber auch wenn man die Palästinenser viel besser behandelte, würde die Hamas morden und bomben wollen. Aber ich finde es nicht nur bedauerlich, sondern geradezu skandalös, wenn wir es nicht einmal hier aus der friedlichen Ferne schaffen, zivilisiert miteinander darüber zu diskutieren.
In einem Kapitel von "Alles und nichts sagen" geht es um Ihre persönliche Erfahrung. Der Vater war Jude, die Mutter nicht -war es eine persönliche Verletzung, dass manche fanden, Eva Menasse sollte sich nicht zu jüdischen Fragen äußern, weil sie nicht jüdisch genug ist?
Menasse: Mich hat es nicht persönlich verletzt. Zwar hat es das früher so nicht gegeben, dass man darüber groß debattiert hat, ob jemand das Recht hat, jüdische Positionen einzunehmen, weil er eben nicht ganz koscher jüdisch ist. Nach dem jüdischen Religionsgesetz, der Halacha, muss man eine jüdische Mutter haben, um als jüdisch zu gelten. Ich sehe diese neuen Vorwürfe im größeren Kontext der Identitätspolitik, und die nehme ich intellektuell nicht ernst. Ich argumentiere außerdem dafür, dass sich achtzig Jahre nach der Schoah die Täter-Opfer-Identitäten eigentlich verlaufen haben sollten. Nach so vielen Jahren Frieden, Sicherheit und Demokratie in Deutschland sollte man den Mitdiskutanten nicht danach beurteilen, ob er vor drei Generationen aus einer Täter-oder einer Opferfamilie stammt, sondern ob er ein menschlich anständiges, demokratisches und nicht diffamierendes Argument äußert. Zum Glück kann ich, mit einem Satz meines Onkels Kurt, den ich sehr bewundert habe, sagen: "Ich weiß, wer ich bin."
Im Buch heißt es, dass der "militante, bewaffnete, rechtsradikale Antisemitismus die Juden weiterhin bedroht, während der linke, kulturelle und Israel-bezogene Antisemitismus eher empfindliche Deutsche bedroht". Man liest das jetzt nach dem 7. Oktober und dem starken Ansteigen von antisemitischen Anschlägen mit Unbehagen. War das nicht eine Fehleinschätzung?
Menasse: Nein, das ist ja beweisbar. Und ich weiß, ich mache mich damit unbeliebt, auch bei Juden, die jetzt Angst haben. Und ich verstehe diese Angst. Ich persönlich habe sie zwar nicht. Aber die Rationalität selbst ist im Moment schon fast ein Skandal, weil alle so voll Gefühl sind und diese Gefühle ausgedrückt haben wollen. Auch das ist ein Zeitgeistphänomen. Der deutsche Verfassungsschutzbericht stellt jedes Jahr dasselbe fest mit kleinen prozentualen Schwankungen: Attacken auf Leib und Leben von Juden in Deutschland kommen zu über 80 Prozent von rechtsradikalen Deutschen - biodeutschen Neonazis. Das sind aber auch Leute, die genauso Muslime, Schwule, Queere umbringen wollen, eben alle Menschen, die nicht in ihr biodeutsches Kartoffelraster passen.
Der Nahostkonflikt bringt aber doch jetzt eine Gewaltbereitschaft mit sich?
Menasse: Es gibt den migrantischen Antisemitismus, der durch eine starke Einwanderung aus muslimischen Ländern auch in Deutschland angekommen ist. Nur: In Deutschland leben vier Millionen solcher Menschen aus muslimischen, arabischen, nahöstlichen Ländern. Wenn die jetzt das Land anzünden wollten, hätten sie es bereits getan.
Aber die Angriffe summieren sich.
Menasse: Dass es jetzt antisemitische Schmierereien gegeben hat und dass ein paar Dutzend am Tag nach dem 7. Oktober auf der Sonnenallee Baklava verteilt haben vor lauter Glück über die Hamas-Anschläge -das ist im Vergleich zu der muslimisch identifizierten arabischen Gruppe in Deutschland ein verschwindender Bruchteil. Ich finde es für den gesellschaftlichen Frieden und Zusammenhalt geradezu fahrlässig, die allesamt unter Verdacht zu stellen, dieses Ressentiment zu pflegen. In Neukölln sind Juden angerempelt, angebrüllt, sogar attackiert worden, weil sie hebräisch gesprochen haben. Aber auch das waren sehr bedauerliche und individuell bestimmt enorm bedrohliche Einzelfälle. Wenn zehn Menschen auf einer Demo "Tod den Juden" schreien, dann sollen die unbedingt von der Polizei herausgenommen werden. Aber deswegen, so wie es in Deutschland derzeit oft geschieht, vorher präventiv Demonstrationen zu untersagen, ist demokratiepolitisch falsch. Und es dient auch nicht dem gesellschaftlichen Frieden. Und ich glaube, auf diesen Frieden müssen wir das größte Augenmerk richten. Wir dürfen die Einzelfälle nicht so hoch skandalisieren, dass sich jeder, der diesen Volksgruppen angehört, in diese Ecke gestellt fühlt.
Selbst auf der Frankfurter Buchmesse war es nicht einfach, eine palästinensische Schriftstellerin zu ehren.
Menasse: Adania Shibli sollte für ihren Roman "Eine Nebensache" ausgezeichnet werden. Das ist ein Roman, der eine, wie ich finde, sehr realistische und gut nachvollziehbare Schilderung des Alltags unter der Besatzung gibt und der plötzlich wegen der tagespolitischen Lage keinen Preis mehr bekommen durfte. Aus taktischen Gründen wollte man einen solchen Preis gerade im Moment nicht vergeben, weil so viele Israelis gestorben sind. Aber indem man das sagt, tut man ja so, als wäre eine Autorin mitschuldig daran. Man schiebt Frau Shibli damit in die Richtung der Hamas. Das finde ich hochproblematisch. Ich habe als Sprecherin von PEN Berlin eine Lesung aus ihrem Roman organisiert. Und auch zwei Veranstaltungen mit israelischen Staatsbürgern: eine mit Doron Rabinovici, Meron Mendel und Tomer Dotan-Dreyfus. Und in einem weiteren Gespräch mit Dotan-Dreyfus, der seit zehn Jahren in Berlin lebt, haben wir über die Einsamkeit der jüdischen Linken gesprochen, besonders jetzt nach dem 7. Oktober.
Wenn die Klima-Ikone Greta Thunberg sich mit Gaza solidarisiert und dann danach sagt: Ich dachte, das war logisch, dass ich mit den Opfern der Hamas auch empathisch bin - hätte sie sich besser überlegen müssen, in welch zugespitztem, polarisiertem Raum sie agiert?
Menasse: Es gibt eine ungeheure Binarität aller Debatten. Nach meinem Gefühl - auch jetzt möchte ich bitte die Erlaubnis haben, wieder ein bisschen polemisch zu sein -hat wirklich absolut jeder in Deutschland, jede Vereinigung, jede Organisation, jede Akademie, jede Uni, jeder ein Statement abgegeben, dass er entsetzt ist über die Anschläge. Diese Bekenntniswut hat es früher nicht gegeben. Früher gab es Terroranschläge, auch schreckliche Terroranschläge, und jeder Mensch, der fühlt und denkt und empathisch ist und kein Monster, hat zuhause getrauert. Man musste das nicht nach außen stülpen. Aber wenn man es heute nicht nach außen stülpt, wird man gleich beschuldigt, mindestens unempathisch, schlimmstenfalls antisemitisch zu sein.
Manchen scheint die Empathie aber tatsächlich abzugehen. Die palästinensische Boykottbewegung BDS hat doch den Kompass verloren. Sie boykottiert israelische Produkte, ja sogar israelische Künstler.
Menasse: Man muss differenzieren zwischen blindlinks dem BDS zujubelnden sogenannten westlichen Linken wie Roger Waters von Pink Floyd, der wirklich ein verkappter Antisemit ist. Auf jeden Fall ist er ein Antizionist. Ich halte Leute wie ihn für Trottel, also auch für ungebildete Trottel. Wir sollten unterscheiden zwischen denen und den Palästinensern, die wirklich von der israelischen Besatzungspolitik betroffen sind und die vielleicht wirklich gute Gründe haben, BDS gut zu finden. Nach dem 7. Oktober muss man aber wiederum BDS fragen: Findet ihr das auch noch gut, das Abschlachten von Zivilisten? Oder könnt ihr euch bitte einmal schön deutlich, dass wir es alle hören, distanzieren? Und dann könnte man auch mit BDS reden, wenn sie das getan haben. Haben sie aber bis jetzt nicht. Wie der israelisch-deutsche Philosoph Omri Boehm in der Süddeutschen Zeitung letztens so schön gesagt hat: "Kein Mensch hat das Recht auf Terror." Das Bild des Freiheitskämpfers ist in dem Moment zu Ende, in dem Leute abgeschlachtet werden, unschuldige Zivilisten massakriert werden. Daran gibt es moralisch nichts zu deuteln. Aber eben auf beiden Seiten. Im Moment rächen sich die israelischen Siedler. Im Westjordanland haben sie schon mehr als ein Dutzend palästinensische Dörfer entvölkert, die Menschen einfach vertrieben. Sie drohen: Wenn ihr nicht verschwindet, dann erschießen wir euch.
Diese Kontextualisierung heißt für viele Gleichsetzung. Die Wiener Philosophin Isolde Charim schreibt eher von "Spiegelungen". In "Alles und nichts sagen" wird die israelische Soziologin Eva Illouz ähnlich zitiert, da heißt es: "Mindestens von Seiten der radikalen israelischen Siedler wächst die spiegelbildliche Gruppen-Feindlichkeit schockierend an."
Menasse: Man kann mit dem gegenseitigen Hass und Umbringen auch noch ein paar Jahrzehnte weitermachen. Es wird zu nichts anderem als Blutvergießen führen. Oder man beginnt am besten übermorgen mit Friedensverhandlungen, zumindest mit einer Vision für die Region. Die Gewalt muss ein Ende haben. Die ganze Weltgemeinschaft ist gefordert, die Uno, der Westen, die arabischen Staaten. Und um das klarzumachen, müssen wir auch hier diesen anstrengenden und kräftezehrenden Mittelweg im Dialog, im Diskurs versuchen. Es bleibt einfach nichts anderes übrig.
Eva Menasse ist Wienerin, die seit 20 Jahren in Berlin lebt. Die Autorin begann ihre journalistische Karriere bei Profil, wechselte dann zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 2005 erschien ihr Debütroman "Vienna". Sie ist längst Bestsellerautorin - ihr Roman "Dunkelblum" (2022) wurde 130.000mal verkauft und in neun Sprachen übersetzt. Sie ist eine der wichtigsten Public Intellectuals des deutschsprachigen Raums. Ihr jüngster Essay "Alles und nichts sagen" erschien am 4. November bei Kiepenheuer & Witsch
Die Moral der postarischen Deutschen
Matthias Dusini in FALTER 45/2023 vom 08.11.2023 (S. 23)
Der Schriftstellerin Eva Menasse ging das Geimpfte auf, wie man in Wien zu sagen pflegt. In einem Essay prangert sie den Verfall von Umgangs-und Redeformen an, der mit dem Internet einhergeht. Menasse, bekannt durch Romane wie "Dunkelblum", verfasste eine wütende Klage über die "Digitalmoderne". So nennt sie das Zeitalter der psychosozialen Medien. Den Vorwurf der Zuspitzung muss sie sich indes selbst gefallen lassen. "Alles und nichts sagen" fehlt nämlich eine dialektische Volte, die das Schwarzweiß ihres Befunds auflösen würde.
Die in Berlin lebende Wienerin lässt sich keiner Fraktion zuordnen. Sowohl gegen hypersensible Wokies als auch konservative Feuilletonisten anschreibend, plädiert sie für "die Fähigkeit, auch andere begründete Meinungen ohne Empörung gelten zu lassen". Anhand zahlreicher Beispiele beschreibt sie den Verfall dieser Tugend in digitaler Massenkommunikation, in der moralisierende Meuten den Austausch vernünftiger Argumente verhindern.
Masse und Moral
Menasse schildert den Alltag von Shitstorms, wo Gekränktheit und Aggressivität eine giftige narzisstische Mischung ergeben. Vertreter wie Gegner der Identitätspolitik, also der Bewegungen gegen Rassismus und Sexismus, würden ihr eitles Ich absolut setzen.
Die Autorin greift zu einem drastischen Vergleich, der die "verzweifelte Suche nach der einen, ewig gültigen Moral" zum Ausdruck bringe. Sie spricht in Anlehnung an die Parkinson-Krankheit von einer Schüttellähmung.
Am stärksten ist der Essay, wo Menasse deutsche Befindlichkeiten beschreibt. Sie erzählt von den übergriffigen Reaktionen auf ihre eigene Herkunft. Für manche Kritiker war es offenbar schwer auszuhalten, dass sie -Tochter eines jüdischen Vaters -ihre Identität gerne selbst bestimmt.
Mit dem polemischen Begriff "postarische Deutsche" meint die Autorin jene selbstgerechten Zeitgenossen, deren Großväter möglicherweise Nazis waren und die nun Juden erklären, was Antisemitismus sei. In Deutschland gäbe es inzwischen mehr Antisemitismus-Beauftragte als Juden, bemerkt sie spöttisch.
Spontane Liebe
In der Polemik gegen die indonesischen Documenta-Macher, denen Kritiker 2022 Judenhass unterstellten, rief sie vergeblich zu mehr Augenmaß auf. Monatelang prangerten die Feuilletons die Verfehlungen postkolonialer Künstler und Theoretiker an. Menasse verweist auf die staatliche Verbrechensstatistik, nach der 90 Prozent der Gewalttaten von Rechtsradikalen verübt würden.
Die Massaker vom 7. Oktober lösten eine Flut von Reaktionen - im Netz und auf den Straßen -aus, in denen sich die berechtigte Kritik an der israelischen Regierung nicht von pauschalen Ressentiments gegen "die Juden" unterscheiden lässt. Dieser Gewaltausbruch ist Wasser auf die Mühlen jener, die vor migrantischem und linkem Judenhass warnten. Hatten die konservativen Mahner am Ende vielleicht doch recht?
Menasses Netzpessimismus schwächelt aber auch wegen der pauschalen Gegenüberstellung zwischen digitaler und analoger Welt: hier ein Schlund von Hass und Häme, dort ein draußen, "in dem Früchte reifen, Vulkane ausbrechen und es einen echten Zufall und spontane Liebe gibt". Aus dem Mund eines Medienprofis klingt die Anrufung des Authentischen dann doch ein wenig zu romantisch.