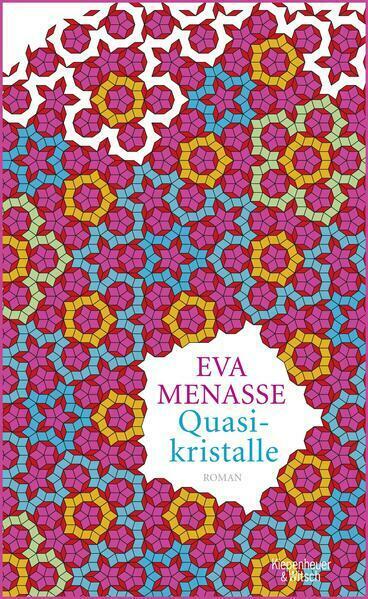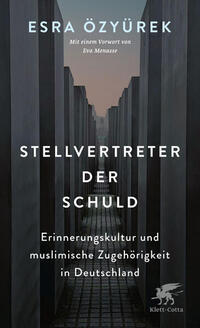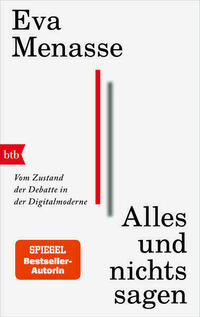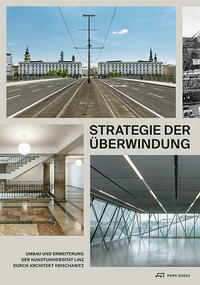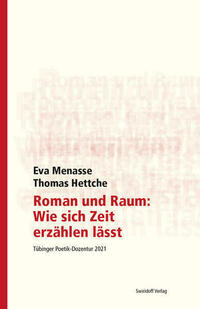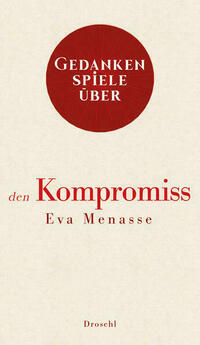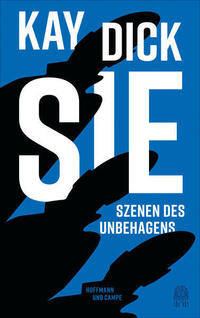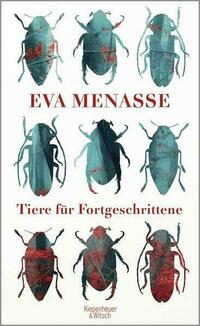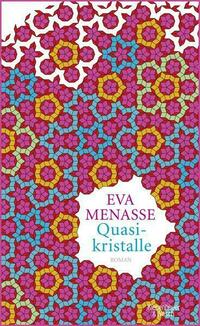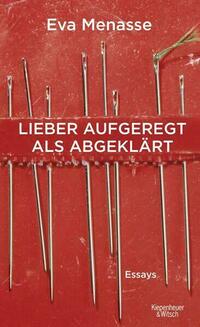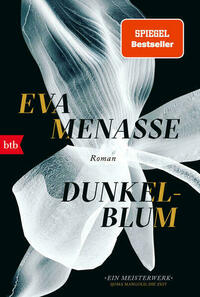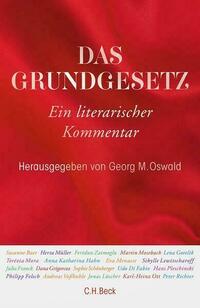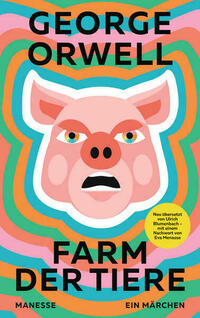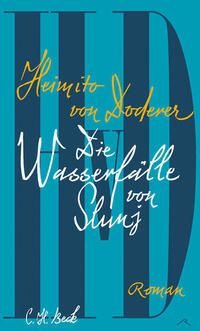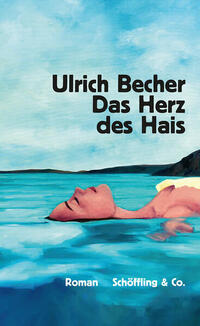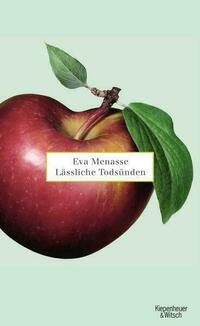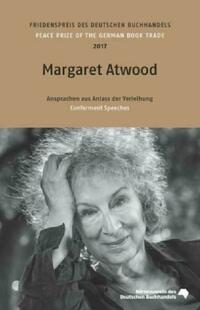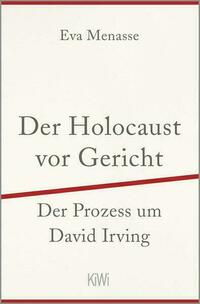"Das sind alte Säcke"
Sebastian Fasthuber in FALTER 7/2013 vom 13.02.2013 (S. 24)
Eva Menasse über die Macht des Blicks, ihren fesselnden Roman "Quasikristalle", die Brüderles dieser Welt und über das Verhältnis zu Wien und zu ihrem Bruder
Woraus setzt sich die Biografie eines Menschen zusammen? Die Autorin und ehemalige Journalistin Eva Menasse erzählt in ihrem Roman "Quasikristalle" von einer Frau, ohne die Unebenheiten ihres Lebens zu begradigen. Das Buch, das auf den Roman "Vienna" und die Erzählsammlung "Lässliche Todsünden" folgt, darf als einer der Romane der Saison gelten.
Falter: Frau Menasse, Sie leben seit zehn Jahren in Berlin. Wie hat sich Ihr Blick auf Wien verändert?
Eva Menasse: Mit der Distanz wird der Blick klarer. Wenn ich heute nach Hause komme, will ich mit meinem Vater gar nicht mehr über Politik diskutieren. Was jetzt der Strasser genau im Gerichtssaal gesagt hat, interessiert mich im Detail nicht mehr. Ich habe eine Tiroler Freundin, die schon viel länger in Berlin ist. Im Vergleich zu der kann ich mich noch sehr über die österreichischen Verhältnisse aufregen. Aufregung heißt ja auch Verwicklung und, pathetisch gesagt, Zuneigung oder Liebe. Ich rege mich auf, weil es mich was angeht. Wenn ich das nicht mehr hätte, könnte ich mir ja genauso gut die deutsche Staatsbürgerschaft holen.
Sie bezeichnen sich, gerade in Interviews mit deutschen Medien, sehr bewusst als österreichische Autorin. Warum ist das wichtig?
Menasse: Weil diese deutschsprachige Einheitsbreigeschichte einfach zu ungenau ist. Wir haben doch einen ganz anderen literarischen Rückraum. Womit wir aufwachsen und was wir als junge Erwachsene lesen, hat einen immensen Einfluss darauf, wie wir schreiben. Ich empfinde Bohumil Hrabal, Joseph Roth oder Doderer vollkommen organisch als Ausdruck dessen, wo ich herkomme. Erst vor ein paar Jahren habe ich Siegfried Lenz gelesen, den mein Mann in unsere Bibliothek eingebracht hat.
Und es war nichts?
Menasse: Doch. Ich habe Lenz mit großem Interesse, aber auch mit großer Fremdheit gelesen. Der norddeutsche Protestant erzählt vollkommen anders als wir katholischen Kaisertreuen. Ich glaube, dass die Konfessionsgrenzen nicht ausreichend gewürdigt werden, wenn man über Literatur spricht. Ein anderes Beispiel: Als ich letztens in Ungarn war, ist mir wieder aufgefallen, wie wahnsinnig umständlich die Leute dort sind. Genau wie bei uns! Die Preußen, unter denen ich jetzt lebe, kommen in zwei Sätzen von A nach B.
Sie sind mit Ihrem Kollegen Michael Kumpfmüller verheiratet. Wie muss man sich das Leben in einem Schriftstellerhaushalt vorstellen?
Menasse: Schriftstellerhaushalt klingt irrsinnig interessant. Es ist aber vermutlich nicht anders, als wenn zwei Ärzte oder zwei Rechtsanwälte miteinander verheiratet sind. Wir verbringen die Kinder in die Erziehungsanstalten und versuchen dann, unser Tagwerk zu erledigen – wie alle anderen Freiberufler auch. Natürlich sind in unserer Wohnung überall Bücher. Und unser sechsjähriger Sohn weiß ziemlich genau, wer Franz Kafka war.
Schielt man nicht öfter neugierig auf den Schreibtisch des anderen?
Menasse: Wir sind beide unsere Erstleser. Das ist nicht immer einfach, aber mit der Anzahl der gemeinsam durchlittenen Bücher geht man mit den Rückmeldungen des anderen doch entspannter um. Natürlich gibt es immer wieder kleine Beleidigtheiten. Zum Glück sind wir beide vergleichbar erfolgreich. Es wäre wahrscheinlich nicht so einfach, wenn der eine erfolgloser Lyriker wäre und der andere Bestsellerautor.
Wie sieht es mit dem Verhältnis zu Ihrem Bruder aus? Es gab in Wien immer wieder Gerüchte, dass er lieber der einzige Romanautor namens Menasse wäre.
Menasse: Stellen Sie sich vor: Jemand macht sich auf einem Gebiet einem Namen. Und dann kommt die kleine Schwester oder der kleine Bruder und macht auf einmal dasselbe. Ich glaube, das würde niemandem gefallen. Auch mir nicht. Davon abgesehen haben mein Bruder und ich immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Dafür, dass wir eigentlich nur Halbgeschwister sind, sogar ein besonders herzliches. Ich kann mich noch an die dicken Briefe erinnern, die wir uns geschrieben haben, als er so lange in Brasilien war. Er hat sich dann über "Vienna" sehr lobend geäußert, auch öffentlich. "Quasikristalle" liest er gerade. Tut mir leid, ich kann die Gerüchteküche nicht befeuern.
Bei Ihrem Debüt wurden Sie noch als Journalistin wahrgenommen, die wie so viele Kollegen einen Roman geschrieben hat.
Menasse: Und gedroschen. Alle negativen Rezensionen haben damit angefangen.
"Vienna" ist aber auch sehr gelobt worden.
Menasse: Grob gesagt ist es in Österreich gedroschen und in Deutschland gelobt worden. Da spricht jetzt natürlich meine gekränkte österreichische Seele, die in der Heimat anerkannt werden will.
Das zweite Buch wurde hier schon wesentlich freundlicher besprochen.
Menasse: Ich glaube auch, dass ich mit "Lässliche Todsünden" literarisch einen großen Schritt gemacht habe. Beim ersten Buch war die Geschichte gut, aber in der Form würde ich es nicht noch einmal schreiben.
Kann man sagen: Beim dritten Buch ist man wirklich Autor?
Menasse: Kann sein. Ich habe aber inzwischen gelernt, es mir wurscht sein zu lassen, wie die Leute mich sehen. Wichtiger ist, wie ich mich selber sehe. Und nach dem dritten Buch habe ich schon das Gefühl, dass ich mir etwas erarbeitet habe. Ich würde aber nur ein weiteres Buch schreiben, wenn ich ein Projekt finde, bei dem ich das Gefühl habe, ich bin gefordert. Das führt bei mir offensichtlich über die Struktur: Ich muss versuchen, die Geschichten so zu erzählen, dass sich dadurch eine zweite Ebene auftut, ein Mehrwert ergibt. Das war bei den "Todsünden" schon angelegt und ist jetzt nochmal extremer.
Was war die Grundidee, die zu "Quasikristalle" geführt hat?
Menasse: Die kam wahrscheinlich mit der Geburt meines Sohnes. Wie jede andere Mutter war ich natürlich total aufgeregt, als wir ins Spital kamen. Ich habe nicht gewusst, wie man das alles macht, und ständig nach den Hebammen geläutet. Irgendwann hat mein Mann zu mir gesagt: "Und die machen das hier jeden Tag." In dem Moment hat es in meinem Kopf klick gemacht. Hier sind die Eltern, für die das ein geradezu heiliger Moment ist, da die Hebammen, die das alle zwei Stunden erleben. Das ergibt vollkommen verschiedene Perspektiven. Und mich hat immer schon fasziniert, wie verschieden Menschen Dinge oder andere Menschen wahrnehmen: Man kann mit zwei Menschen über einen Dritten reden und bekommt zwei ganz verschiedene Geschichten.
Haben Sie eine kurze Erklärung für den Titel "Quasikristalle" parat?
Menasse: Wir haben in der Schule ja noch gelernt, dass es bei den Festkörpern Kristalle gibt und amorphe Masse. Dazwischen gibt es nichts. Und dann kommt dieser Daniel Shechtman daher und entdeckt eine asymmetrische Form. Über den wurde gehöhnt: Es gibt keine Quasikristalle, es gibt nur Quasiwissenschaftler. Er wurde von einer verbohrten Wissenschaftsgemeinde richtiggehend gemobbt. Aber es gibt diese Quasikristalle eben doch. Shechtman war also gewissermaßen Galileo im Kleinen.
Sie haben die Struktur der Quasikristalle nun auf eine menschliche Biografie übertragen.
Menasse: Ich lese wahnsinnig gerne Biografien. Was mich dabei immer stört, ist, dass die aus jeder Lebensgeschichte immer eine runde, folgerichtige Geschichte machen müssen: Weil jemandem in der Kindheit das und das passiert ist, war klar, dass er später dieses und jenes machen würde. Aber Lebensläufe sind nicht so logisch. Und offenbar sind eben sogar Kristalle weniger logisch, als Menschen sie haben wollen. Es gibt immer Dinge, die nicht dazupassen, die sich querlegen und die trotzdem zu einer Biografie gehören, auch wenn man nicht versteht, warum.
Sie beleuchten eine Frau in 13 Kapiteln aus 13 verschiedenen Perspektiven, das mittlere Kapitel erzählt diese selbst. Der Witz ist, dass sich die Hauptfigur bis zum Schluss nicht wirklich fassen lässt. Ich finde, sie wird eigentlich immer unklarer.
Menasse: (Lacht.) Das ist auch wieder so eine Standpunktfrage. Es gibt Leser, die mir sagen, man kennt diese Figur besser, als man je jemanden kennen wird, weil man sie aus so vielen Perspektiven geschildert bekommt. Und es gibt Leute, die sagen, sie verschwimmt immer mehr. Ich glaube, dass beides stimmt. Als Paradoxon gefällt mir das sogar sehr gut.
Haben Sie keine Angst gehabt, sich mit diesem Buch zu überheben?
Menasse: Angst ist das falsche Wort. Ich hatte auch nie das Gefühl, beim Schreiben ein besonderes, halsbrecherisches Kunststück zu absolvieren. Es war ein Experiment. Ich mag einfach keine Routine. Wenn ich vorher wissen würde, wie das fertige Buch aussehen wird, würde ich es gar nicht machen.
Aber es gab doch sicher auch knifflige Momente?
Menasse: Ich wollte die Kapitel möglichst stark voneinander abgrenzen. Es wechselt immer wieder zwischen männlichen und weiblichen Blicken, alten und jungen, österreichischen und deutschen, fremden und nahen. Sprachlich fordert einen das, wenn man zuerst ein abgeklärter Mann und dann ein pubertierendes Mädchen ist, das nur CDs und Burschen im Kopf hat.
Ein Kapitel wird aus der Perspektive eines Holocaustforschers mit sehr spitzer Zunge erzählt. Es macht Ihnen wohl Spaß, die Männerperspektive einzunehmen?
Menasse: Das stimmt und war auch in "Lässliche Todsünden" schon so. Spaß ist überhaupt das richtige Wort. Ohne Spaß und intellektuelle Herausforderung würde ich kein Buch schreiben. Ich will mich nicht zwei Jahre lang ausschließlich quälen.
Apropos männlicher Blick: Wie haben Sie die Sexismusdebatte der letzten Wochen erlebt?
Menasse: An dieser Debatte kann man wunderbar sehen, dass es auf dem Gebiet der Gleichberechtigung der Frau einen ganz natürlichen Anachronismus gibt: Wir befinden uns immer in verschiedenen Phasen gleichzeitig. Während in Indien Frauen so vergewaltigt werden, dass sie sterben, haben wir hier eine Brüderle-Debatte. Daraus könnte man also schließen, dass es uns gutgeht.
Und, kann man?
Menasse: Würde ich nicht. Ich glaube jedoch, dass diese alten Herren mit ihren alten Herrenwitzen langsam aussterben. Ein 40-jähriger Mann würde wahrscheinlich nicht so reden wie Brüderle abends am Tresen. Das sind alte Säcke, die den Anschluss verpasst haben. Es werden immer wieder welche nachwachsen, aber sie werden weniger. Trotzdem finde ich es wichtig, dass die Stern-Reporterin das so geschrieben hat, um noch einmal darauf hinzuweisen, dass es so nicht geht.
Wie war das bei Ihnen als junge Journalistin?
Menasse: Ich habe mit 18 beim Profil angefangen. Damals war das absolut üblich, dass die Herren Chefreporter und Sonderaufdecker in der Früh mit großen Umarmungen und Küssereien auf die jungen Praktikantinnen zugegangen sind. Das war mir damals nicht angenehm, aber es ist mir auch nicht als protestwürdig erschienen. Es war einfach so. Auch da greift wieder das Quasikristalle-Prinzip, dass sich der Blick auf die Dinge ändert, mit den Jahren und mit den gesellschaftlichen Zuständen.