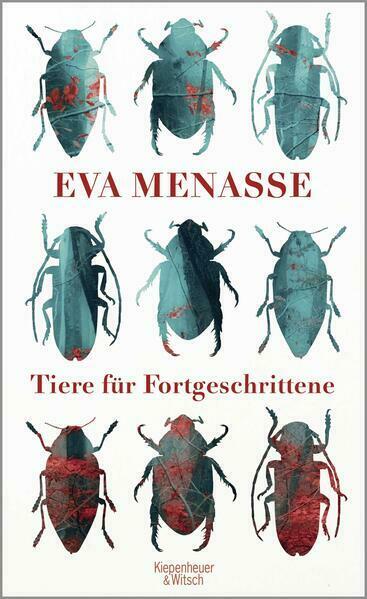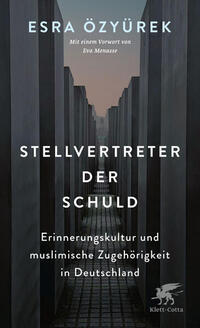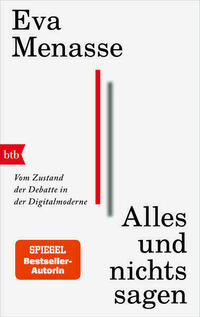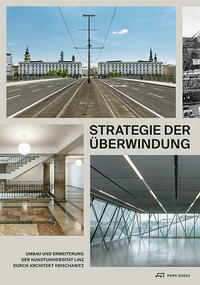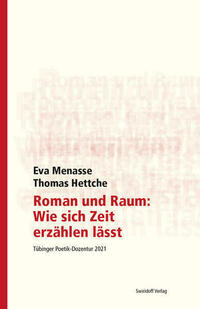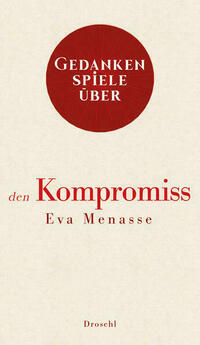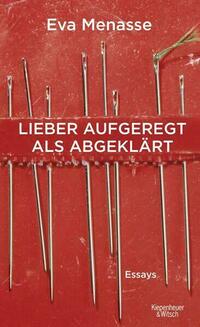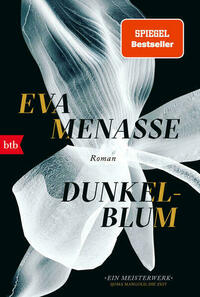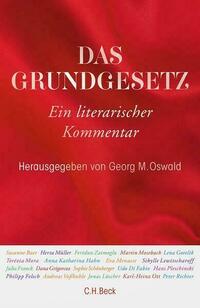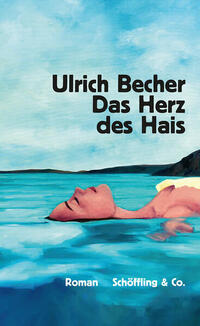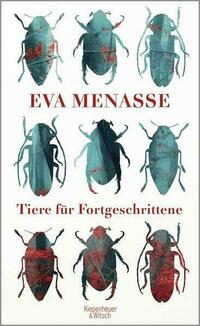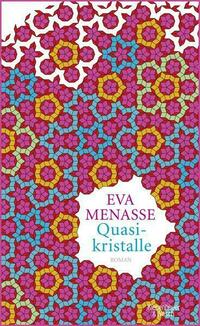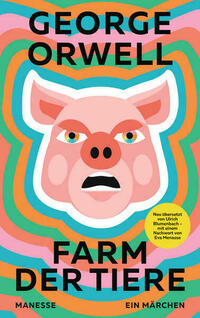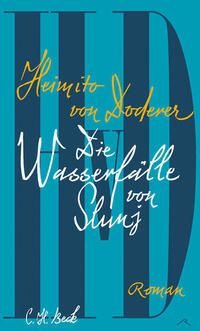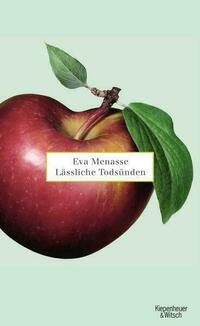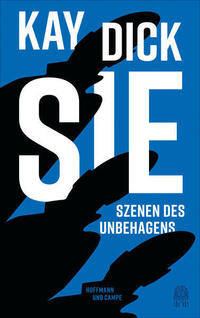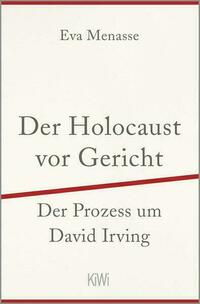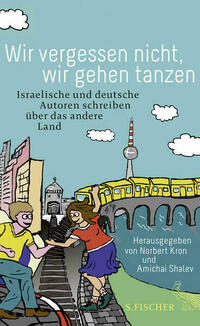Die Raupe im Pornokeller
Julia Kospach in FALTER 11/2017 vom 15.03.2017 (S. 26)
In „Tiere für Fortgeschrittene“ arbeitet Eva Menasse Tier- auf Menschenfabeln um
Die Erzählung trägt den stacheligen Titel „Igel“, wobei einem der erste Satz so geschmeidig runtergeht wie Honig: „Micol, ein entzückend exaltiertes Wesen mit vielen Talenten, hatte es zu nicht mehr als einer wohlbestallten Ehe mit einem nach außen hin milden Mann gebracht.“ Später wird diese Micol im Garten eines Hotels an der Riviera über das Missgeschick eines Igels in haltloses Schluchzen ausbrechen, einen strahlenden Ritter zur simultanen Rettung des Tieres und Tröstung ihres Schmerzes anfordern, um dann rechtzeitig zum Ehepaar-Abendessen auf der Hotelterrasse anekdotenhaft über das Erlebte zu plaudern.
Es ist ein Sturm im Wasserglas einer Enttäuschten, von dem Eva Menasse in „Igel“ erzählt. Man könnte auch sagen: ein Sturm in einem Eisbecher. Denn wie der Zeitungsmeldung, die Menasse ihrer Erzählung vorangestellt hat, zu entnehmen ist, pflegten naschhafte Igel in weggeworfenen McFlurry-Softeisbechern mit dem Kopf steckenzubleiben und elend zu verenden, bevor Tierschützer die Hersteller soweit brachten, die Öffnungsgröße der Becher zu verändern.
Diese und andere Tier-Nachrichten hat Eva Menasse über die Jahre gesammelt und als Ausgangspunkte für ihre Erzählungen in dem Band „Tiere für Fortgeschrittene“ verwendet. Diese werden gleichsam auf den Kopf gestellt, denn statt Tier- sind es Menschenfabeln.
Es ist schon das zweite Mal, dass Menasse, die zuletzt mit ihrem Roman „Quasikristalle“ (2013) einen Bestseller gelandet hat, einem ihrer Erzählbände ein solches Gestaltungsprinzip zugrunde legt. In „Lässliche Todsünden“ (2009) erzählte sie entlang von Trägheit, Habgier, Gefräßigkeit et cetera vom Lebensgefühl des Wiener Kultur- und Politbetriebs.
Die acht Erzählungen aus „Tiere für Fortgeschrittene“ sind – wenn überhaupt – in und um Berlin verortet, wo Eva Menasse seit vielen Jahren lebt. In „Schmetterling, Biene, Krokodil“ widmet sie sich dem ewigen Eiertanz des fragmentierten Familiendaseins. Das Schlachtfeld, auf dem ihre Heldin Tom darin gegen die Exfrau ihres Mannes kämpft, ist der Kleidungsschrank der beiden Stiefkinder. Tom markiert und fotografiert jedes Kleidungsstück und jeden Gegenstand, den die beiden mit in den Hotelurlaub in der Türkei bringen, damit sie und ihre Familie später nicht für Verlorenes oder Beschädigtes haftbar gemacht werden können. Allerdings übersieht sie darob einige diskret platzierte Hinweise darauf, dass ihrem Alltags- und Pflichterfüllungstrott auch noch völlig anders geartete Gefahren drohen.
Einen ganz anderen Kampf führt Konrad in „Raupen“. Er hat zwei erwachsene Töchter, von denen alles, was er tut, „maximal falsch verstanden“ wird, und eine zunehmend der Demenz anheimfallende Frau, deren Ausfälle seine sehnsüchtigen Erinnerungsbilder immer stärker überlagern. Die Autorin beschreibt diesen Konrad, der sich in einem Kellerraum Pornos reinzieht, als einen sich selbst vermauerten Mann, sie erzählt eine traurige, einprägsame Geschichte, in der jeder jeden aus Überdruss und Resignation hintergeht.
Der Regisseur Charly in „Opossum“ ist ein gutmütiger Betrüger, der einmal mehr die Autostrecke zwischen seiner geliebten Frau und seiner unerwartet schwanger gewordenen Geliebten zurücklegt und Pause in einem Wirtshaus macht, in dem ihm alles verdächtig vorkommt.
Zwischen Wahrheit und Lüge verheddert sich auch Nora, als sie für einen muslimischen Mitschüler ihrer Erstklässlertochter Partei ergreift, den sie für ein Opfer von Vorurteilen hält – so lange, bis sie schließlich selbst nicht mehr weiß, was sie glauben soll: „Haie“ ist das grandiose Porträt einer linken Berliner Eltern- und Freundesgruppe, deren auf Spielplätzen, in Urlaubshäusern oder bei gemeinsamen Abendessen gepflogener engagierter Diskurs sich oft genug als Tratsch und Halbwissen entpuppt.
Wie in vielen Short Stories der kanadischen Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro spielt auch in Eva Menasses neuen Erzählungen das Motiv der nur angedeuteten Katastrophe eine große Rolle. Es geht um die emotionalen Balanceakte der Figuren, die erwägen, sich zu trennen oder ein anderes, neues Leben zu beginnen. Sie fühlen, dass ein Bruch bevorstehen könnte, haben ihn aber noch nicht vollzogen und wissen auch noch nicht, ob sie ihn durchziehen werden. Manche von ihnen halten sich auch alles so lange offen, „bis die Möglichkeiten von selbst wieder zu schwinden“ beginnen. In der riesigen Zwischenwelt, wo der Alltag solche Sehnsüchte und geplanten Veränderungsschritte an die kurze Leine nimmt, ist Eva Menasses große Spielwiese.
Sie erzählt mit leichter Hand, ironischem Ton und tiefer Anteilnahme für die amoralischen Wursteleien und gut gemeinten Manipulationsgesten, mit denen ihre Figuren ihre Ängste in Schach zu halten und ihre Ziele zu erreichen versuchen. Oft genug geht es ihnen wie Micol aus „Igel“, als sie feststellt: „An der menschlichen Natur gibt es viel Erstaunliches, aber besonders bemerkenswert ist, wie schnell sie manchmal von einem Augenblick auf den nächsten genau das Unentbehrliche gefunden zu haben vermeint, das sie davor niemals vermisst hat.“