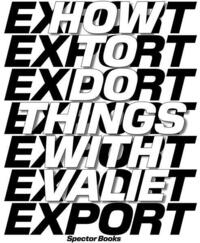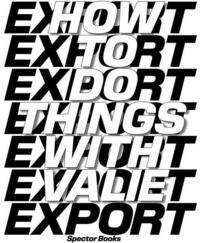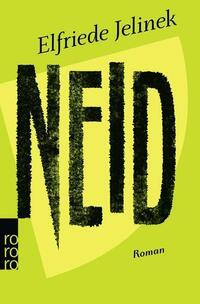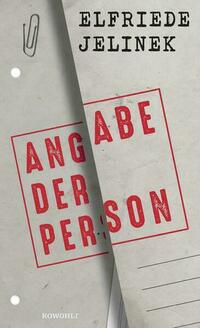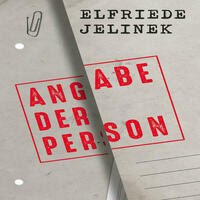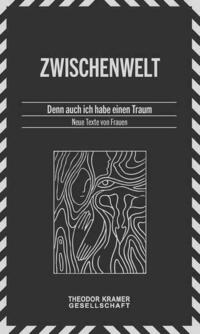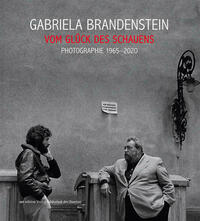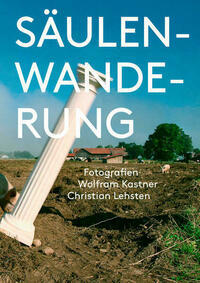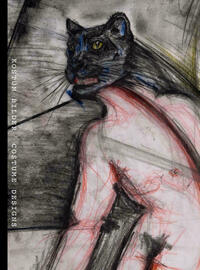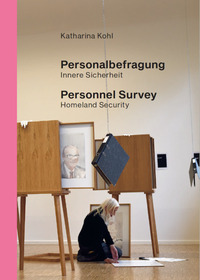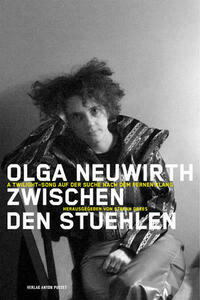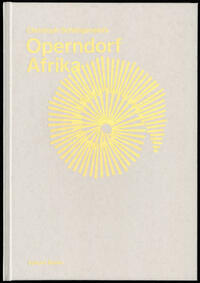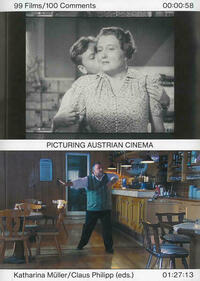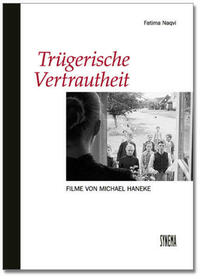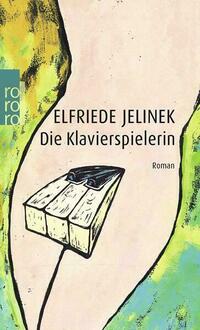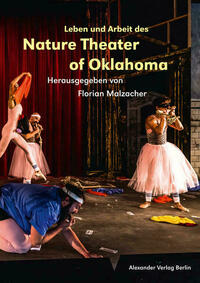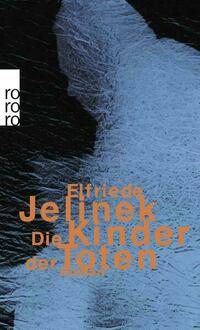Kinder, die Frau mit der Axt ist da!
Klaus Nüchtern in FALTER 41/2016 vom 12.10.2016 (S. 26)
Elfriede Jelinek, die dieser Tage 70 wird, hat sich ihren Ruf als Trümmerfrau der heimischen Literatur hart erarbeitet. Die Romane der ehemaligen Klosterschülerin stehen tief in der Tradition des Barock
Mit niemandem ist Elfriede Jelinek so sehr Schlitten gefahren wie mit den Skifahrern. Bereits in „Lust“ (1989) blüht der Protagonistin mit dem Allerweltsnamen Gerti auf den Pisten nichts Gutes. Zu Hause vom Direktorsgatten zum „Einhalten des Ehevertrags“ angehalten, fängt sie sich ein Gspusi mit dem Studenten Michael an, was so schlecht ausgeht, wie das halt oft und bei Jelinek immer der Fall ist – man erinnere sich an „Die Klavierspielerin“ Eva Kohut und an deren „hübschen blonden Burschen (…) Herrn Walter Klemmer“.
Das erotische Interesse des jungen Mannes an Gerti lässt sehr bald sehr stark nach, diese wird am Pistenrand von dessen Freunden lustlos missbraucht: „Ihre Möse wird nur auseinandergefaltet, diese Broschüre kennen wir schon, lachend wieder zusammengeklappt. (…) Weiter drüben, von wo wir die Gerti abgeschleppt haben, jauchzen die Schifahrer immer noch in ihren kleinen Seen aus Bier und Jägertee. Sie strahlen und brüllen. Von der Last ihres Vergnügens ist der Waldboden auch schon ganz angesoffen.“
Ihren bereits 1986 angekündigten Versuch, mit „Lust“ eine Art weiblichen Porno zu schreiben, bezeichnete Jelinek später als gescheitert. Die Aversion gegen den (Ski-)Sport, an der auch ihre offene Bewunderung für Bode Miller („Ein cooler Typ!“) nichts ändert – „Ich verabscheue den Sport. Es gibt da gar keine heimliche Liebe, ich bin eine offen Hassende“ –, bleibt eine Konstante mit vielen Facetten.
Mit „dem sportlichen Volk, das auf den Brettern lebt, die seinen Sarg bedeuten“ und den „Schifahrern auf den Heldenplätzen zujubelt: Karli Schranz! Karli Schranz, der gehört uns ganz“, spielt „Lust“ auf ein Ereignis von nationaler Bedeutung an. Als der damalige IOC-Präsident Avery Brundage (1887–1975) Karl Schranz aufgrund der „Amateurregel“ von der Teilnahme an den Winterspielen in Sapporo ausgeschlossen hatte, stand Österreich Kopf.
Am 8. Februar 1972 wurde der aus Japan heimgekehrte Leider-nein-Olympionike empfangen, als hätte er gleich mehrere Medaillen abgeräumt. Der Weg vom Flughafen Schwechat in die Wiener Innenstadt geriet zum Triumphzug, wo Schranz vom Balkon des Bundeskanzleramts aus die versammelte Menge begrüßte. In Korrespondenz mit einer anderen historischen Heldenplatzszene – Hitler hatte 1938 vom Balkon der Neuen Burg den begeisterten Massen zugewinkt – steht der Moment bei Jelinek exemplarisch für Österreichs Verdrängung und Beschönigung der eigenen Geschichte sowie die ideologische Funktion, die gerade dem Skisport dabei zufiel.
Bevor „Ein Sportstück“ (1998) den Sport als Zurichtungs- und Vernichtungsmaschine anprangern wird – „Wie wollen Sie einem jungen Mann klarmachen, daß er in den Krieg ziehen soll, wenn er vorher keinen Sport getrieben hat?“ –, widmet sich die Autorin aber auch noch einem anderen Basis-Ideologem eines restaurativen Österreichbildes. Just zu einer Zeit, als sich andere an Bruder Baum ketten, um den Wald zu retten – im Dezember 1984 findet die Besetzung der Hainburger Au statt, 1986 ziehen die Grünen, damals noch unter dem Namen Die Grüne Alternative erstmals ins Parlament ein –, lässt Jelinek ihre sprachkritische Axt krachen: „Die Managerin bedauert das Waldsterben mehr als du und ich. Sie hat ja auch mehr vom Wald als der Betriebsame, der mehr vom Betriebssport hat. Jedem das Kleine.“
In „Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr“ (1985), einem Buch, das vom Genre her schlicht als „Prosa“ ausgewiesen ist, treibt die Autorin voran, was sie von jeher umtreibt: das Durchdeklinieren von Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen mittels einer Arbeit an der Sprache, die in der Tradition der Wiener Gruppe steht. Das stellt – wie fast alle Anstrengung der Schriftstellerin Jelinek – ein paradoxes Unterfangen dar: Eigentliches wird angestrebt mit den Mitteln der Uneigentlichkeit. Die Autorin, deren Sprache zwar leicht zu identifizieren ist – „typisch Jelinek!“ –, deren Diskurscollagen und Stilkollisionen aber keinen Personalstil im herkömmlichen Sinne konstituieren, watet durch den ganzen Sprachschutt ja nur, weil es ihr um Wahrheit zu tun ist, auch wenn es kein wahrhaftiges Reden gibt in ihrem Werk.
„Noch der letzte Kalauer enthält, wenn man Glück hat, mehr Wahrheit als manches andere“, artikulierte Jelinek in einem Falter-Interview ein überraschendes Vertrauen in die Sprache, die bei richtigem Gebrauch auf geradezu magische Weise und buchstäblich buchstäblich die Wahrheit preisgebe: „Eine Kollegin hat seinerzeit aus Aussprüchen von Kurt Waldheim Anagramme gemacht, und egal, wie sie die Wörter geschüttelt hat, es blieben immer die Buchstaben SA und SS über. Das ist für mich der Beweis, dass die Sprache selber sprechen kann.“
Aus der naturholden Betulichkeit macht die Dichterin Kleinholz, denn die Natur ist ihr nicht geheuer, sie ist ein Ungeheuer, weswegen es auch den von Berufs wegen Forstkundigen gruselt, wenn der Wald, den wer auch immer so hoch da droben hat aufgebaut, in Jelineks Hauptwerk „Die Kinder der Toten“ (1995) einmal wieder runter will: „Der Förster duckt den Nacken in den Kragen, eine unbeschreibliche, ich wollte schreiben: unbestimmte, noch nicht oft benutzte Furcht (…) hat ihn beim grünen Krawattl gepackt. (…) Ja, da hat ihm einer glatt das Fell des zahmen Waldes, der plötzlich zu einem wilden Untier geworden ist, über Nacken und Schultern geworfen, damit er, der Förster allein, dieses gigantische Gewicht aufhalten soll. Na, das ist ganz schön viel verlangt.“
Sigmund Freud definiert das Unheimliche, das etymologisch ja mit dem „Heimeligen“, also dem zum Heime Gehörigen verwandt ist, als „jene Art des Schreckhaften, welche auf das Altbekannte, Längstvertraute zurückgeht“. Insofern ist es nur konsequent, wenn die geborene Mürzzuschlagerin Heimat- und Schauerroman fusioniert und die Landschaft ihrer Kindheit zum Schauplatz ihres Horror-Epos „Die Kinder der Toten“ gemacht hat.
Auch dort haben die Skifahrer nichts zu lachen. Edgar Gstranz, einer von drei handlungstragenden Untoten, ist lautlich eine Fusionierung aus Gstrein (dem Skifahrer Bernhard, nicht dem Schriftstellerbruder Norbert) und Schranz, darüber hinaus aber auch mit dem Schicksal des mehrfachen Weltmeisters und Olympiasiegers Rudi Nierlich bedacht, der 1991 verunglückte, als ihn „die Räder seines PKWs“, wie’s im Roman heißt, „mit dem Kopf voran vorläufig an einer Hausmauer abgestellt [haben]“. Um nichts pietätvoller die Schilderung von Ulrike Maiers tödlichem Sturz vom 29. Jänner 1994 in Garmisch-Partenkirchen: „Die Ulli hat sich an einem Zeitnehmungsstab (…) das Genick gebrochen und die Arterien zum Hirn zerrissen, oh, das tut mir jetzt leid für die Ulli, sagt die Fernseh-Sprecherin zu uns (…).“
Zeithistorische Referenzen und tagesaktuelle Bezüge sind bei Jelinek stets eingebettet in eine sehr grundlegende anthropologische Skepsis, die auch für viele Linke ein rotes Tuch ist (so hat etwa Karl-Markus Gauß die „Kinder der Toten“ als unpolitisch und ahistorisch kritisiert). Ein „neuer Mensch“ im Sinne des Sozialismus ist bei Jelinek weit und breit nicht in Sicht.
Man muss die ehemalige Klosterschülerin als durch und durch barocke Dichterin begreifen, dem Katholischen verbunden wie ansonsten nur noch ihr Landsmann Josef Winkler. Das betrifft nicht nur die Ornamentierungs- und Bebilderungslust der überbordenden Sprache, sondern auch die von Walter Benjamin im „Ursprung des deutschen Trauerspiels“ konstatierte „Immanenz des Barockdramas“, die „ohne Ausblick auf das Jenseits der Mysterien“ bleibe: „Es gibt keine barocke Eschatologie; und eben darum einen Mechanismus, der alles Erdgeborene häuft und exaltiert, bevor es sich dem Ende überliefert.“
Aufhäufen, Exaltieren und dem Ende Überliefern – damit sind die Tätigkeiten der Dichterin Elfriede Jelinek einigermaßen gut umrissen. Auch wenn sie der „Lust“ noch die Todsünden-Romane „Gier“ (2000) und den nur im Netz publizierten „Neid“ (2007–2008) nachschob, bleibt „Superbia“, der Hochmut und die Eitelkeit also, ihre Lieblingssünde. Die eigene Sterblichkeit ist die ultimative narzisstische Kränkung, und die Vorstellung davon, für die in unserem Unbewussten laut Freud kein Platz ist, wird von der Dichterin permanent aufgerufen: „Man lebt also wirklich nur einmal, das hätte ich nicht von uns gedacht.“
Solch schnoddriger Sarkasmus schmiegt sich skandalöserweise der Rhetorik des Aggressors an. Einer identifikatorischen Lektüre wird so der Boden entzogen, weswegen man sich gegen die Zumutungen dieser Literatur auch wehren muss, will man nicht versinken im Sumpf der (Selbst-)Verachtung, der einem hier ständig um die Knöchel schwappt.
Sich selbst verschont die Jelinek dabei übrigens am allerwenigsten. Frei nach Woody Allens grausamem Gag aus „Take the Money and Run“, wo er die Arbeit seiner Peiniger erledigt und – „ich mach’s schon selbst!“ – die eigenen Brillen zertritt, nimmt diese Diva der Selbstentmächtigung, die ihre „Stücke“ den Regielöwen wie einen blutigen Klumpen Fleisch vor die Füße wirft, einen landläufigen Spruch wortwörtlich: „Verarschen kann ich mich selber.“ Und wehe, jemand nimmt ihr diese Arbeit ab – dann wird sie wirklich sauer.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: