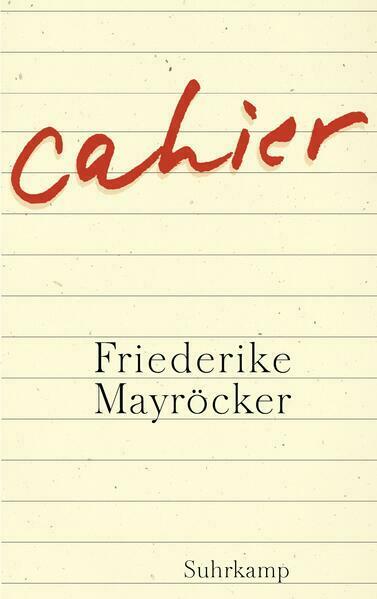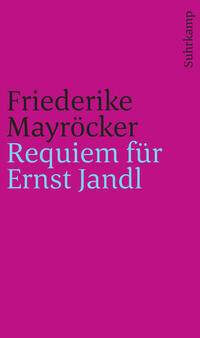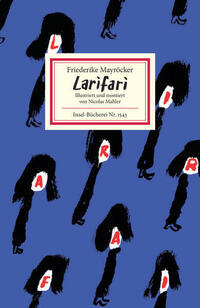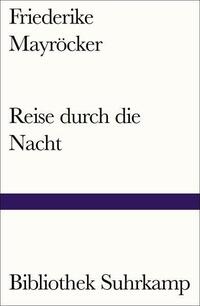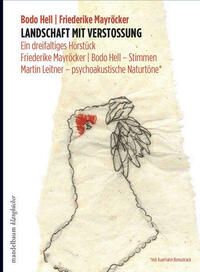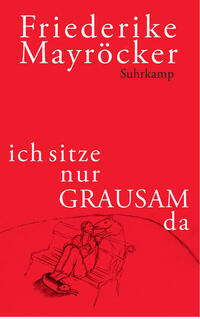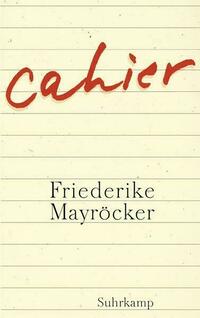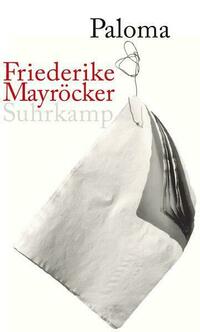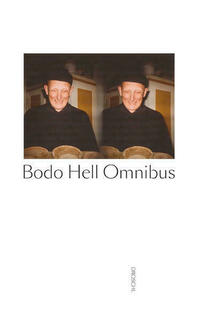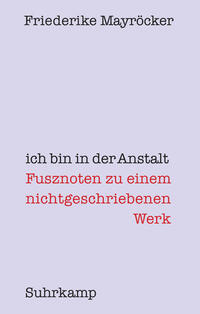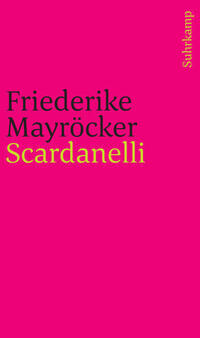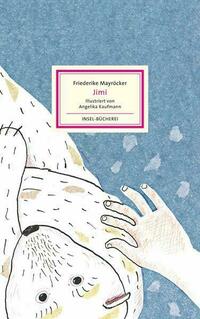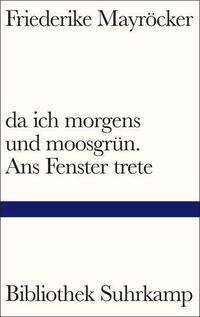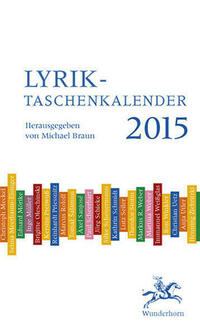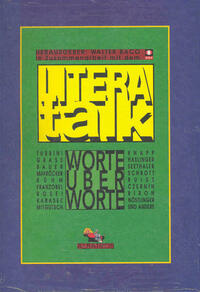"weiszt du, weil ich schreiben musz"
Thomas Ballhausen in FALTER 41/2014 vom 08.10.2014 (S. 15)
Altersradikalität: Friederike Mayröcker legt mit "cahier" den zweiten Band einer geplanten Trilogie vor
In "ich sitze nur GRAUSAM da" (2012) ist bei Friederike Mayröcker die Rede vom "waghalsigen Unternehmen, ein neues Buch zu schreiben". Im Dezember wird die Grande Dame der deutschsprachigen Poesie 90 Jahre alt. Es ist ein höchst glücklicher Umstand, dass weder ihre Produktivität noch ihre dahingehende Risikobereitschaft in den letzten Jahren zurückgegangen sind.
Ganz im Gegenteil: Mit "études" hat sie im Vorjahr den Grundstein zu einer geplanten Trilogie gelegt. Rhythmische Prosapassagen wurden da geboten, angelehnt an Arbeiten des französischen Ausnahmeautors Francis Ponge wurden musikalische Elemente und textliche Entsprechungen zu einer rauschhaften Komposition verflochten. "études" war ein vitales, gegen die Unsinnigkeit der Vergänglichkeit gerichtetes Statement, das einmal mehr Friederike Mayröckers Qualitäten und ihre Position in der Gegenwartsliteratur deutlich machte.
Auch der Begriff des Cahiers – im Sinne einer literarischen Sonderform, die alles kann, aber nicht muss – ist darin schon angelegt und an einer konkreten Stelle auch klar benannt: "Übung cahiers Übung in den Heften". Der Wunsch "1 Buch ohne Entwicklung" zu schreiben hat sich im allerbesten Sinne auch auf den nun vorliegenden Folgeband übertragen. Abseits des Erzählens strömt Mayröckers "cahier = das Heftchen" in flottem Stil dahin und bietet eine temporeiche literarische Konzentrationsbewegung.
Obwohl wieder durchgehend datiert, darf "cahier" nicht mit einem klassischen Tagebuch verwechselt werden, die Abgrenzung zu diesem Texttypus wird sogar ausgesprochen: "Nein dies ist kein Diarium". Im Vordergrund steht dahingehend vielmehr der Ausdruck eines unausgesetzten Schreibens, eines im allerbesten Sinne unaufhörlichen und auch lebensfüllenden Schreiballtags: "habe fast keine Zeit für die gewöhnlichen Dinge, weiszt du, weil ich schreiben musz".
Diese Betriebsamkeit ist alles, was zählt. Das Ausstellen der damit verbundenen Gesten und Szenen fügt sich perfekt in die kondensierte Verhandlung. Es wird hier vor allem angesichts des Lebens, des Alterns und der Natur geschrieben, immer bemüht um Absetzbewegungen vom lauernden "le kitsch" als auch vom "Jugend Jargon". Letzterer fließt stellenweise als Zitat ein, dessen semantische Ebene eine Neudefinition erfährt: Da wird aus "SKYPEND" und "re-cap" ein himmlischer Hinweis oder eben das Neuaufsetzen von Kappen.
Diese sprachlichen Differenzierungen Mayröckers sind aber nicht, wie bei manchen konservativen Vertretern der bundesdeutschen Literatur, elitäre Exklusionsgesten, sondern vielmehr Teil der eigenen poetischen Positionierungsarbeit. Diese manifestiert sich, auch hier als Fortschreibung und Steigerung eines in "études" angelegten Programms, deutlich in der eigentlichen Textgestaltung.
Neben dem bewussten Arbeiten mit Interpunktion, typografischen Elementen oder Hervorhebungen sind zwei bemerkenswerte Neuerungen zu bemerken. Einerseits rückt die Zeichnung, und mit ihr die direkte Verbindung von Wort und grafischer Skizze, an dominante Stellen. Teilweise seitenfüllend, dann wieder in den gesetzten Text eingebunden, sind diese Spuren einer Handschrift über das ganze Buch hinweg vorhanden.
Andererseits stehen alle sequenzhaften Abschnitte unter Anführungszeichen. Einmal mehr wird auch mit diesem Hinweis die Direktheit des Gebotenen unterstrichen, denn "das Reden ist freilich Ablenkung vom Eigentlichen = vom Schreiben". Mayröckers Schreiben ist dabei nicht selten auch an das vorsätzliche Einbringen von Referenzen gebunden.
In "cahier" treten neben aus ihrem Register bereits vertrauter Größen wie Jacques Derrida, Roland Barthes, Samuel Beckett, Thomas Kling oder Friedrich Hölderlin auch neue Namen wie E.E. Cummings, John Keats, Gertrude Stein oder Ann Cotten. Die namentliche Nennung geht nicht selten mit direkten Zitaten einher, also einer weiteren Schreibbewegung.
Diese Tätigkeit ist deutlich auf das Einbinden des jeweils angespielten Texts in den eigenen Sprach- und Arbeitskosmos ausgerichtet, das übertragende Abschreiben wird zum nachvollziehenden Nach-Denken. Der damit geöffnete Echoraum der Literatur, der stimmig und nicht minder vielfältig um Musik und bildende Kunst ergänzt wird, meint im vorliegenden Text Mayröckers auch ihr eigenes umfangreiches Schaffen mit.
Die klug integrierten Selbstreferenzen reichen von der wortwörtlichen, dann wieder leicht variierten Wiederholung ganzer Passagen des vorliegenden Buchs bis zu Hinweisen auf "brütt oder Die seufzenden Gärten" (1998), ihrem wohl zugänglichsten Werk, oder jüngere Arbeiten wie der literarischen Geisterbeschwörung "vom Umhalsen der Sperlingswand" (2011). Das Herz wird in all diesen "Zeilen : die wildesten im Notizbuch" als eines der zentralen Motive, schriftlich wie zeichnerisch, erfahrbar.
Liebevoll meint für Mayröckers vorliegenden Text ganz wortwörtlich voller Liebe zu sein und einen entsprechenden Blick wahren zu wollen. Sehnsüchte nach Orten und Menschen – etwa Peter Handke oder das "geliebte Geistlein" Elisabeth von Samsonow – werden adressiert, wie selbstverständlich wird aus dem "cruellest month" April aus T.S. Eliots berühmter Eröffnungszeile zu "The Waste Land" der "zärtlichste Monat".
Friederike Mayröckers "cahier" ist Ausdruck einer lebensdurchdringenden Leidenschaft für die Literatur, die sich nicht zuletzt in einem handschriftlichen Faksimile zeigt. Da steht schlicht: "ich brenne". Und weiterhin gilt: "nicht nur das Geschriebene auch die Existenz muss poetisch sein".