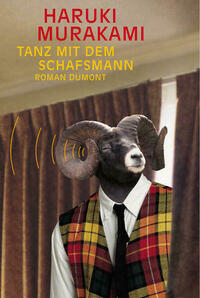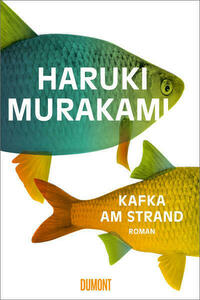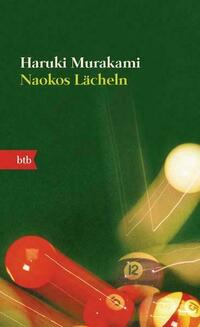Sebastian Fasthuber in FALTER 6/2021 vom 10.02.2021 (S. 35)
Und plötzlich ist die Magie wieder da. Dass das Geschehen in seinen Geschichten kippt und surreal wird, dafür ist der Japaner Haruki Murakami (Jg. 1947) seit vielen Jahren bekannt. Mit der Zeit hat diese Methode aber ein wenig an Reiz verloren. Zuletzt versuchte sich der Meister über die Marathondistanz und legte mit „1Q84“ und „Die Ermordung des Commendatore“ zwei ausufernde, mehrbändige Romane mit Höhen und Tiefen vor.
Murakami liebt Klassik und Jazz. Sind die Romane Symphonien, so erlaubt er sich in seinen Erzählungen kleine Jazzimprovisationen. Der jüngste Erzählband ist eine Art Konzeptalbum, in dem er wieder zu großer Form aufläuft. Das Faszinierende an „Erste Person Singular“ ist weniger die Tatsache, dass der Autor die Ich-Perspektive wählt und aus seiner eigenen Biografie schöpft, sondern vielmehr, wie er auf sein jüngeres Ich blickt.
Die stärksten Geschichten sind jene, die zeitlich am weitesten zurückreichen. Nostalgische Verklärung liegt Murakami ebenso fern wie ein Belächeln des 20-Jährigen mit seinen alterstypischen Unzulänglichkeiten aus der abgeklärten Perspektive des Großschriftstellers. Er betrachtet ihn lieber mit neugieriger Sympathie. Auch die Gelassenheit des Tons ist einnehmend.
Die Hauptrollen spielen sowieso andere. Eine Kellnerin und Hobbypoetin etwa, mit der der Ich-Erzähler vor 50 Jahren nur eine Nacht verbracht hat, deren Gedichte er jedoch bis heute auswendig kann; der schräge Bruder seiner ersten Freundin oder die Jazzikone Charlie Parker.
Wie auch andere Erzählungen umspannt „Charlie Parker Plays Bossa Nova“ mehrere Jahrzehnte. Als ganz Junger schrieb Murakami die Rezension eines fiktiven Albums mit diesem Titel. Viel später will er die Aufnahme in einem New Yorker Plattenladen tatsächlich gesehen haben. Wieder mit einigem Abstand erschien ihm Parker im Traum, um die Musik für ihn zu spielen. Man hält inne und staunt, ohne sich von erzählerischen Taschenspielertricks überwältigt zu fühlen – das ist der Murakami-Effekt.