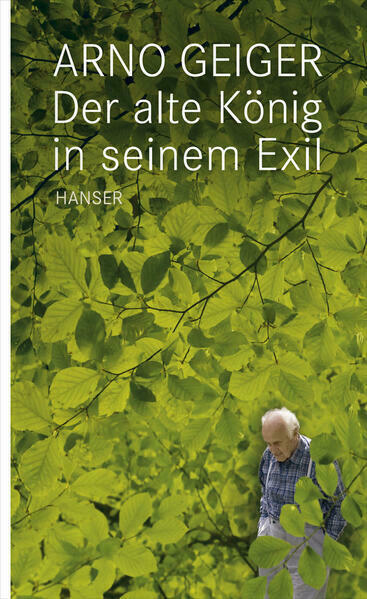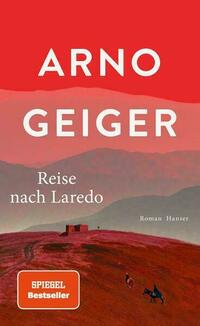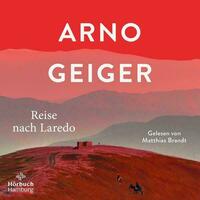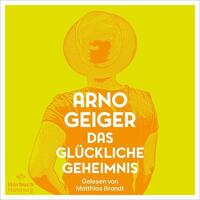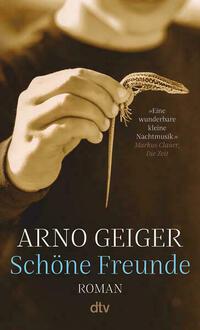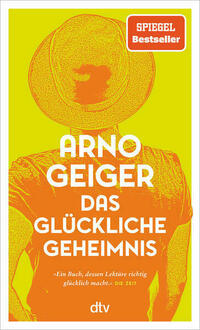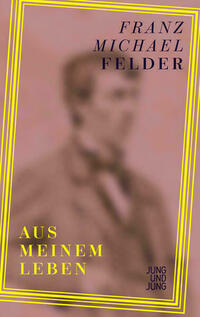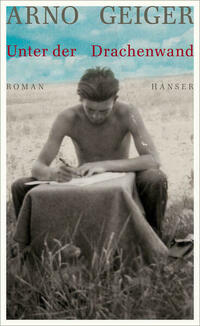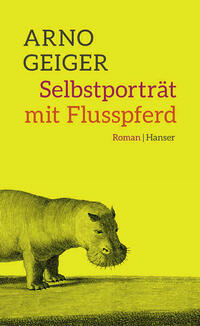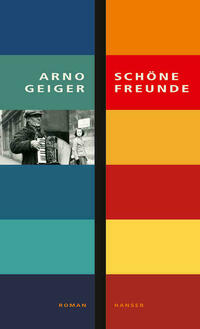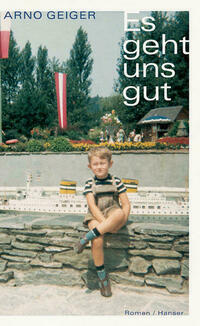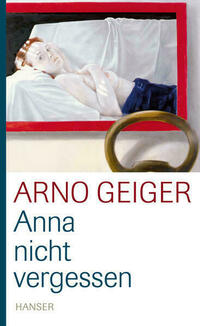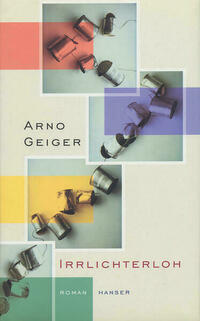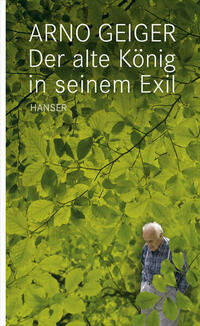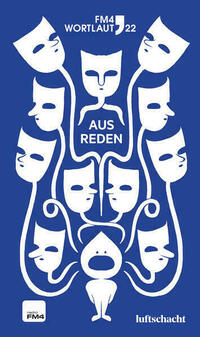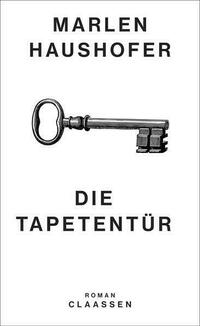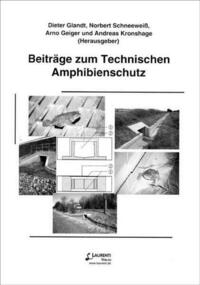Die Suche nach dem verlorenen Vater
Sigrid Löffler in FALTER 10/2011 vom 09.03.2011 (S. 24)
Mehr oder weniger autobiografisch schreiben die Söhne ihren Vätern hinterher, tragen diesen ihren Hass und ihre Liebe bis ins Grab nach
Über nette Väter werden keine Bücher geschrieben. Unnette Väter hingegen geben seit Abraham unendlich viele Geschichten her. Auf dem Buchmarkt scheint die Nachfrage nach unglücklichen Kindheiten unter der Herrschaft tyrannischer Väter denn auch unersättlich. Allein in diesem Frühjahr erscheinen mindestens zwei Dutzend neue Vater-Sohn-Geschichten, bei denen teils schon die Titel verraten, was Sache ist: "Im Schatten des Vaters", "Der letzte Patriarch", "Die Tränen meines Vaters", "Cevdet und seine Söhne", "Lügen über meinen Vater".
Stark ist gut, aber schwach geht auch
Um literaturtauglich zu werden, müssen Väter allerdings das Zeug zum Erzählstoff haben – nämlich Konfliktpotenzial en gros. Vater-Sohn-Beziehungen müssen kompliziert sein und möglichst die ganze Gefühlsskala abdecken, in aller Widersprüchlichkeit und aller Hassliebe. Vaterfiguren müssen schon aus dem Rahmen fallen, sonst lohnt sich's für die Söhne nicht, sich literarisch an ihnen abzuarbeiten.
Die Väter mögen Bundeskanzler gewesen sein und ihre Söhne mit ihrer Gefühlskälte und Gleichgültigkeit verletzt haben, wie Lars Brandt und neuerdings Walter Kohl in ihren kummervollen Vater-Büchern offenlegen. Auch ein berühmter Nazi-Filmregisseur wie Veit Harlan taugt als ergiebige, hassgeliebte Vaterfigur für die Sohn-Literatur, wie Thomas Harlan sie zuletzt geschrieben hat; und Péter Esterházy hatte gar einen gestürzten ungarischen Magnaten und Geheimdienstspitzel zum Vater, der sich in Weltliteratur verwandeln ließ. Und wenn Väter schon keine großen Namen haben, dann sollte ihnen von den gequälten Söhnen doch Überlebensgröße anderer Art nachgesagt werden können. Dann wird eben ein autoritärer Kärntner Ackermann zum alttestamentarisch grausamen Dorfgott hochgeschrieben, wie Josef Winkler das vorexerziert hat. Und soeben sind zwei Väter-Romane erschienen, in denen Säuferungeheuer als Familiendespoten ein Gewaltregime über ihre geduckten Söhne führen und dafür bis zu Mordfantasien gehasst werden: Der Schotte John Burnside und der Norweger Karl Ove Knausgård rechnen, kaum fiktiv verhüllt, mit ihren realen Schreckensvätern ab. Doch auch schwache Väter taugen zum Romanstoff – sofern die schreibenden Söhne ihrer Schwäche etwas Beispielhaftes abgewinnen können. Dem Vorarlberger Erzähler Arno Geiger und dem pakistanisch-britischen Autor Hanif Kureishi gelingt in ihren neuen Büchern eben dies. Beide porträtieren den eigenen Vater als exemplarisch gescheitert, der eine an seiner Demenzerkrankung, der andere als entwurzelter pakistanischer Migrant und erfolgloser Schriftsteller in London.
Die Söhne haben das letzte Wort
Wenn ein Mann Vater wird, dann gehört seine Geschichte nicht mehr ihm allein, dann wird er Teil der Lebenserzählung seines Sohnes – und diese Geschichte endet nicht mit seinem physischen Tod. "Vaterschaft ist eine Geschichte, die nicht nur anderen erzählt, sondern auch von anderen erzählt wird", stellt John Burnside fest. Alle Vatergeschichten mögen zunächst Herrschafts- und Allmachtserzählungen aus der Perspektive ohnmächtiger Söhne sein, doch sie handeln letztlich immer vom kontinuierlichen väterlichen Machtverlust. Die Söhne gewinnen an Stärke, die Väter werden schwächer; die Söhne gehen fort, die Väter bleiben auf der Strecke und haben das Nachsehen. Die Söhne haben immer das letzte Wort über das Leben der Väter – erst recht, wenn sie Schriftsteller sind.
Die Eiche seiner Kindheit
Das heißt allerdings nicht, dass die Söhne naturgemäß die Sieger sein müssen. Der Filmemacher, Holocaust-Rechercheur und Schriftsteller Thomas Harlan, der bis zu seinem Tod im vergangenen Oktober an seinem ultimativen und finalen Vater-Buch schrieb, hat sein ganzes Leben lang mit radikalem Furor seinen Nazi-Vater, den Regisseur Veit Harlan, und dessen Gesinnungsgenossen bekämpft. Nach Ansicht des Sohnes hat Veit Harlan mit seinem Hetzfilm "Jud Süß" den Judenvernichtern im "Dritten Reich" ein künstlerisches Mordinstrument an die Hand gegeben. Doch Thomas Harlans unerbittlicher Vaterhass war von seiner hingerissenen Vaterbewunderung nie zu trennen. Er blieb dem vermaledeiten Vateridol in ewiger Selbstzerfleischung verfallen, wie seinem nun posthum erschienenen Vater-Buch "Veit" auf jeder Seite abzulesen ist. Schwer zu sagen, was für eine Art Text "Veit" eigentlich ist: Totengedenken, Abrechnungs- und verquere Huldigungsschrift an den "Riesen, die Eiche meiner Kindheit", Liebesbrief an den "allerliebsten, einzigen, unglücklichen Vater", der 1964 auf Capri in den Armen der katholischen Kirche starb, erbitterte Familienvendetta, Wuttirade und überschwängliche Identifikationshymne auf einen reuelosen Nazi-Künstler. In seinem Exhibitionismus ist "Veit" das peinliche Dokument einer Kapitulation. Das Buch offenbart, dass der Sohn mit diesem Vater sein Leben lang nicht fertig geworden ist, und es endet mit dem Angebot des Selbstopfers: "Wenn Du Deine Verantwortung nicht trägst, ich übernehme sie an Deiner statt. Vater, Du Geliebter, Verstockter. Ich habe Deinen Film gemacht. Ich habe ,Jud Süß' gemacht. Lass mich Dein Sohn sein."
Der Vater aus der Flasche
Verglichen mit Thomas Harlans masochistisch zur Schau gestellten Gefühlsverwirrungen sind die Erinnerungen John Burnsides und Karl Ove Knausgårds an die Selbstzerstörungsorgien ihrer Säuferväter bei aller autobiografischen Offenheit nachgerade dezent zu nennen. Burnsides Vater, ein Hilfsarbeiter in der schottischen Bergwerksstadt Cowdenbeath, und Knausgårds Vater, ein Gesamtschullehrer im norwegischen Städtchen Kristiansand, hatten miteinander die despotische Befähigung gemein, ihre heranwachsenden Söhne die längste Zeit in unterwürfiger Angst zu halten. Beide Väter waren Familientyrannen mit Neigung zum Jähzorn, die ihre Söhne unter ihrer Lieblosigkeit leiden ließen und sie in die eigenen Selbstzerstörungsexzesse mit hineinzogen. Ihre Säuferkarrieren waren allerdings verschieden. Sein Vater, so schreibt John Burnside in seinem autobiografischen Roman "Die Lügen meines Vaters", den er jedoch als "ein Werk der Fiktion" wahrgenommen sehen will, war sein Leben lang ein Lügner, Angeber, Gewalttäter und schwerer Trinker, der seinen Wochenlohn im Pub versoff, während die Familie hungerte und aus gestohlenen Futterrüben Suppe kochte. Der Sohn erlebte ihn als "eine Art Monster, eine Naturgewalt, eine unberechenbare, wilde, manchmal absurde Kreatur, skrupellos und unglaublich schnell" und hasste ihn zeitweilig bis zu Mordfantasien und einem knapp abgebrochenen Mordversuch mit dem Küchenmesser. Erst nach dessen Tod – mit 62 Jahren an seinem vierten Herzinfarkt, der ihn in einem Pub zwischen Tresen und Zigarettenautomat niederstreckte – lernte Burnside seinen Vater in einem anderen Licht zu sehen. Sein Erzeuger war ein Findelkind gewesen, abgelegt an der Türschwelle fremder Leute und fortan immer nur lieblos weitergereicht und herumgestoßen – "ein verlorenes Kind, das kein Mensch gewollt hatte". Den Sohn, der parallel zum Untertang des Vaters seinen eigenen Absturz in Drogenkonsum und Trinken bis zum Säuferwahn durchlebte, überkommt im Nachhinein Mitleid: Er erkennt die zwanghafte Lügerei des Vaters als Versuch eines "Niemands von Nirgendwo", sich eine Identität und eine Geschichte zu geben. Inzwischen selbst Vater zweier Buben, gelingt dem Autor eine Art Versöhnung mit dem Toten. Burnside schreibt, "dass ich meinem Vater auf meine Weise vergeben hatte, was mir von ihm angetan worden war, dass ich es aber niemals vergessen würde".
Vorsätzliche Selbstzerstörung
Im Leben von Karl Ove Knausgårds Vater gab es einen jähen Bruch, für den der Sohn und Autor in seinem Roman "Sterben" trotz allem detailversessenen Hyperrealismus seiner ausufernden Lebenserzählung keine Erklärung zu geben vermag. Als Knausgård ein 16-jähriger Gymnasiast war und eben die Wonnen des Alkohols für sich entdeckt hatte, ließen sich seine Eltern abrupt und ohne Angabe von Gründen scheiden. Der Vater gab den Lehrerberuf auf, zog mit einer blutjungen Geliebten in den Norden Norwegens, zeugte noch ein Kind und verschwand aus dem Leben des Sohnes, das er bis dahin – mürrisch, wortkarg, nüchtern und autoritär – bis ins Kleinste reglementiert hatte. Der Sohn wird ihn erst als Leichnam im Bestattungsinstitut wiedersehen. Und erst von seinem fürchterlichen Ende her wird er den Untergang seines Vaters in seiner ganzen Unbegreiflichkeit rekonstruieren können. Der Vater ist vorsätzlich vor die Hunde gegangen. Er hat sich buchstäblich zu Tode gesoffen und ist, verbarrikadiert in seinem völlig verwahrlosten Elternhaus und in Gegenwart der hilflos-dementen Mutter, inmitten einer Müllhalde leerer Flaschen in seinem Unrat verreckt. Wie konnte das geschehen? Karl Ove Knausgård hat keine Deutung anzubieten, doch in seiner peniblen Familienerzählung, in der sich sein Held Karl Ove an Schlüsselszenen seiner Kindheit und Jugend erinnert, herrscht von Anfang an ein Klima der Gleichgültigkeit, der Knausrigkeit und emotionalen Kälte. Diese Familie ist bereits innerlich zerfallen, ehe sich die ersten Risse zeigen und der Vater sein Selbstzerstörungswerk beginnt. Nur in einem großen gemeinsamen Besäufnis finden der Ich-Erzähler Karl Ove, seine verwirrte Großmutter und sein angereister Bruder im Schatten des toten Patriarchen rauschhaft zu einer Art Familiengefühl zurück.
Der Zugriff des zärtlichen Sohns
All diese Sohn-Romane beschwören, obwohl sie von Entfremdungen und Zerwürfnissen handeln, immer auch die körperliche Präsenz des Vaters. Doch keiner dieser Autoren ist dem eigenen Vater näher auf den Leib gerückt als Arno Geiger. Dieser Sohn sucht sogar ins alzheimerkranke Gehirn seines Vaters vorzudringen, um die Zerrüttungsprozesse möglichst intim zu beobachten, in aller Sohnesliebe. Er führt Protokoll, ganz der recherchierende Schriftsteller, der die merkwürdig weise klingenden Fehlleistungen des Vaters für sein späteres Buch sammelt und notiert. Eine Blütenlese der surreal anmutenden väterlichen Gesprächsäußerungen ist jedem Kapitel in Zitaten vorangestellt. Im Gegensatz zu den hasserfüllten Söhnen Harlan, Burnside und Knausgård ist Arno Geiger ein liebevoller Sohn. Er und seine Geschwister begleiten und tragen den Vater August Geiger durch alle Phasen des geistigen Abbaus und Zerfalls. Sie behüten ihn, sie lassen ihn nicht im Stich. Der Alte kann in Würde und Respekt verdämmern und dahinschwinden. Arno Geiger macht aus seinem dementen Vater eine exemplarische Gestalt, einen großartig verwirrten König Lear von Wolfurt im Rheintal. Er überhöht ihn zum titelgebenden "Alten König in seinem Exil". Und doch kann man als Leser keinen Augenblick vergessen, dass Arno Geiger nicht nur ein zärtlicher Sohn ist, sondern zugleich auch als kühl Material sammelnder professioneller Autor auftritt, der bei aller Empathie der teilnehmenden Beobachtung sein Schreibziel nie aus den Augen verliert. "Ich dachte mir, da haben sich zwei gefunden, ein an Alzheimer erkrankter Mann und ein Schriftsteller. Ich wollte mir mit diesem Buch Zeit lassen, ich habe sechs Jahre darauf gespart", bekennt er. Der Leser wird zum beklommenen Zeugen eines lange geplanten Übergriffs gemacht. Seltsam, dass diese zärtlich gemeinte Bloßstellung eines wehrlosen Vaters sich letztlich verstörender liest als die aggressiven Abrechnungen der anderen Schriftsteller-Söhne mit ihren Vater-Unholden.
Ich habe ihn nicht wirklich gekannt
Noch deutlicher als Arno Geiger legt sein britisch-pakistanischer Kollege Hanif Kureishi sein Vater-Erinnerungsbuch als schriftstellerisches Konkurrenzunternehmen an. Denn Kureishi senior war nicht nur ein aus Pakistan eingewanderter Migrant, der an der Londoner Botschaft seines Landes einen unbedeutenden und langweiligen Posten bekleidete; er war auch ein gescheiterter Schriftsteller, der sein Leben lang für die Schublade schrieb, weil er trotz aller Bemühungen nie einen Verlag fand. Nach seinem Tod sucht der Sohn aus den Manuskripten des Vaters dessen Leben zu rekonstruieren, immer im vollen Bewusstsein, an Vaters statt selbst der erfolgreiche Schriftsteller geworden zu sein. Das Resümee seiner Gedenkarbeit könnte als Motto für alle Sohn-Bücher taugen: "Nach allem habe ich bei meinem Vater das Gefühl, dass ich ihn im Grunde gar nicht wirklich kannte.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: