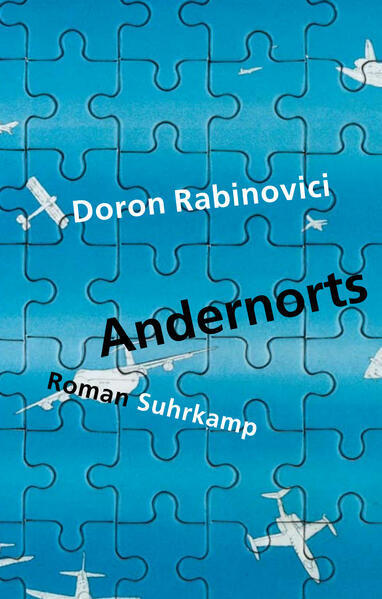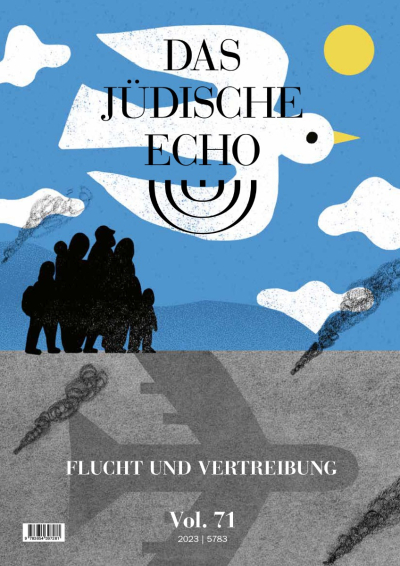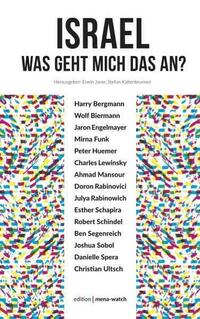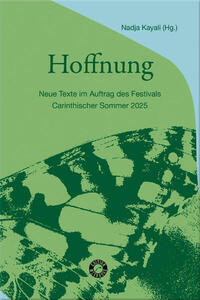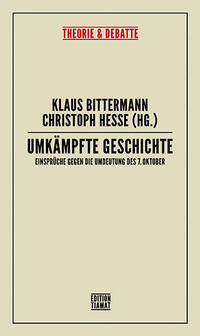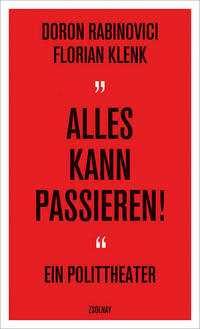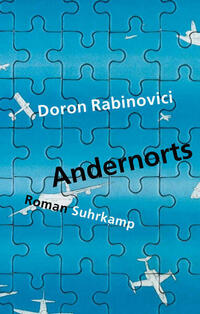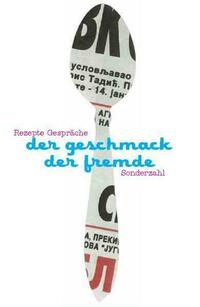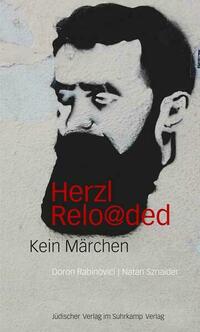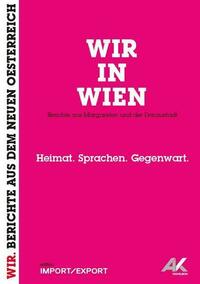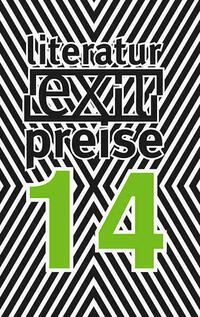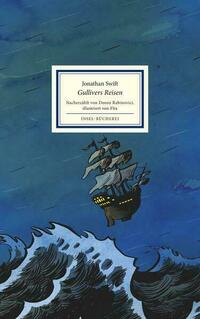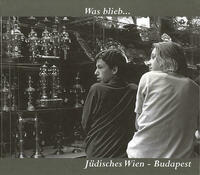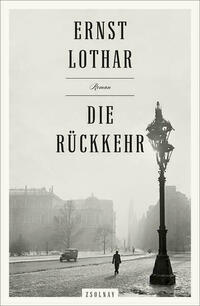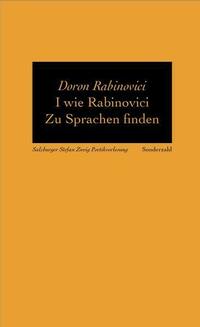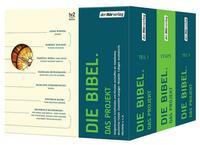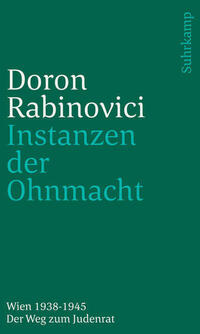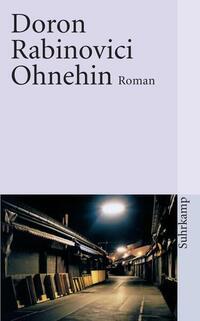Die ganzen Schmonzetten über Jiddn und Identität
Klaus Nüchtern in FALTER 36/2010 vom 08.09.2010 (S. 28)
Identität? Eine Groteske! Doron Rabinovici drückt in seinem Roman "Andernorts" gehörig auf die Slapsticktube
Das waren noch Zeiten, als im Zuge von Verwandtschaftsfeststellungen oder Adoptionen Klassen- und Konfessionsgrenzen überschritten wurden und das Tor zu wahrer Humanität sich öffnete. Sogar erotische Attraktion wurde suspendiert und ansatzlos – "Ah! Meine Schwester! Meine Schwester!" – in Geschwisterliebe zwischen einem Judenmädchen und einem christlichen Tempelherrn verwandelt, die ihrerseits als Metapher grenzüberwindender Menschenliebe fungierte: Alle Menschen werden G'schwister!
Dass es weder der bürgerlichen Aufklärung noch der Diktatur des Proletariats, ja nicht einmal den Esperantisten gelungen ist, die Menschen verschiedener Kontinente in ein freundliches Posthistoire zu führen, in dem die Dynamik von Klassen-, "Rassen"- und Verteilungskonflikten stillgestellt wäre, ist bekannt. Selbst in unseren ach so aufgeklärten und zivilisierten Kreisen herrscht ein ungemütliches Gerangel um Identität – erst recht, wenn's darum geht, sich eindeutigen Identitätszuweisungen zu entziehen.
"Wen kümmert's, wer spricht?", meinte Michel Foucault und hat in dieser Frage das "wohl grundlegendste ethische Prinzip zeitgenössischen Schreibens" ausgemacht. So fruchtbar diese programmatische Wurschtigkeit für die Literatur sein mag, so wenig zählt sie im diskursiven Alltag, wo die vermeintlich rhetorische Frage sehr schnell wieder fundamental wird: Wer wann wo und zu wem spricht, entscheidet erst darüber, was überhaupt gesagt wurde.
Doron Rabinovicis soeben erschienener Roman "Andernorts" hat genau hier seinen Ausgangspunkt: Nachdem der Kulturwissenschaftler Ethan Rosen es abgelehnt hat, einen Nachruf auf den soeben in Israel verstorbenen Emigranten Dov Zedek zu
schreiben, übernimmt sein Kollege und Konkurrent Rudi Klausinger den Job. Rosen ist darob erbost und verfasst für dieselbe Wiener Zeitung eine polemische Replik, die sich freilich gegen ihren Verfasser richtet: Just jene Passagen nämlich, die Rosen am heftigsten aufstoßen, entstammen einem Artikel, den er selbst vor Jahren für ein liberales israelisches Blatt verfasst hat und die von Klausinger in dessen Nachruf zustimmend zitiert worden waren.
Der Versuch des Institutsvorstands, den Streit der beiden Konkurrenten zu schlichten, endet mit einem Eklat: Als Klausinger im Rahmen der Aussprache seine Suche nach dem verschollenen jüdischen Vater ins Treffen führt, ist Rosen ob der Obszönität dieser Herkunftsthematisierung empört und zieht seine Bewerbung für die Professur zurück.
Aus dem Clinch werden die beiden Konkurrenten für den Rest des Romans nicht mehr herauskommen. Ihr Infight findet in Tel Aviv seine Fortsetzung, wo sich Klausinger zu Rosens Fassungslosigkeit vor dem Krankenbett von dessen Vater Felix einfindet, dem nun auch noch die (von Rosens Mutter) gespendete Niere den Dienst zu versagen droht.
Das ist freilich nur der Beginn einer ganzen Kette von Kalamitäten und Koinzidenzen, die unter anderem im Versuch eines durchgeknallten Rabbis kulminieren, die Ankunft des pränatal ermordeten Messias mit den Mitteln der Gentechnik doch noch einzuleiten. Zum weiteren Verlauf des Konkurrenzkampfes zwischen Ethan und Rudi nur so viel: Hätten die Gebrüder Coen Lessings "Nathan" durch die Mangel gedreht, es könnte kaum turbulenter zugehen.
Ein virtuoses und respektloses Vexierspiel um "die ganzen Schmonzetten über Kohn und Kontext, Jiddn und Identität", wie es einmal sehr hübsch heißt – das war es wohl, was der Autor im Sinne hatte. Leider ist die Verwandlung der Blaupause in einen Roman nur ansatzweise gelungen. Neben einigen geglückten Bonmots (siehe oben) finden sich aber eben auch zahlreiche Passagen, die einem allenfalls ein müdes Schmunzeln entlocken: "Du bist ein Mischmasch aus Tel Aviv und eine Melange aus Wien", lautet so ein Satz, der bald einmal jemandem einfällt, den man sich dann aber wohl verkneifen sollte. Ähnliches gilt für die berufsspezifische Metaphorik, mit der eine Modedesignerin charakterisiert wird: "Ihr Kleid und ihre Worte ein einziges Fließen, ihre Stimme seidiger als die Gewänder, die sie nähte." Und so sehr man des Autors Anfälligkeit für Alliterationen und Assonanzen auch nachvollziehen kann, so ist es wohl besser, jemanden einfach im Regen stehen zu lassen, wenn die Alternative dazu so lautet: "Er trottete durch die Tropfen."
Nicht nur in der sprachlichen Feinarbeit, auch in der epischen Konstruktion leistet sich der Autor so manche (Nach-)Lässigkeit, wechselt zwischendurch schnell mal die Erzählperspektive oder verliert die durchaus liebevoll eingeführte Geliebte Ethans allzu sehr aus den Augen.
Dass die Figuren allesamt buchstäblich reden wie gedruckt (wie etwa in Dovs rhetorisch überhochmetztem Tonbandmitschnitt für Ethan offenkundig wird), verleiht dem Roman eine Schwerfälligkeit, die so gar nicht zur angestrebten Rasanz passt.
Dieser Mangel an Timing und Ökonomie wird vor allem in den betulichen und beschwerlichen auktorialen Kommentaren manifest. Dass ein Kampfhund namens Nebbich einen der Protagonisten anlasslos in den Arsch beißt, mag man ja noch als Slapstick hingehen lassen; dass der Erzähler immer gleich krachend mit seinen Aus- und Festlegungen ins Haus fällt, sobald sich auch nur die Konturen einer Figur oder eines Handlungsverlaufs abzeichnen, legt den Schluss nahe, dass das Vertrauen des Autors in die Auffassungsgabe seiner Leser eher begrenzt ist. Dergleichen trübt das Vergnügen, das man bei der Lektüre immer wieder hat, dann doch erheblich.