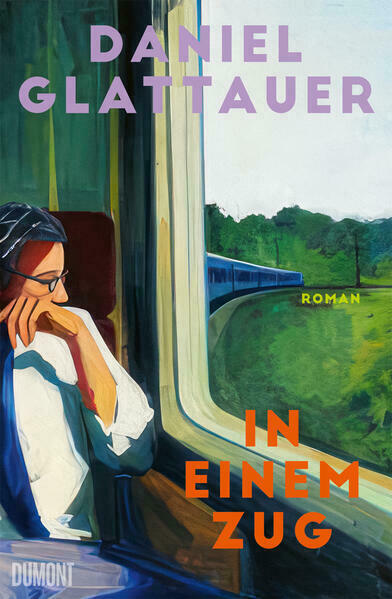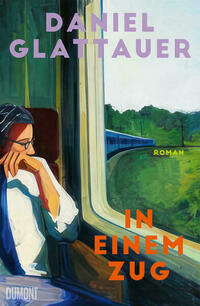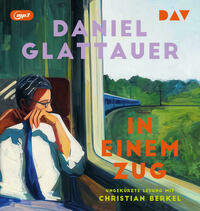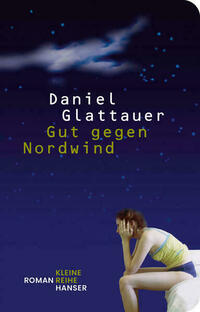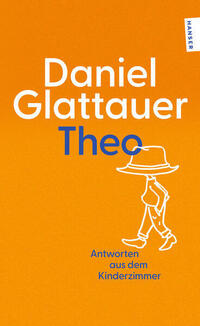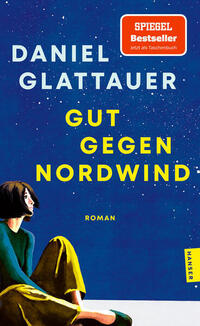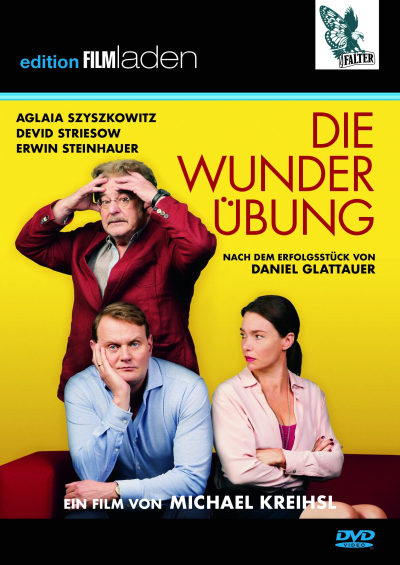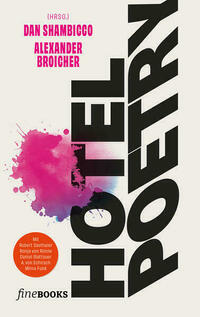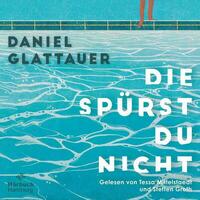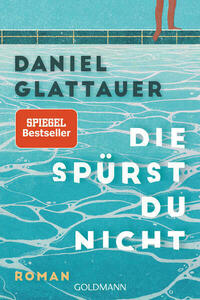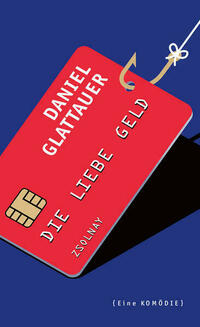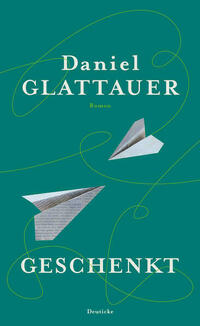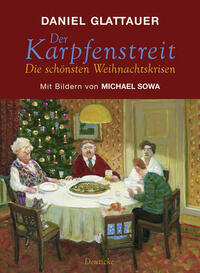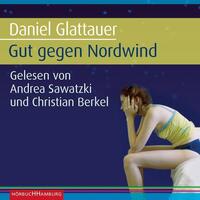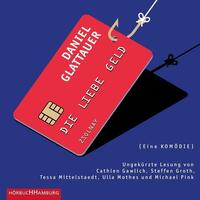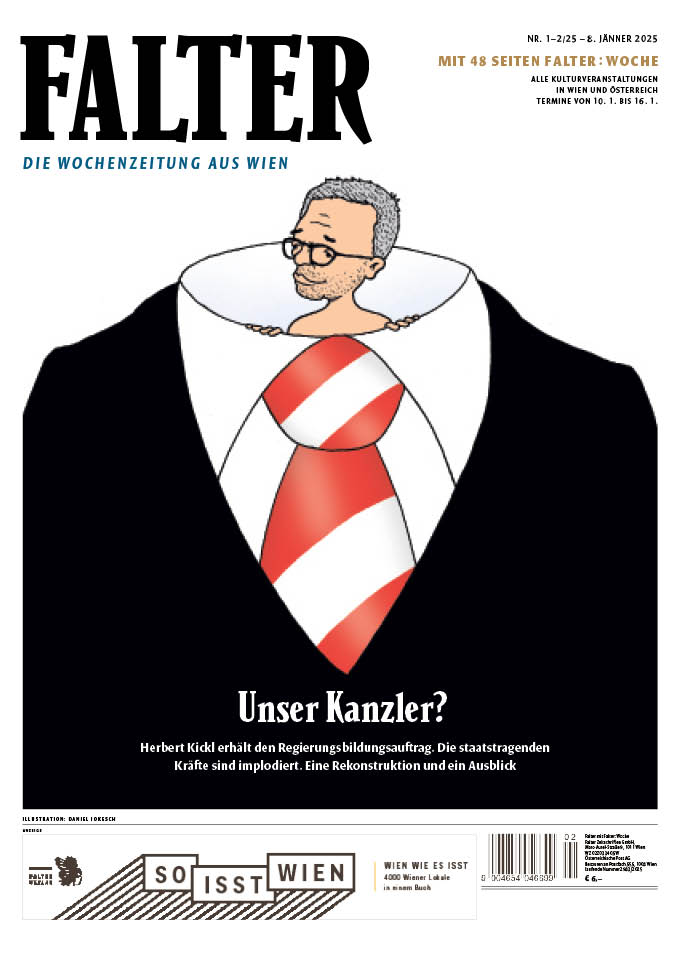
Schlag und Sahne
Sebastian Fasthuber in FALTER 1-2/2025 vom 08.01.2025 (S. 28)
Gelingende Langzeitbeziehungen sind selten Selbstläufer. Sie verlangen danach, dass sich beide Seiten bemühen. Offenbar hat sich Daniel Glattauer nach fast 25 Jahren bei Deuticke sowie später beim Verlag Zsolnay nicht mehr entsprechend geschätzt gefühlt.
Immerhin war er als Bestsellerautor lange die Cashcow des Wiener Verlags. Nun ist er nach Köln zu Du-Mont gewechselt, wo etwa Michel Houellebecq und Haruki Murakami in deutscher Übersetzung erscheinen.
Sprachliche Anbiederung an den großen Nachbarn kann man Glattauer nicht vorwerfen. Sein neuer Roman "In einem Zug" wartet neben einer Reihe von Austriazismen unter anderem mit einer Erklärung auf, warum es "Schlag" und nicht "Sahne" heißen muss. Vermutlich findet man das in Deutschland sogar knuffig.
Eduard Brünhofer ist als Hauptfigur und Ich-Erzähler ein Alter Ego des Schriftstellers. Ein bisschen spielt der Text mit dem Trendsport Autofiktion: Wie Glattauer ist Brünhofer ein Erfolgsautor, der am liebsten seine Ruhe hat und öffentlich kaum in Erscheinung tritt; und er ist ewig schon mit der einen Frau zusammen (im Roman heißt sie Gina, Glattauer wiederum hat diesen seiner Lisi gewidmet).
Was die beiden außerdem eint, ist die Liebe zum Wein. Brünhofer versucht seit Jahren, seinem Verlag ein autobiografisches Sachbuch mit dem Arbeitstitel "Ich liebe Alkohol" reinzudrücken. Ohne Erfolg -der Zeitgeist lässt Derartiges nicht zu.
Im Gegensatz zu seinem Schöpfer hat er seit mehr als zehn Jahren nichts mehr veröffentlicht. Davor reüssierte er auf dem Feld des Liebesromans mit Schmonzes wie "Tanz im Eis", bis ihm die romantischen Ideen ausgingen. Es ist, als würde Glattauer imaginieren, wie es mit ihm weitergegangen wäre, hätte er nach "Gut gegen Nordwind" (2006) und "Alle sieben Wellen"(2009) nicht auch einmal Neues ausprobiert.
Brünhofer sitzt im Zug nach München, wo ihm ein unangenehmer Termin bei seinem Verlag bevorsteht. Er hat den Vorschuss für einen Roman kassiert (und ausgegeben). Das Manuskript ist überfällig. Doch in seinem Reisegepäck findet sich nichts Verwertbares: "Ich kann nicht mehr liefern. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Ideen mehr."
Kann Glattauer liefern? Das Beobachten von Menschen, das Beschreiben ihrer Gefühle und Gedanken hat er nicht verlernt. Wie in seinen E-Mail-Romanen greift er wieder auf die Dialogform zurück. Diesmal sitzen zwei Menschen in einem Zug einander schräg gegenüber und reden.
Die Gesprächsanbahnung verläuft zunächst etwas holprig. Überhaupt benötigt der Roman, dessen Kapitel nach den Stationen der Westbahnstrecke benannt sind, recht lang, um Fahrt aufzunehmen.
Brünhofer weiß nicht, was die Frau, die ihn in ein Gespräch verwickelt, von ihm will. Sie behauptet, seine Bücher nicht zu kennen, befragt ihn dafür aber erstaunlich ausdauernd, woher er als Liebesromanautor seine Inspiration nimmt und wie sich das eigentlich mit einer Langzeitbeziehung verträgt.
Sprich: Sie stellt ihm indiskrete, zum Teil unverschämte Fragen, die Glattauer in einem Interview wohl nie beantworten würde. Auch seine Romanfigur reagiert erst mürrisch, erliegt dann aber langsam dem Charme des Gegenübers. Außerdem wird irgendwann Wein geholt, was Brünhofers Zunge lockert. Und er genießt es, nicht an München denken zu müssen.
Am dramaturgischen Aufbau hapert es ein wenig. Glattauer schlägt das Obers lange auf geringer Stufe, um am Ende kurz ordentlich aufzudrehen. Manche Leserinnen und Leser werden das versäumen, weil sie schon vorher aussteigen (in Amstetten oder Wels zum Beispiel).
Im Text finden sich nur sehr versteckt Hinweise auf den großen Plot-Twist zum Schluss. Ohne zu spoilern: Dieser löst auf überraschende Weise alles auf, ohne die Probleme - Brünhofers, der Welt, des Buchmarkts - grundsätzlich anzugehen.
Der Roman entwickelt sich gegen Ende zu einer schön giftigen Satire auf einen Literaturbetrieb, der sich langsam selbst abschafft. Vor lauter Podcasts und Social Media droht er das Buch an sich und dessen Strahlkraft aus den Augen zu verlieren. Eine Diagnose, die man durchaus unterschreiben kann.
An anderer Stelle wird es jedoch gar altvatrisch. So schimpft der Autor durch seine Figur über das Handy: "Und wenn die Menschheit aufgrund steter Verblödung rechtmäßig und endgültig ausgestorben ist, und es hat nur noch ein Einziger überlebt, weil ja immer einer der Letzte sein muss: Was wird der wohl machen? Na sicher. Selfies!"
Daniel Glattauer verfügt inzwischen über einen Instagram-Account, hat aber noch nichts gepostet und kaum Follower. Schauen wir mal, wie lang er damit durchkommt.