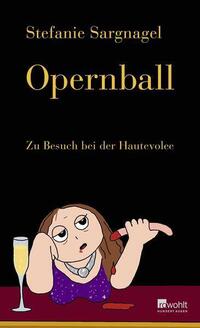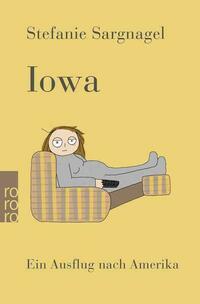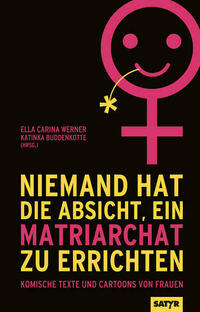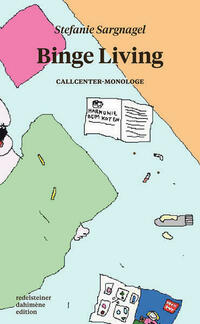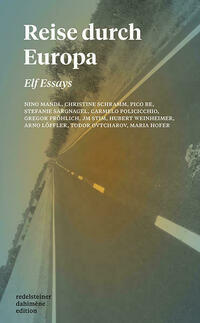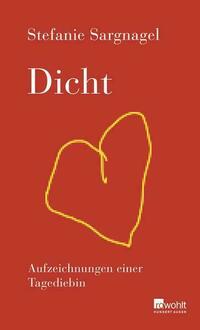„Seid ihr behindert? Ich kann urgut schreiben!“
Gerhard Stöger in FALTER 43/2015 vom 21.10.2015 (S. 26)
Stefanie Sargnagel veröffentlicht ihr zweites Buch. Ein Gespräch über fade Opernbälle, Feminismus und Krawall beim FPÖ-Fest
Stefanie Sargnagel ist die lustigste Depressive des Landes, ein bisschen so etwas wie ein Hermes Phettberg 2.0, mit der gleichen Unzimperlichkeit gegenüber eigenen und fremden Körperflüssigkeiten, allerdings ohne katholischen Hau.
Es gibt gute Gründe zu vermuten, dass der Unterschied zwischen der 29-jährigen Wiener Autorin mit der großen Facebook-Gefolgschaft und ihrer Protagonistin Stefanie Fröhlich aus dem dieser Tage erscheinenden Buch „Fitness“ enden wollend ist: Beide arbeiten in einem Callcenter; beide machen aus ihrem Herzen keine Mördergrube und nehmen sich kein Blatt vor den Mund; beiden sind Fäkal- und Genitalwitze ein unerschöpflicher Quell der Erheiterung, und beide haben ein offenkundiges Faible für alles, was sich irgendwo auf dem weiten Feld zwischen angeranzt und abgefuckt bewegt.
Das ist wohl auch der Grund, warum sich Sargnagel, die eigentlich in Margareten wohnt, das berühmte Café Weidinger vis-à-vis der Lugner City als Ort ausgesucht hat, an dem das Gespräch stattfinden soll. Mit ihrer Stammlinie, dem 6er, der samt seinen Insassen in „Fitness“ prominent figuriert, habe sie nur fünf Stationen hierher, erklärt sie. Hier, wo alles so aussieht wie schon vor Jahrzehnten, bloß dass die Farbtöne „Gardine fumée“ und „Zahnschmelz Geriatrie“ noch etwas nachgedunkelt sind, trifft sie sich auch mit ihrer Mutter zum Kaffeetrinken – oder den Vater manchmal zufällig am dienstäglichen FPÖ-Rechtsaußen-Stammtisch.
Das Gespräch ist noch keine drei Minuten in Gang, da kommt ein Mann mit Räuberbart an den Tisch und erzählt Sargnagel eine mittellustige Anekdote aus den 1970ern. Es geht um Flaschenbier. Ein Bekannter? „Nein. Normalerweise ziehe ich solche Leute schon an, aber in diesem Fall liegt es wohl daran, dass ein Fotograf da ist.“
Falter: Frau Sargnagel, wie haben Sie den Tag der Wien-Wahl verbracht?
Stefanie Sargnagel: Daheim. Ich war zuerst im Callcenter, dann wählen, mit meiner Mutter essen, und danach hab ich bei mir zu Hause den Fernseher eingeschaltet. Mir ging das aber nicht so nahe, und ich hatte auch keine Angst. Erst beim Warten auf das Ergebnis habe ich plötzlich gewusst, was alle meinen, und mir gedacht: „Oh fuck! Was, wenn die Blauen wirklich die meisten Stimmen kriegen?“
Das angebliche Duell zwischen Rot und Blau hat Sie nicht motiviert?
Sargnagel: Schon, ich habe mich halt aufgerafft und die SPÖ gewählt. Parteipolitisch bin ich aber generell nicht so dabei. Seit ich denken kann, heißt es immer: „Jetzt kommen die Nazis, ganz Österreich wird nazifiziert!“ Ich glaube das halt nicht und denk mir eher: „Wäre auch flashig. Was passiert dann in Wien?“
Auf welcher Wahlparty hätten Sie sich weniger wohl gefühlt: bei den blauen
Doch-nicht-Bürgermeistern oder bei
den grünen Bobos?
Sargnagel: Ich habe gehört, dass das kleine Bier bei den Grünen fünf Euro gekostet hat und dass es bei den Blauen gratis Schweinsbraten gegeben hat.
Also hätte es Ihnen bei den Blauen
mehr Spaß gemacht?
Sargnagel: Es wäre dort wahrscheinlich interessanter gewesen, und ich hätte mich wohl mehr amüsiert. Ich glaube ja auch nicht, dass jeder FPÖ-Wähler ein Nazi ist. Manche sind einfach nur naiv oder ein bisschen dumm.
Sie haben letztes Jahr für Vice eine Reportage über das FPÖ-Oktoberfest geschrieben. Angst hatten Sie als linke Krätzn da keine?
Sargnagel: Ich dachte mir anfangs schon: „Uh, sieht man mir meine Haltung an?“ Aber ich finde es nicht sonderlich mutig, als weiße junge Frau in ein FPÖ-Zelt zu gehen. Ich habe ja keine Burka getragen. Was hätte mir groß passieren können? Ich war bummzu, ein bisschen auf Krawall gebürstet und hab halt den Strache angequatscht.
Sie sind aber ohne gröberen Wickel davongekommen?
Sargnagel: Die Ordner haben mich sehr bestimmt rausgeleitet, und ich hab noch besoffen rumgepöbelt: „Ihr Scheißnazis!“ Ich gehe da hin wie ein Tourist: Ich schaue mir Sachen an und erzähle davon.
Wie auch den Opernball, über den Sie heuer ebenfalls geschrieben haben?
Sargnagel: Ja, bloß dass der total fad ist. Ich bin extra bis vier Uhr in der Früh geblieben, aber es ist nichts passiert. Tiafe Szenen sind viel zugänglicher, denn in gehobenen Milieus wird ungleich stärker darauf geachtet, wie man sich gibt.
Eine Nacht im Tschocherl ist interessanter als eine Nacht auf dem Opernball?
Sargnagel: Es passiert einfach mehr. Im Fernsehen sieht der Opernball nach totaler Action aus, und dauernd sagt der Lugner etwas Peinliches. Vor Ort stehen aber alle nur fad herum und reden.
Ihre Bücher bestehen aus gesammelten Facebook-Postings. Sehen Sie sich eigentlich als Schriftstellerin?
Sargnagel: Ich war da früher sehr unsicher, aber jetzt, wo ich mehr Honorarnoten ausfüllen muss, sage ich mir: Ja, irgendwie bin ich halt Künstlerin oder Autorin oder irgendwas dazwischen. Zum Literaturbetrieb habe ich aber überhaupt keinen Kontakt. Literaturhäuser buchen mich auch nie für Lesungen. Meine Sachen seien nicht literarisch, heißt es immer.
Wie reagieren Sie da?
Sargnagel: Ich denke mir: „Seid ihr behindert? Ich kann urgut schreiben!“ Wenn jemand meine Sachen aber als Literatur bezeichnet, sage ich: „Geh, das ist doch nicht Literatur, da sind eher Witze!“
Die alte Marx-Brothers-Maxime also: Ich möchte keinem Klub angehören, der mich als Mitglied akzeptieren würde.
Sargnagel: Genau.
Ein Literaturstipendium haben
Sie aber bekommen?
Sargnagel: Ja, aber ich glaube, nur wegen eines Ukraine-Reiseberichts vor ein paar Jahren, das einzige Längere, das ich bislang geschrieben habe.
Per Autostopp durch die Ukraine, das
ist allerdings schon mutig.
Sargnagel: Ich hab vor anderen Sachen Angst: vor Smalltalk mit der Wurstverkäuferin beim Billa beispielsweise. Soziale Ängste halt.
Aber eine aufs Maul haben Sie bei Ihren Erkundungen noch nie bekommen?
Sargnagel: Nur einmal (zeigt die Narben auf ihrem Handrücken). Da bin ich in Marokko zu einem Verrückten ins Auto gestiegen, der mich mit dem Messer überfallen hat. Mein Fehler: Ich habe mein Bauchgefühl ignoriert.
Super Idee!
Sargnagel: Die Araber waren alle total chillig, aber wir haben da diesen manischen Vietnamesen kennengelernt. Weil wir zu dritt unterwegs waren, hatten wir keine Angst. Außerdem – sorry, rassistisches Klischee – wirken Asiaten nicht bedrohlich. Er war so alt wie wir und zierlich. Wir wollten noch Tschick holen, die Kioske hatten aber schon zu. Also meinte er, fahren wir halt ins nächste Hotel. So etwas finde ich schon interessant: Wie ist das, in Marokko in einem Hotel Tschick zu kaufen? Als wir dann zu zweit in seinem Auto losgefahren sind, wusste ich: Das war jetzt eine urblöde Idee. Er ist ins Nirgendwo gefahren und hat ein langes Messer gezogen. Als ich versucht habe, es ihm wegzunehmen, hat er mir in die Hand gehackt. Er wollte mich vergewaltigen, hat aber eh keinen hochbekommen. Ich bin dann losgerannt und mir vorgekommen wie im Film „Funny Games“.
Hat er Sie verfolgt?
Sargnagel: Nein, er ist weitergefahren. Ich bin auf die Autobahn gelaufen und habe versucht, jemand anzuhalten, überall voller Blut. Ich habe die Wunde mit einem Tuch abgebunden und gemerkt, dass mir ein bisschen komisch wird. Dann hab ich mich schon den Autos in den Weg gestellt, aber sie sind mir ausgewichen. Irgendwann ist doch jemand stehengeblieben und hat mich ins Hotel gebracht.
Warum nicht ins Krankenhaus?
Sargnagel: Die waren auch überfordert, und ich habe ihnen eben den Namen des Hotels gesagt. Ich war blutverschmiert, aber es war eh nicht so arg.
Klingt allerdings schon arg.
Sargnagel: Ja, es klingt so. Meine Reisebegleiter haben mich dann ins Spital gebracht. Ich konnte auch die Finger nicht mehr bewegen, weil er mir die Sehnen durchschnitten hat. Ein Freund hat sich dann wochenlang ganz lieb um mich gekümmert. Ich war auch nicht traumatisiert oder so und ein halbes Jahr später wieder in Marokko. Normalerweise sind die Leute nett zu mir. Das war halt ein Verrückter, bei dem ich das eigentlich auch sofort gemerkt hätte. An sich bin ich nicht besonders misstrauisch.
Bei aller Garstigkeit in Ihren Texten sind Sie doch eine Menschenfreundin?
Sargnagel: Ja. Ich glaube eigentlich schon, dass die Menschen lieb sind.
Die Lust an der Beschimpfung ist Ihnen aber nicht fremd. Neuerdings schreiben
Sie sogar böse Rap-Texte.
Sargnagel: Aber natürlich mit einem gewissen Ironieverständnis. Ich mag die Selbstbehauptung des Battlerap, aber ich battle mich nur mit Menschen, die das ebenfalls gerne machen. Das finde ich an Marco Wanda so schade: Als ich ihn kennengelernt habe, bin ich ihn gleich einmal angestiegen, weil ich mir dachte, dass er es mir als sprachbegabtes Alphatier sicher sofort zurückgibt. Leider war er gleich ur angerührt, weil ich seine Eltern beleidigt habe.
Die Geschichte des Eklats, die Sie
kürzlich in der Süddeutschen Zeitung erzählt haben, ist also wahr?
Sargnagel: Ja, nur dass sie in Wirklichkeit noch ein bisschen unangenehmer war.
Wie haben Wanda auf Ihren Text
reagiert?
Sargnagel: Bislang gar nicht. Hoffentlich ist Marco nicht persönlich beleidigt, denn er ist ein netter Mensch. Das Problem an Wanda ist ihr Mangel an Selbstironie, was aber vielleicht auch ihren Erfolg erklärt – diese absolute Ernsthaftigkeit.
Wandas Manager ist Ihr Verleger –
und wie die Band repräsentieren
auch Sie die aktuelle Wiener Popkultur.
Sargnagel: Kann man so sagen, ja. Wobei ich ja ein bisschen sauer bin auf Wanda: Ich war immer die mit der Bierflasche und dem Tschick, und jetzt sind sie das plötzlich. Ganze Schaufensterauslagen in Wien werden für Wanda geschmückt, ich will das auch! Aber natürlich gibt es auch Gemeinsamkeiten: Dieses Räudige, Versoffene, Melancholische, das hat schon etwas Wienerisches.
Was sind Ihre Wiener Lieblingsorte?
Sargnagel: Ich kann vielen Orten etwas abgewinnen, vor allem Orten, wo man Leute beobachten kann – egal, ob das jetzt die Favoritenstraße oder der Prater ist.
Leidet Ihre Beobachterposition nicht unter der zunehmenden Popularität?
Sargnagel: Im Wahlkampf wollte ich mir einen Stand der Neos unauffällig genauer anschauen, daraus wurde aber nichts, weil gleich einer von denen „Hey, Stefanie Sargnagel!“ gesagt hat. Ich dachte mir nur: „Oida, fuck!“ Vielleicht sollte ich einfach mal die rote Mütze abnehmen, dann wäre ich wieder inkognito.
Seit wann tragen Sie diese Mütze?
Sargnagel: Die hatte ich schon als Jugendliche. Früher habe ich sie ständig angebaut, aber jetzt ist es schon lange dieselbe. Daran merke ich, dass ich nicht mehr so exzessiv unterwegs bin.
Zuletzt hatten Sie neben der Kunst vorübergehend sogar zwei Jobs: Zum Callcenter kam ein Lehrauftrag an der Linzer Kunstuni. Ist das nicht seltsam?
Sargnagel: Ich glaube ganz im Gegenteil, dass das normal ist und die anderen halt nicht groß über ihre Nebenjobs reden. Tatsächlich fühle ich mich im Callcenter mehr zu Hause als an der Uni. Dort war ich fast deplatziert und dachte mir: „Was mach ich da vor all diesen beinahe Gleichaltrigen?“ Aber dann bin ich draufgekommen, dass sie eh sehr hörig sind, weil sie glauben, dass ich mehr wüsste als sie.
Das Callcenter kommt in Ihren Texten
sehr prominent vor. Wie gehen Ihre Vorgesetzten damit um?
Sargnagel: Ich rede dort mit niemandem. Ich komme hin, sitze meine Stunden ab und gehe wieder. Allerdings weiß ich, dass alle Bescheid wissen, und es gab sogar eine wirklich unangenehme Situation. Ein Text handelt davon, dass ich Angst vor einer dicken Kollegin habe und dass ich sie irgendwann sicher werde lecken müssen, weil sie so dominant ist. Eines Tages, das Buch war längst erschienen, sitze ich vor einer Lesung in Villach im Hotelzimmer und bekomme die Facebook-Nachricht „Ich möchte eigentlich nicht von dir geleckt werden“.
Und dann haben Sie sich mit einem Blumenstrauß entschuldigt?
Sargnagel: Ich hab ihr hundertmal erklärt, dass das ein fiktiver Text ist. Hat sie mir aber nicht geglaubt, weil sie einen anderen Kollegen auch erkannt hatte. Blöde Geschichte. Heute sagen wir „Hallo“ und gehen aneinander vorbei.
Die Grenzen des guten Geschmacks existieren für Sie nicht, oder?
Sargnagel: Viele Leute denken, es sei so arg, was ich mache, während ich selbst das naturgemäß anders sehe. Nach unten zu treten, damit wäre diese Grenze überschritten, aber sonst?
Ist Ihnen irgendein Text im
Rückblick peinlich?
Sargnagel: Eigentlich nur diese Sache mit der Kollegin. Ich hätte nie gedacht, dass diese Frau aus Floridsdorf ein Underground-Buch lesen würde, dadurch war die Geschichte etwas Abstraktes. Und dann war sie plötzlich etwas sehr konkret Verletzendes, was ich nie wollte.
Warum ist Manfred Deix Ihr Idol?
Sargnagel: Weil es ihm gelingt, mit Übertreibung ganz viel Wahrheit einzufangen, und weil er mich schon als Kind zum Lachen gebracht hat und das auch heute noch schafft. Deix hat mich stark geprägt. Als Fan habe ich ihm sogar einmal mein Buch überreicht. Ich will gar nicht unbedingt, dass er es liest, aber es war mir eine wichtige Geste. Die Reaktion war dann eh so: „Ah, verrückte Frau – danke!“ Ich glaube, auch Deix ist in Wirklichkeit depressiv und total empfindsam. Er muss sich betäuben, weil er die Welt so sieht, wie er sie zeichnet.
Haben Sie ein Lieblingsmärchen?
Sargnagel: Nein.
Mit Ihrer Direktheit erinnern Sie an das unschuldige Kind, das die Nacktheit in
„Des Kaisers neue Kleider“ benennt.
Sargnagel: Mag sein. Mein zweites Idol ist ja Christine Nöstlinger, die auch immer sehr wahrhaftig schreibt. Sie hat verstanden, dass die Kinderwelt ur die harte Welt ist. Da geht es um Scheidungen und darum, dass jemand zu klein, zu groß oder zu dick ist. Dieses Unverblümte ist in meinen Augen schon eine österreichische Tradition.
In Ihren Texten stilisieren Sie sich zu einem versoffenen Nichtsnutz, tatsächlich aber scheinen Sie Ihre Karriere doch recht konsequent zu verfolgen.
Sargnagel: Bekomme ich E-Mails, sage ich Ja, das ist alles. Ich ergreife keine Initiative, alles fliegt mir zu. Weil ich eine Lücke besetze, stehe ich halt ohne Konkurrenz da. Gedanken über meine Karriere habe ich mir aber noch nie gemacht.
Und darüber, welches Rollenbild
Sie als Frau verkörpern?
Sargnagel: Schon irgendwie – keine Ahnung.
Was jetzt? Schon, irgendwie
oder keine Ahnung?
Sargnagel: Aggressiv offensiv zu sein ist sicher kein schlechtes Vorbild. Wenn mich kleine Mädchen lesen, schadet ihnen das nicht. Inzwischen nehme ich auch zunehmend Einladungen zu Diskussionen an, ohne inhaltlich wirklich firm zu sein. Vielleicht mache ich mich lächerlich, denke ich mir, aber es gibt genügend Typen, die sofort hingehen würden, obwohl sie auch keine Experten sind. Sitze ich dort, sehen das womöglich junge Frauen und es hat einen Effekt. Ich selber würde mir beispielsweise wünschen, mehr coole alte Frauen im Fernsehen zu sehen – und nicht nur alte Männer und schöne, junge Frauen.
Sie sprechen jetzt aber nicht von Debattenrunden?
Sargnagel: Nein, von Filmen und Serien. Für Männer gibt es weit mehr Charaktere, das mediale Typenspektrum für Frauen ist einfach zu beschränkt. Welche Wirkung diese Bilder haben können, zeigt allein die Serie „Girls“ mit Lena Dunham, die halt ein bisschen blader ist und sich ständig auszieht. Wenn ich mir das anschaue, bin ich danach entspannter. Individuell mag das heute zwar anders sein, medial bekommst du aber nach wie vor permanent vermittelt, dass du als Frau in erster Linie durch Schönheit Aufmerksamkeit generierst. Und nicht dadurch, dass du dich durchsetzt oder arg bist. Selbst die coolsten Frauen, die ich kenne, scheißen sich immer noch mehr als die Typen, die sich nichts scheißen.
Mit dem Begriff des Postfeminismus können Sie vermutlich nicht allzu viel anfangen?
Sargnagel: Auf einer akademischen Ebene und in meinem Freundeskreis mag die Gleichberechtigung erreicht sein. Die Mainstream-Realität ist davon aber weit entfernt. Die Welt da draußen braucht klassischen Feminismus.
Sind Sie denn eine klassische Feministin?
Sargnagel: Ach, diese Labels … Ich bin nicht großartig theoretisch bewandert, sondern das ist eher etwas Stimmungsmäßiges. Ich bin jetzt Ende 20, und die ersten Menschen in meinem Umfeld machen Karriere, ob in der Kunst oder in der Musik. Geld und Einfluss bekommen dann aber doch in erster Linie Typen, fällt mir auf.
Die Nerds sind für gewöhnlich
männlich, warum ist das so?
Sargnagel: Das wäre gar nicht so problematisch, würde nicht alles weiblich Konnotierte immer ein schlechtes Image haben: Der Schachspieler gilt als cool, die strickende Frau als bieder. Ich bin ja selbst nicht davor gefeit: Sehe ich auf der Straße einen Typen mit drei Kindern, denke ich mir: „Bist du deppert, der ist ja ursuper!“ Bei einer Frau denke ich: „Ja, normal.“ Und wenn sie dann zufällig noch gestresst ist, frage ich mich, was das bitte für eine Oide ist.
Apropos: Wie halten Sie es mit Ronja von Rönne, der deutschen Autorin, die heuer durch ihren Text „Warum mich der Feminismus anekelt“ bekannt wurde?
Sargnagel: Den Text fand ich urdumm. Sie hat sich damit als kleines, hübsches Mädchen zur Verfügung gestellt, das sich alte Chauvinisten vor den Latz schnallen können. Wir waren sogar eine Weile in Kontakt.
Wie das?
Sargnagel: Sie hat mich angeschrieben und gefragt, ob wir uns nicht beim Bachmann-Preis treffen und miteinander trinken wollen. Und dass sie in der Welt über mich schreiben würde und ich umgekehrt ja auch etwas über sie machen könne. Warum nicht, dachte ich mir zuerst; abgesehen vom konkreten Inhalt mag ich so aggressive Posen ja. Dazu käme ein Moment der Solidarität – zwei junge Autorinnen schreiben übereinander –, und sie meinte auch, dass ihr der Feminismus-Text peinlich sei. Nur ist mir dann klargeworden, dass ich dadurch zwar an Reichweite gewinnen würde, sie aber an Credibility. Darauf wollte ich mich nicht einlassen, solange sie sich nicht öffentlich von diesem Text distanziert hat.
Ging es von Rönne nicht einfach um eine Absage an den Opferfeminismus?
Sargnagel: Ja, aber es ist die falsche Haltung, die Frauen zu hassen, um selbst kein Opfer zu sein. Natürlich kann man sich darüber beklagen, dass Frauen zurückhaltend sind und sich zu wenig trauen, aber die Kritik muss woanders ansetzen.
Worum geht es im Leben?
Sargnagel: Darum, keinen Stress zu haben, glücklich zu sein – und um Liebe. Würde ich monatlich 2000 Euro zur Verfügung haben, würde ich auf Facebook weiterhin lustige Sachen posten, weil ich das mag, ansonsten aber mit meinen Freunden abhängen und eine Familie gründen.
„Kann man sich künstlerisch etablieren
und trotzdem cool sein?“, fragen Sie im neuen Buch. Kann man?
Sargnagel: Ich bin ja noch nicht etabliert, das Interview mit News findet erst statt.
Und dann ist es vorbei mit der Coolness?
Sargnagel: Nein. Die Antwort auf die Frage, ob man sich künstlerisch etablieren und trotzdem cool sein kann, muss natürlich lauten: Ja, ich kann das!
Weil Sie der Über-Hipster sind?
Sargnagel: Nein, gar nicht, ich habe nicht einmal ein MacBook. Ich bin eher ein Hippie als ein Hipster, ich gehe lieber mit Freunden in den Park, als mich mit Technologie zu beschäftigen oder die neuesten HBO-Serien zu sehen. Es stört mich nicht, wenn man in mir den Über-Hipster sieht, mein Lebensziel ist allerdings, mit meinen Hippie-Freunden ein Haus auf dem Land zu mieten.
Wie viele Leute müssen das neue Buch kaufen, damit sich das ausgeht?
Sargnagel: Zu viele, fürchte ich. Wir müssen wohl erben, sonst wird das nichts.
Oder doch Kunst machen.
Sargnagel: Mein Studienkollege Chris Rosa verkauft seine Bilder mittlerweile um 50.000 Euro, das ist natürlich nicht schlecht. Obwohl die Kunstwelt nichts für mich ist. Und ich verstehe auch die Motivation nicht weiterzumachen. Habe ich zwei Bilder verkauft, sage ich doch: Danke, ich hab schon 100.000 Euro, tschüss!
Ihr erstes Buch hieß „Binge Living“, also „Leben im Rausch“, nun folgt „Fitness“. Wie geht es weiter?
Sargnagel: Der nächste Buchtitel wäre vielleicht „Geriatrie“. Wobei „Fitness“ natürlich sarkastischer gemeint ist. Man merkt, dass man sich nicht mehr so verschwenden kann wie früher und eigentlich etwas tun sollte. Es bleibt vorerst aber bei der Ambition. Früher dachte man, dass man ewig lebt. Aber irgendwann kommt man drauf: Ach so, nein, stimmt ja gar nicht!
Lesung: Schauspielhaus, 10.11., 20 Uhr